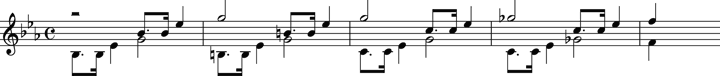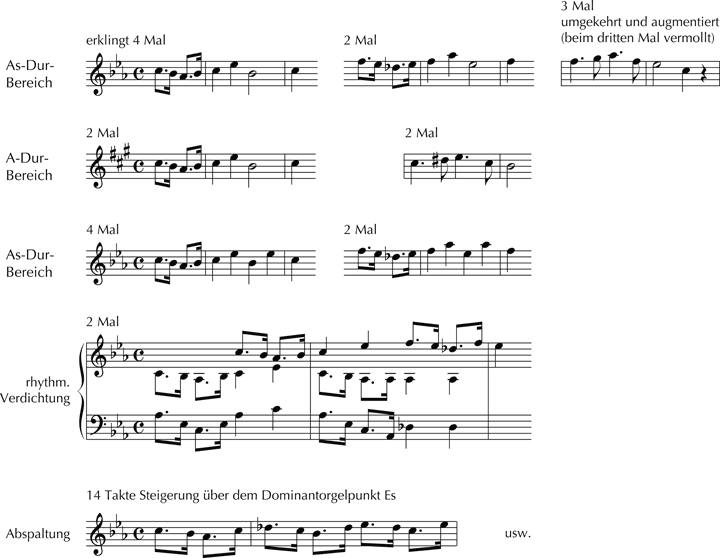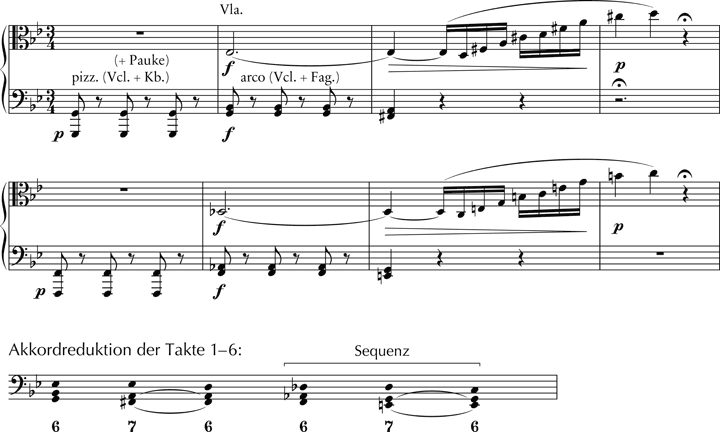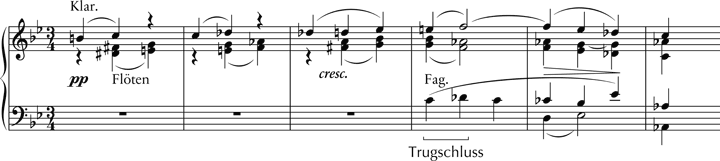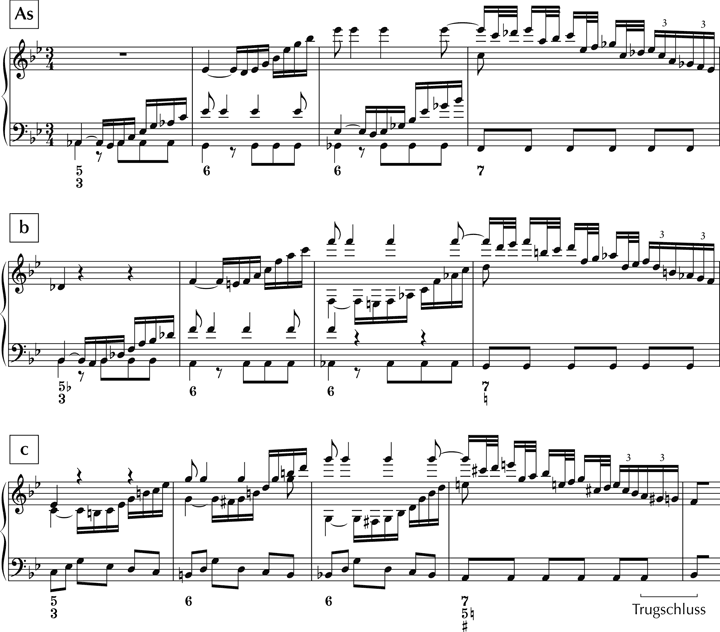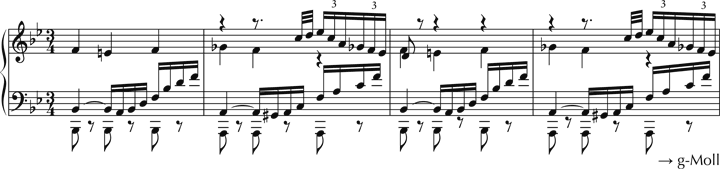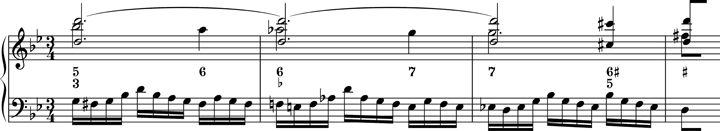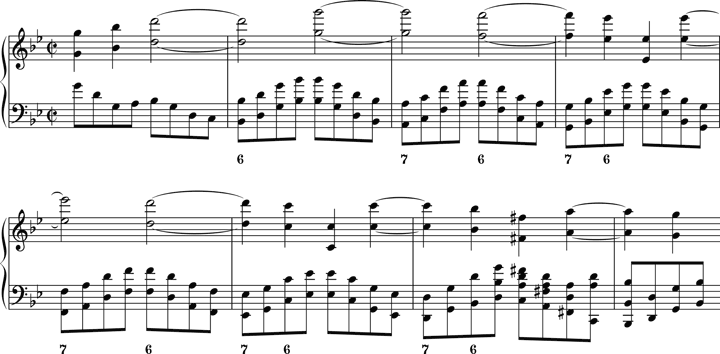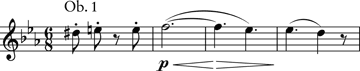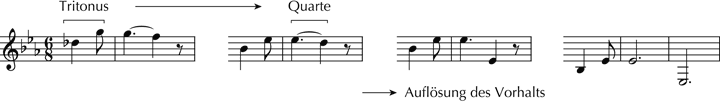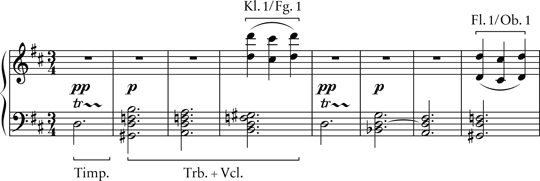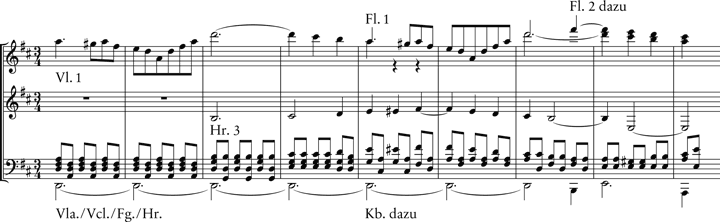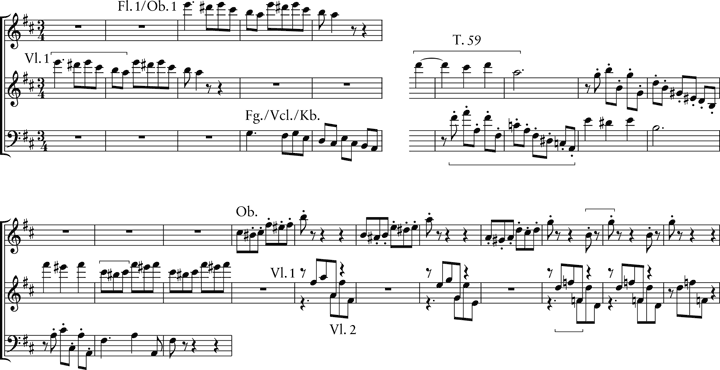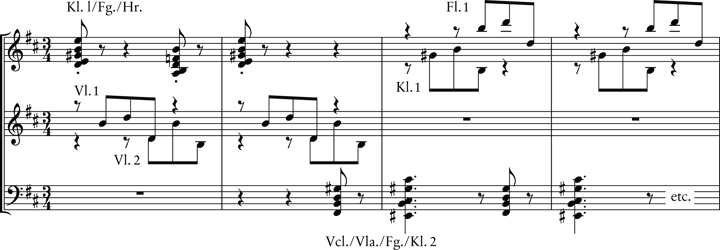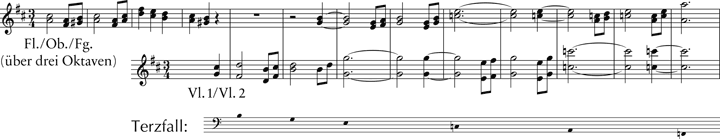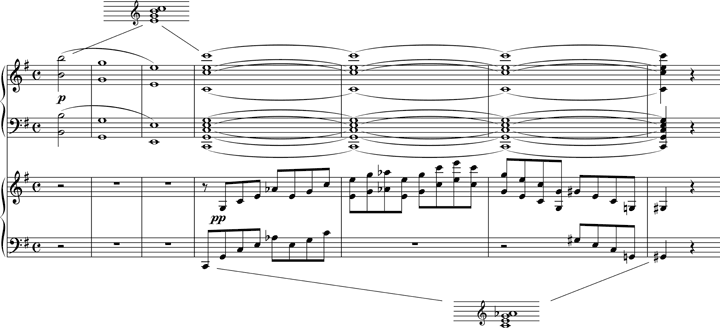Johannes Brahms’ Beitrag zur Sinfonik
Edith Metzner
Brahms’ Sinfonien entfachen musikalische Prozesse, die wieder an das narrative Prinzip Beethovens anknüpfen, ohne dabei das von seinen Zeitgenossen so geschätzte poetische Moment preiszugeben. Damit schafft er vier Kompositionen, die Schumanns Forderung an die Sinfonie exemplarisch erfüllen. Dies wird auch anhand einer Darstellung der sinfonischen Tendenzen des 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum deutlich.
Johannes Brahms’ Sinfonien entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts[1], als die Gattung bereits eine lange Geschichte hinter sich hatte und von nicht wenigen Komponisten, darunter bekanntlich führende wie Liszt und Wagner, als anachronistisch abgetan wurde. Doch Brahms gelang die Verbindung von tief in der Tradition verwurzelten Techniken mit individuellen Verfahrensweisen und Ausdruckselementen. Damit schuf er etwas Einzigartiges und durchaus Zeitgemäßes.
Die Sinfonie wurde von Brahms freilich nicht neu erfunden. Auch nach dem Tod von Mendelssohn und Schumann belebte eine rege Sinfonieproduktion die deutsch-österreichische Musikwelt des mittleren 19. Jahrhunderts. Blickt man vom Jahr 1876, dem Jahr der Uraufführung von Brahms’ 1. Sinfonie, etwa zwei Jahrzehnte zurück, findet man nicht wenige auch auf sinfonischem Gebiet tätige Komponisten. Anton Bruckner hatte seine ersten beiden Sinfonien aufgeführt (1868 und 1873), ebenso Max Bruch (Es-Dur, op. 28, 1868; f-Moll, op. 36, 1870). Joachim Raff hatte zwischen 1861 und 1876 acht seiner insgesamt elf Sinfonien vollendet, Robert Volkmann seine beiden Sinfonien 1863 (d-Moll, op. 49) und 1865 (B-Dur, op. 53) vorgelegt, Felix Draeseke seine erste von insgesamt vier Sinfonien (G-Dur, op. 12, 1872), ebenso Friedrich Gernsheim (g-Moll, op. 32, 1875). Nils Gade hatte bis 1871 seine acht Sinfonien geschaffen, von denen er die ersten beiden während seines Leipziger Aufenthalts im Gewandhaus zur Aufführung bringen konnte (c-Moll op. 5, 1842; Es-Dur op. 10, 1845). Und von Antonín Dvořák, der bis zu diesem Zeitpunkt bereits die ersten fünf seiner neun Sinfonien komponiert hatte, gelangte die dritte 1874 in Prag zur Uraufführung (Es-Dur, op. 10, 1873).
Erst im Kontext dieser Kompositionsgeschichte und der neuen sinfonischen Konzepte, die sie hervorbrachte, kann man Brahms’ Leistung als Sinfoniker erkennen. Da sich zudem viele Aspekte nur allmählich, basierend auf dem Schaffen Beethovens, aber auch beeinflusst von Schubert, Schumann und Mendelssohn entwickelten, muss für eine Einordnung der Brahms’schen Sinfonik eine größere Zeitspanne als die der zwei Dekaden vor Entstehung von dessen erster Sinfonie betrachtet werden.
Der Stellenwert von Beethovens Sinfonik im musikalischen Schrifttum des mittleren 19. Jahrhunderts
Das Werk Ludwig van Beethovens, das für Brahms stets Bezugs- und Reibungspunkt war, ist nicht für alle Musiker und Musikschriftsteller im mittleren 19. Jahrhundert gleichermaßen problembehaftet. In den Kompositionen variiert der Umgang mit Beethovens sinfonischem Erbe nicht minder stark wie die Einschätzung der sinfonischen Beethovennachfolge im musikalischen Schrifttum. Dort findet eine Problematisierung der Gattung überwiegend in allgemein reflektierenden Grundsatzartikeln statt. Ausgehend von einer Idealisierung der Beethoven’schen Sinfonie werden darin zeitgenössische Tendenzen zumeist sehr kritisch bewertet. Die Aussage eines Autors der NZfM aus dem Jahr 1842 steht exemplarisch für diese Haltung:
Können wir freilich noch immer nicht über die Quantität klagen, so hat sich doch beinahe keine einzige neuere Symphonie einen festen Platz neben den Beethoven’schen erwerben können, weder von Spohr noch von Lachner, noch von Onslow oder Kalliwoda.[2]
Beethovens Sinfonik wird für Viele zum abstrakten Maß, an dem jede neue Sinfonie scheitern muss. Dieses Dilemma bringt ein Rezensent auf den Punkt, wenn er schreibt:
Es sind aber zwey Klippen, an denen der Versuch gewöhnlich scheitert. Nähern sich diese Tondichtungen anderer Componisten den Beethoven’schen zu sehr, so verwirft man sie nur zu leicht als Nachahmungen, stehen sie jenen jedoch zu fern, so sprechen sie in der Regel nicht an. Fällt also das Schiff nicht in die Scylla, so fällt es in die Charybdis.[3]
Auch vor dem Hintergrund derartiger Äußerungen konstatiert Carl Dahlhaus in einem viel diskutierten Aufsatz[4] eine Krise der Sinfonie[5] und suggeriert damit eine künstlerische Lähmung der Komponisten bezüglich der Gattung Sinfonie. Das war aber mitnichten der Fall, im Gegenteil: Die Sinfonie erfreute sich großer Beliebtheit. Noch nie wurden so viele Sinfonien geschrieben wie im mittleren 19. Jahrhundert.
Anders als die allgemeinmusikalischen Grundsatzartikel unterstützen viele Rezensionen der nach-Beethoven’schen Zeit diese Unbefangenheit, wie sie sich im praktischen Musikschaffen zeigt. Beethovens Sinfonik ist zwar auch hier Ausgangspunkt der Argumentation, meist werden jedoch anschließend die neuen, davon abweichenden Konzepte in ein positives Licht gestellt, die Werke nicht selten sogar hoch gelobt. So wehrt sich etwa Gottfried Wilhelm Fink in seiner Besprechung von Franz Lachners Sinfonia Passionata gegen den ewigen Vergleich mit dem Werk Beethovens.
Soll Lachner, soll jeder Neue nur wie Beethoven (oder vielmehr wie diejenigen Herren, die sich für Beethoven’s Jünger halten, weil sie in seinem Weine trunken sind und, statt in der Begeisterung, nur im Rausche singen) schreiben, wenn er nicht zurückgesetzt werden soll? Vorziehen kann jeder was er will: dabei ist aber jeder gebildete verbunden, alles Tüchtige jeder Art zu achten. Weiter wird nichts verlangt; dies aber unbedingt, soll nicht die Kunst zu Grabe getragen werden.[6]
In einer Besprechung von Niels Wilhelm Gades 1. Sinfonie bemerkt der Rezensent, dessen Ansatz könne als »liebenswürdige Oberflächlichkeit« wahrgenommen werden,
nähme man Beethoven zum Muster, und verlangte man als unabänderliches und einziges Nothwendige, was in Bezug auf Anlage und Ausführung in neuester Zeit Robert Schumann und Mendelsohn-Bartholdy mit ihren Symphonien als Maßstab geboten haben.[7]
Die Namen Schumanns und Mendelssohns werden hier in einem Atemzug mit Beethoven genannt. Ihre Werke stehen für neue Konzepte, die aus der intensiven Auseinandersetzung mit dem Beethoven’schen Erbe hervorgegangen sind. Doch der Autor fordert nachdrücklich, Gades Leistung unabhängig von der Beethoven-Rezeption als eigenständigen Beitrag zur Sinfonik zu würdigen. Er lobt an dessen Musik gerade die neuen Ausdrucksformen.
Von einer Verflechtung des Einzelnen zum Ganzen, einer Deduction der Nebengedanken zum Hauptgedanken, mit einem Worte, von einer Arbeit in der Weise, wie wir sie aus unsern Meisterwerken kennen gelernt, müssen wir […] abstrahieren; finden uns aber entschädigt durch die sinnreiche Anwendung schöner und jugendfrischer Gedanken, durch neue und interessante Wendungen, durch ausdrucksvolle und originelle Instrumentation, kurz durch den reichen Erguß eines unbefangenen Dichterherzens, das seine Lieder im unaufhaltsamen Drange der Empfindung ausströmt.[8]
Neben dem Lob für die zeitgenössische Sinfonieproduktion zeigen die zitierten Passagen aber auch, dass die Sinfonik im 19. Jahrhundert selbst von denjenigen, die diese Gattung als zeitgemäße Ausdrucksform schätzen, kontrovers diskutiert wird. Mal bildet Beethoven den geistigen Bezugspunkt, an dem sich neue Werke messen und zu dem Komponisten sich verhalten müssen, mal findet sich aber auch eine trotzige Ablehnung, bis hin zur Weigerung, sich gedanklich oder kompositorisch intensiv auf Beethoven einzulassen. Es stellt sich die Frage nach dem Grund für diese gegensätzlichen Haltungen.
Veränderungen des Konzertwesens
Um diese Frage nach den gegensätzlichen Haltungen zu beantworten, muss zunächst die Veränderung des Konzertwesens berücksichtigt werden. Der allmähliche Wandel der Gattung hat zumindest zum Teil einen sehr pragmatischen Grund: Die Institutionalisierung der Sinfoniekonzerte beförderte eine zunehmend marktorientierte Kompositionsweise.
Mendelssohns Leitung der Gewandhauskonzerte gibt einen wichtigen Anstoß für diesen grundlegenden Wandel der Konzertkultur. Ihm ist die Einführung der Sinfoniekonzerte nach heutigem Muster zu verdanken. Fortan werden Werke ganz und ohne Unterbrechung gespielt und nicht, wie bis dahin üblich, nur einzelne Sätze oder die Sätze eines Werkes über den Programmablauf verteilt.[9]
Im Zuge dieser Reform etabliert sich allmählich ein Kanon repräsentativer Sinfonien. Es wird zum maßgeblichen Ziel der Komponisten, sich in einem verhältnismäßig festgezurrten Konzertablauf einen Platz zu sichern. Doch gelingt es den wenigsten, dauerhaft im Repertoire vertreten zu sein. Dies ist von den Veranstaltern und dem Konzertpublikum aber auch so gewünscht. Man erwartet von den zeitgenössischen Komponisten keine großen Ideenkunstwerke, sondern fordert vielmehr Novitäten zur kurzweiligen Unterhaltung. Da etwa ein Viertel des Konzertprogramms für die Aufführung von Novitäten reserviert ist, steigen, so Rebecca Grotjahn[10], die Chancen eines Komponisten, Werke vom Orchester aufführen zu lassen, sofern er sich den Anforderungen der Öffentlichkeit anpasst. Auf diese Weise entsteht die Sinfonie ›mittleren‹ Anspruchs.
Die Funktion der Sinfonie ist daher zweigeteilt: Einerseits kommen etablierte Werke dem Bildungsanspruch des Konzertpublikums nach, andererseits dienen die Novitäten dessen Unterhaltung. Erst vor dem Hintergrund dieser Zweiteilung können Werke wie die 1. Sinfonie Gades richtig eingeordnet werden. Sie besticht durch ihren ›nordischen Ton‹, nimmt mit ihrer atmosphärischen Ausbreitung von Klang und Melodie das Publikum sofort für sich ein. Bezeichnenderweise gelingt Gade mit keiner weiteren Sinfonie ein vergleichbarer Erfolg. Das Publikum hat sich möglicherweise vom fremdartigen Klang seines Sinfonieerstlings hinreißen lassen; ein Bonus, der beim Folgewerk bereits verflogen war.[11]
Stilwandel
Noch ein anderer Aspekt ist zu berücksichtigen: Die Veränderungen des Sonatensatzes, dem zentralen Satz der meisten Sinfonien, im Zuge seiner formalen Schematisierung.
Im Verlauf der 19. Jahrhunderts etabliert sich die Sonatenform als schematisch formulierbare Norm. Nach Ritzel[12] reagiert ein Großteil der Komponisten fortan auf das Schema und nicht auf die musikalischen Erfordernisse der individuellen Komposition. Die Dramatik, die sich eigentlich am musikalischen Gegenstand entzünden solle, sei nun im Schema vorformuliert und werde häufig nicht mehr als Folgerung aus der Musik verständlich.. Ritzel schreibt:
Das Gros der romantischen Sonaten folgt der pragmatischen Norm, die romantische Musiksprache manifestiert sich mehr im Melos und Satztechnik als in originärer Formentwicklung.[13]
Infolge dessen werde das Schema gewissermaßen von innen ausgehöhlt: Die vorformulierte Norm erhalte eine neue ästhetische (und damit zu einem gewissen Teil auch neue inhaltliche) Prägung. Die Dramaturgie eines Satzes, die bei Beethoven immer wieder andersartig aus kleinster motivischer Arbeit entstehe, werde jetzt sekundär, da sie ja bereits durch das Schema festgelegt sei. Stattdessen rücke die Gestaltung der einzelnen Formteile in den Vordergrund: Charakter, Atmosphäre, melodische Gestalt würden zu richtungsweisenden Aspekten. Die vormals dynamische, individuelle Form erstarre. Es mangele an Verästelungen und Entwicklungen im Detail, statt dessen verharre die Musik in größeren, aufeinander reagierenden Formblöcken.
Mit dem neuen, pragmatischen Zugriff auf die Gattung wird die Sinfonie anderen weniger idealistisch behafteten Gattungen gleichgestellt. Nur noch in Einzelfällen kann sie das Erhaben-Monumentale für sich beanspruchen, das noch wenige Jahrzehnte zuvor zu einem ihrer wesentlichen Merkmale zählte. Zahlreiche Komponisten adaptieren eine ursprünglich dramatische Gattung für die kontemplative und lyrisch geprägte Ästhetik ihrer Zeit.
Ein Beispiel dafür ist der Kopfsatz der bereits erwähnten 1. Sinfonie von Gade aus dem Jahr 1842. Die Themen basieren auf einem dänischen Volkslied, das in der langsamen Einleitung in voller Länge erklingt.[14]
Beispiel 1: Niels Wilhelm Gade, 1. Sinfonie, 1. Satz, a) T. 1–16, b) T. 85–99 und c) 123–127
Gade nutzt das schlichte Lied für unterschiedlichste Affekte: Während es in der Einleitung ruhig dahin fließt, erhält es im Hauptsatz dramatische, im Seitensatz dagegen verspielte Züge. Problematisch ist hier vor allem das Hauptthema, denn die Dramatik stellt sich im Thema nicht von selbst her. Deshalb umrahmt Gade es mit einem zusätzlichen Motiv, das den eigentlichen dramatischen Impuls gibt.
Beispiel 2: Niels Wilhelm Gade, 1. Sinfonie, 1. Satz, T. 49–55
Der drängende Charakter des Hauptsatzes, um den es Gade offensichtlich geht, wird mit einer Figur, die keinen Bezug zum Thema hat, künstlich erzeugt.[15] Das Thema drängt nicht selbst über sich hinaus, sondern wird als abgeschlossene Einheit mitten in ein spannungsgeladenes Umfeld gesetzt.
Diese Takte und das darauf Folgende sind typisch für Gades Kompositionsweise: Er bewegt sich harmonisch und motivisch in einem einfachen Rahmen, füllt diesen aber äußerst effektiv aus. Die Fortsetzung des Quartmotivs (wie auch das Motiv selbst) ist banal, erhält jedoch gerade dadurch eine gewisse Eindringlichkeit.[16] Harmonisch bevorzugt Gade einfachste kadenzharmonische Vorgänge. Bei verdichtenden Momenten greift er auf gängige chromatische Modelle zurück. In der Fortsetzung des dramatischen Motivs gibt es einen solchen Moment:
Beispiel 3: Niels Wilhelm Gade, 1. Sinfonie, 1. Satz, T. 65–69
Modelle dieser Art nutzen sich schnell ab, wenn sie zu einem Hauptmittel der dramatischen Verdichtung werden. Nicht nur bei Gade, sondern auch bei vielen seiner Zeitgenossen finden sich austauschbare Situationen, die von pauschal behandelten Modellen herrühren.
Auch motivisch gesehen arbeitet Gade schematisch. Das Seitenthema breitet sich 38 Takte lang ohne motivische Entwicklung aus. Abwechslung erfolgt lediglich durch eine farbliche Veränderung: Nach 18 Takten wird das Thema einen Halbton nach oben versetzt, von As- nach A-Dur, um kurz darauf wieder nach As-Dur abzusinken. Anschließend verdichtet sich der Satz mit Hilfe von Abspaltungen, so dass schließlich nur noch die punktierte Bewegung erklingt.
Beispiel 4: Niels Wilhelm Gade, 1. Sinfonie, 1. Satz, motivische Ableitungen, T. 123–167
Der gesamte Satz kommt mit einfachen handwerklichen Mitteln aus und ist leicht durchschaubar. Der schlagkräftige Einsatz des Orchesters kann einen gewissen Leerlauf jedoch überspielen. Die Sinfonie wird dadurch zur gelungenen Unterhaltungsmusik.
Andere Komponisten gehen in ihren Sinfonien zwar komplexer vor, grundsätzlich jedoch wiederholen sich viele der beschriebenen Verfahrensweisen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Einleitung aus Franz Lachners 8. und letzter Sinfonie in g-Moll aus dem Jahr 1851. Lachner greift zwar ebenfalls auf Modellhaftes zurück, versteht es jedoch, dies kunstvoll zu verkleiden und überrascht stellenweise durch Fortsetzungen, die das Gängige aufbrechen und beleben. Die ersten 8 Takte basieren auf einem chromatisch fallenden Bass mit 7-6-Folge.[17] Der Gang ist jedoch geheimnisvoll in Szene gesetzt und führt mit der realen Sequenz ab Takt 5 überraschend aus der Ausgangstonart g-Moll heraus.
Beispiel 5: Franz Lachner, 8. Sinfonie, 1. Satz, Beginn, T. 1–8
Die folgenden Takte entwickeln die Idee der Chromatik und des Sextakkordes fort und lösen sich weiter vom Modellhaften.
Beispiel 6: Franz Lachner, 8. Sinfonie, 1. Satz, T. 9–14
Der Ausschnitt hängt in der Luft. Zu Beginn erklingen nur zwei Flöten und eine Klarinette, wobei die Flöten ungewöhnlicherweise begleitend und damit tiefer als die melodieführende Klarinette gesetzt sind. Der Fauxbourdon gerät aufgrund der rhythmischen Verschiebung zwischen Melodie und Begleitung aus dem Lot, während die seufzerartigen Figuren gerade dadurch im weiteren Verlauf zu einer Linie zusammenwachsen. Auch die Harmonik ist überraschend: F-Moll schält sich als neue Zieltonart heraus, bleibt aber infolge eines Trugschlusses in der Schwebe und wird schließlich nach As-Dur umgeleitet.
Dieser Anfang verspricht großartige Musik. Tradierte Mittel werden so eingesetzt, dass die Erwartungen des Hörers permanent geweckt und gebrochen werden. Zugleich ist alles wie aus einem Guss entwickelt.
Auch in den folgenden Takten greift Lachner wieder auf Bewährtes zurück, nun jedoch ohne die individuellen Abweichungen, die den Anfang so besonders machten. Die folgende 4-taktige Phrase über einem chromatisch fallenden Bass sequenziert er zwei Mal unverändert in voller Länge. Spätestens beim zweiten Mal wird dies aufgrund des langsamen Tempos zur Geduldsprobe.
Beispiel 7: Franz Lachner, 8. Sinfonie, 1. Satz, T. 14–25
Die anschließenden Takte bleiben nach dem Trugschluss von Takt 25 auf 26 in B-Dur und gelangen schließlich zur Haupttonart g-Moll.
Beispiel 8: Franz Lachner, 8. Sinfonie, 1. Satz, T. 26–29
Anschließend führt ein chromatisch fallender Bass zu deren Dominante. Dies ist ein Moment höchster Spannung, bei dem Lachner für alle Instrumente Fortissimo verlangt (mit Ausnahme der Posaunen, die im Forte bleiben). Überraschenderweise bleibt dieser Abschnitt, die Takte 34 bis 37, ganz auf Modellhaftes reduziert. Der Höhepunkt erfolgt demnach in einer universellen Gestalt.
Beispiel 9: Franz Lachner, 8. Sinfonie, 1. Satz, T. 34–37
Die gesamte Einleitung prägt, trotz der geheimnisvollen Anfangstakte, etwas Mechanisches. Das mag an den zahlreich aufgerufenen Modellen liegen[18], aber auch an der verhältnismäßig konstanten Motivik. Lachners offener Anfang verspricht Entwicklung, Verdichtung und Steigerung, was in der Fortsetzung jedoch nicht durch entsprechende Motivarbeit unterstützt wird. Taktgruppen bleiben gleich (das 4-taktige Sequenzglied hätte beispielsweise im Verlauf der Sequenz gerafft werden können), und die Motivik selbst verändert sich nur geringfügig, und das, obwohl ihre offene Gestalt eine Fülle von Abwandlungen zuließe. Statt eines motivischen Entwicklungsprozesses breitet Lachner die immer gleichbleibende Figur der aufsteigenden Dreiklangsbrechung räumlich aus, indem er sie in immer neue modellgeprägte Situationen stellt.
Die ersten Takte der Einleitung geben ein Material vor (den Sextakkord, die Chromatik, die aufsteigende Dreiklangsfigur), dessen Entfaltung mit immer neuen Bildern und Affekten einhergeht, anstatt selbst einem Prozess unterworfen zu werden (so wie es T. 9–14 noch geschieht). Die Einleitung ist in verschiedene Etappen gegliedert, die einer vorformulierten Struktur folgen: langsamer Beginn, Steigerung und schließlich Beruhigung auf einem Dominantorgelpunkt.
Viele deutsche Sinfonien aus dem mittleren 19. Jahrhundert beginnen vielversprechend, scheitern aber bei der Fortsetzung ihrer Themen. Häufig gelingt es ihnen nicht, die inhaltliche Spannung nach dem Themenende aufrecht zu erhalten, gerade auch dann, wenn ganz offensichtlich eine Dramatisierung des Geschehens angestrebt ist. Dieses Problem wird in Friedrich Gernsheims g-Moll Sinfonie (aus dem Jahr 1875) besonders deutlich. Nicht selten veranstaltet das Orchester in Momenten, die eigentlich etwas entwickeln sollten, viel Lärm um nichts, so zu Beispiel im Kopfsatz, wenn die Streicher nach dem Hauptthema gebrochene Sextakkorde spielen und die Bläser eine 7–6-Folge ergänzen.
Beispiel 10: Friedrich Gernsheims, 1.Sinfonie, 1. Satz, T. 41–48
Dieser Ausschnitt könnte an jeder beliebigen Stelle als Fortspinnung dienen. Er steht exemplarisch für das Problem der gesamten Sinfonie: In den Tuttiabschnitten geht die Motivarbeit verloren, die Bläser schließen sich zusammen, und die Streicher ergänzen mit viel Aufwand harmonisches Füllwerk.
Robert Schumann
Vor dem oben beschriebenen Hintergrund verwundert es nicht, dass Robert Schumann in seinen Rezensionen und anderen Schriften immer wieder die Verflachung der Sinfonie anprangert. Die Inhaltslosigkeit, die er den zeitgenössischen Sinfonien unterstellt, ist tatsächlich ein Indiz für eine Krise. Allerdings sieht Schumann diese Krise bereits zu einem viel früheren Zeitpunkt – seine Aufsätze stammen bereits aus den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Bei ihm zeichnet sich eine andere Verwendung des Begriffs ›Krise‹ ab als bei Dahlhaus: Die Krise ist kein Phänomen, das ein ganzes Zeitalter erfasst, sondern ein Problem unterschiedlichen Ausmaßes der einzelnen Komponisten.
In seinen Rezensionen beobachtet Schumann äußerst aufmerksam, wie ein Komponist Altes mit Neuem verbindet. Meist stellt Schumann einen Spagat zwischen alter Technik und neuem Ausdruck fest, ein Zwiespalt, in dem beide nicht zu einer übergeordneten Idee verschmelzen konnten. Eben diese Verschmelzung gilt ihm jedoch als zentrales Qualitätsmerkmal einer gelungenen Komposition. Über ein Klavierkonzert von Carl Eduard Hartknoch schreibt Schumann:
Einesteils noch zu sehr im Kampfe mit der Form begriffen, um die Phantasie frei walten lassen zu können, andernteils zwischen alten Mustern und neuen Idealen schwankend, erfreute er sich dort an der Ruhe der Vergangenheit und der Weisheit ihrer Angehörigen, hier an der Aufregung der Zukunft und dem Mut einer kampflustigen Jugend. Daher das Unruhige, Zuckende überall; daher bricht er dort Stücken heraus; setzt sie hier wieder ein, daher spricht er dort einfach und heiter, hier wieder schwülstig und dunkel. Ein klares Selbst tritt noch nicht hervor: er steht unschlüssig auf der Schwelle zweier Zeiten.[19]
An anderer Stelle wünscht sich Schumann von seinen Zeitgenossen mehr heitere Passagen:
Wünschte ich doch, ein junger Komponist gäbe uns einmal eine leichte, lustige Symphonie, eine in Dur, ohne Posaunen und doppelte Hörner […].[20]
Der Wunsch nach leichterem Ausdruck ist aber nicht mit der Aufforderung zu verwechseln, jegliche motivisch-thematische Arbeit zu vernachlässigen. So ergänzt Schumann sofort:
Halte man uns aber wegen des eben Gesagten in Zukunft nicht etwa vor, wir wünschten keine Arbeit zu sehen; gerade die tiefsinnigste; nur nicht, daß sie um ihrer selbst etwas gelten soll, daß wir sie bei den Fäden herausziehen sollen.[21]
Schumann fordert immer wieder, dass der Einsatz einer Technik stets musikalisch begründet sein muss. Er beklagt eine bloße Zurschaustellung technischer Fertigkeiten, auf die sich viele Werke beschränkten. Ein übergeordneter Sinn, der die eingesetzten technischen Mittel rechtfertige, sei häufig nicht auszumachen.
Wie nun die Schöpfungen dieses Meisters [Beethovens] mit unserem Innersten verwachsen, […] so sollte man meinen, sie müßten auch tiefe Spuren hinterlassen haben. […] Dem ist nicht so. Anklänge finden wir wohl, […] Anklänge nur zu viele und starke; Aufrechterhaltung oder Beherrschung aber der großartigen Form, wo Schlag auf Schlag der Ideen wechselnd erscheinen und doch durch ein inneres geistiges Band verkettet, mit einigen Ausnahmen nur selten. Die neueren Symphonien verflachen sich zu größten Teil in den Ouverturenstil hinein, die ersten Sätze namentlich; die langsamen sind nur da, weil sie nicht fehlen dürfen; die Scherzos haben nur den Namen davon; die letzten Sätze wissen nicht mehr, was die vorigen enthalten.[22]
Schumanns Forderung nach neuen Gedanken verdeutlicht einmal mehr den nach Beethoven einsetzenden ästhetischen Wandel. Um den Einbruch, den er offensichtlich im sinfonischen Komponieren empfindet, zu überwinden, sucht er eine Synthese der musiksprachlichen Mittel seiner Zeit mit der Idee des Sinfonischen. Er zieht Beethoven auch als Vorreiter für die neue, ›romantische‹ Ästhetik heran. Gerade in dessen Spätwerk sieht Schumann Wegweisendes für die Entwicklung einer modernen musikalischen Sprache. Schumanns Zeitgenossen komponieren jedoch weitestgehend nach etablierten Mustern, die sie zwar bisweilen individuell ausführen, jedoch nicht im Sinne Schumanns kritisch weiterentwickeln.
Die Sinfonien von Johannes Brahms
Es ist schließlich Johannes Brahms, der mit seinen vier Sinfonien jeweils individuelle Konzepte vorlegt, die die Gattung im Sinne Schumanns erweitern. Die besondere Synthese von Poetik und Technik, die seine gesamte Musiksprache prägt, ermöglicht ihm den Drahtseilakt zwischen dramatischer Form und lyrischem Ausdruck. Brahms gewinnt die dramatische Form zurück, indem er neue variative Prozesse in Gang setzt, jedoch ohne die romantische Innerlichkeit preiszugeben.
Brahms ersetzt längere lyrische Themen durch kleinere, offene Motive. Damit scheint eine wesentliche Voraussetzung des Beethoven’schen Komponierens wieder hergestellt, bei der aus der permanenten Entwicklung kleiner Motive der Verlauf des gesamten Satzes erwächst. Der Unterschied zu Beethoven ist dennoch gravierend.
Allein die musikalische Verknüpfung dieser Motive, Brahms’ Umgang mit ihrer Substanzgemeinschaft, ist aufschlussreich. Beethoven nutzt Substanzgemeinschaft, um entgegengesetzte Affekte verschiedener Themen oder Passagen aufeinander zu beziehen. Seine Musik lebt vom Kontrast, der durch motivische Einheit gedanklich verbunden ist. Bei Brahms dient die Substanzgemeinschaft eher einer kontinuierlichen Entwicklung. Er errichtet große sinfonische Bögen, die zwar von Brüchen durchsetzt sind, das zugrundeliegende Material jedoch über die Brüche hinausgehend kontinuierlich entwickeln. Ziel ist es nicht, wie bei Beethoven, mittels des Kontrastes verschiedene Seiten eines Ganzen zu zeigen, sondern im Gegenteil, einen stetigen Prozess zu entfachen, bei dem Kontraste nivelliert oder Übergänge verschleiert werden.
1. Sinfonie, 1. Satz
Exemplarisch für diese Vorgehensweise ist die Fortsetzung des Hauptsatzes im Kopfsatz der ersten Sinfonie. Überleitung und Seitensatz gehen dort in einem fließenden Verwandlungsprozess ineinander über. Die Motive des Satzanfangs sind nur in kurzen Einwürfen erahnbar: sie leuchten in vereinzelten, an- und wieder abschwellenden Passagen auf. Alle Motive zerfallen zu Fragmenten, die wiederum ihre Gestalt verändern und sich schließlich auflösen. Hinter dem scheinbaren Verfall verbirgt sich jedoch ein Prozess der Umformung und Neufindung.
Der Sekundschritt ist das charakteristische Merkmal dieses Abschnitts, der sich ausgehend von einem der Kernmotive des Hauptsatzes entwickelt. Die Takte 103–105 bringen dieses Motiv mit einem rhythmisch geglätteten Schluss.
Beispiel 11: Johannes Brahms, 1. Sinfonie, 1. Satz, a) T. 103–105, b) Motiv des Hauptsatzes (transponiert)
Dieser Schluss wird anschließend durch einen Vorhalt leicht erweitert.
Beispiel 12: Johannes Brahms, 1. Sinfonie, 1. Satz, T. 110–113
Auch ein anderes Motiv, abgespalten vom Terzenmotiv des Hauptsatzes, erhält an seinem Schluss einen Vorhalt.
Beispiel 13: Johannes Brahms, 1. Sinfonie, 1. Satz, T. 127–130
Sämtliche dieser sukzessiven Veränderungen tragen zu einem Ausdruckswandel bei: der ausgedünnte Satz des Orchesters, das zurückhaltende Piano, die allmähliche Besinnung auf Fläche und Klang, die der Dramatik ein atmosphärisches Gegenbild setzt, und schließlich, als motivische Entsprechung dieser Elemente, auch der angefügte Vorhalt.
Diesen Vorhalt formen die Bläser anschließend zu einem neuen Motiv. Ein Tritonussprung wird nach langem Wechselspiel zwischen Oboe und Klarinette zu einem Quartsprung. In jedem Takt erklingt dabei der musikalische Seufzer in einem Instrument; der Vorhalt scheint allgegenwärtig zu sein. Kurz darauf löst sich auch dieses Motiv wieder auf und ein spannungsfreier Oktavsprung ersetzt den spannungsgeladenen Vorhalt.
Beispiel 14: Johannes Brahms, 1. Sinfonie, 1. Satz, motivische Transformation, T. 133–156
Hier ist das Ende eines Prozesses erreicht. Der Oktavsprung markiert die endgültige Auflösung, in der jede melodische und, mit den punktierten Halben, auch rhythmische Kontur verloren geht.
Die Begleitung stützt diesen Auflösungsprozess. Ab Takt 145 bilden die Streicher nur noch einen rhythmisch bewegten Klangteppich in gleichmäßig punktierten Halben. Als wesentliches melodisches Element verbleiben nur die Halbtonschritte des Basses: der stetige Wechsel zwischen Sekundakkord und Sextakkord. So wird der Sekundschritt auch zum unüberhörbaren Bestandteil der Harmonik.
Beispiel 15: Johannes Brahms, 1. Sinfonie, 1. Satz, T. 145–152
Einigen Lesern mag bei dieser Darstellung das ›Seitenthema‹ fehlen, das viele Analysen in diesem Satz stets mühelos identifizieren. Doch scheint mir eine Interpretation als durchgehende Entwicklung wesentlich passender als hier die Hinführung zu einem neuen Thema (und damit auch einem neuen Formteil) herauszulesen. Die Motivik vergeht und entsteht zur gleichen Zeit; ›Überleitung‹ und ›Seitensatz‹ verschmelzen zu einer musikalischen Sinneinheit. Die Motivik ist am Ende dieses Prozesses weit entfernt von ihrem Ursprung und dennoch in konsequenter ›entwickelnder Variation‹ aus ihm hervorgegangen.[23] Der Hörer erlebt einen Auflösungsprozess, mit Schönbergs Worten eine motivische »Liquidierung«.[24] In Folge dessen ist dieser Abschnitt nicht als motivisch eigenständiger Formteil vom Hauptsatz zu trennen. Es kann allenfalls von diametralen motivischen Entwicklungsprozessen die Rede sein: Der Steigerungsprozess des Hauptsatzes verkehrt sich in sein Gegenteil.
* * *
Die zahlreichen Brüche, die es in Brahms’ Musik gibt, sind in der Regel weder formal bestimmt noch motivisch[25], sondern in gewisser Weise von außen hinzugefügt. Brahms unterbricht oder stört einen Satz häufig in den intensivsten Momenten. Er entsagt sich einer Vollendung des Ausdrucks; das Ideal bleibt in der Ferne unerreicht. Diese Haltung wirkt sich auch großformal auf den Verlauf zahlreicher Sätze aus. In diesem Sinne ist der Kopfsatz der 2. Sinfonie exemplarisch. Dessen tiefe, nach innen gekehrte aber brüchige Lyrik ist ein ästhetisches Bekenntnis.[26]
2. Sinfonie, 1. Satz
Die Anfangsidylle wird nur wenige Takte nach Beginn des Satzes drastisch gestört. Der Paukenwirbel von Takt 32 leitet vollkommen unerwartet einen dreitaktigen Posaunenchoral ein, dessen Schlussklang von einer Wechselnote der Bläsern unterstützt wird – sie lassen das Hauptmotiv nur noch schemenhaft erahnen.
Beispiel 16: Johannes Brahms, 2. Sinfonie, 1. Satz, T. 32–39
Die harmonische und melodische Richtungslosigkeit des Ausschnitts vermittelt einen beklemmenden Ausdruck. Harmonisch kehrt der verminderte Septakkord gis-h-d-f beharrlich wieder, von beiden Seiten umrahmt vom Zentralton d, dem Grundton der zugrundeliegenden Tonart. Das d erklingt zwar in der Pauke, trägt aber nicht zur harmonischen Klärung bei. Ohne weitere akkordische Ergänzung wirkt es eher bedrohlich, und bereitet die Stimmungsgrundlage für den düsteren Posaunenchoral.
Der Stimmungsumschwung von Takt 32 ist nicht ohne Vorbereitung. Bereits mit dem ersten Themendurchlauf, dessen kadenzierender Abschluss in Takt 9 zwar melodisch erfolgt, jedoch harmonisch verhindert ist, deutet sich ein Bruch der anfänglichen Idylle an.
Beispiel 17: Johannes Brahms, 2. Sinfonie, 1. Satz, Außenstimmensatz T. 1–9
Dieser Eindruck verstärkt sich mit dem klanglich intensivierten zweiten Themendurchlauf auf der II. Stufe in e-Moll. Danach verspricht der neu hinzutretende Streicherklang eine Öffnung des intimen Anfangs zum großen Orchester hin, er verebbt jedoch sofort wieder und antizipiert das Kommende mit einem verminderten Dreiklang. Den gesamten Anfang kennzeichnet ein äußerst labiles und behutsam ausbalanciertes Verhältnis der einzelnen Instrumentengruppen, die zwar aufeinander reagieren, deren endgültige Verschmelzung jedoch nicht zustande kommt. Die Düsternis von Posaunen und Pauke bringt eine Wehmut auf, die zwar unerwartet intensiv ist, sich jedoch behutsam vorankündigt. Sie kann als musikalische Reaktion auf das Versagen, die fragile Anfangsidylle einzelner Motivteilchen in ein instrumentales und satztechnisches Ganzes zu überführen, verstanden werden. Dem Hörer bleiben nach den ersten 43 Takten des Satzes motivische und klangliche Fragmente: Erinnerungsstücke an ein Thema, das seine endgültige Gestalt nie erhalten hat. Der Expositionsbeginn gleicht in diesem Sinne einer Einleitung mit aneinandergereihten Stimmungsbildern und vorweggenommenen Motivpartikeln.
Den Eindruck eines wirklichen Beginns vermittelt erst der Themeneinsatz der Violinen ab Takt 44. Hier sind die einzelnen Motivpartikel des Anfangs zu einer Melodie zusammengesetzt, der sich erstmals auch eine Begleitung unterordnet. Dazu kommt eine stabile, im Orgelpunkt nachdrücklich gefestigte Tonika D-Dur.
Beispiel 18: Johannes Brahms, 2. Sinfonie, 1. Satz, T. 44–52
Der Abschnitt wirkt nach der Krise der vorausgehenden Takte wie ein Neubeginn. Das Orchester findet erstmals zu einem einheitlichen Klangkörper zusammen. Diese Einheitlichkeit hat jedoch nicht lange Bestand. Kaum ist das Thema formuliert, beginnt mit der Steigerung auch schon sein Zerfall. Der periodische Nachsatz der Flöte verlässt mit einer Modulation in die Oberquinte das tonale Zentrum. Eine einzelne Linie des Horns dringt kurzzeitig in den Vordergrund. Ihre chromatischen Töne erweitern bereits zu Beginn des Nachsatzes den Tonraum und brechen das enge Gefüge von Melodie und Begleitung auf. Die nachfolgenden Takte setzen den eingeschlagenen Weg fort. Es beginnt eine zunehmende Reduktion des Violinenmotivs auf seine einzelnen Strukturmomente: das Wechselnotenmotiv und der Quartsprung. Der Satz zerfällt in polyphone Einzelteile.
Beispiel 19: Johannes Brahms, 2. Sinfonie, 1. Satz, motivischer Zerfall T. 52–73
Von der viertaktigen Phrase erklingen ab Takt 52 nur noch die ersten 1½ Takte, jeweils in der rhythmischen Originalgestalt, dann mit durchlaufenden Achteln. Drei Stimmen spielen diese Abspaltung in einer satzverdichtenden Engführung. Im Anschluss daran erklingt das melodische Gerüst dieser Linie: eine Wechselnote und einen Quartsprung abwärts (Takt 59). Der motivische Ursprung des Satzanfangs ist wieder erreicht, doch er bildet nicht mehr den Anfang, sondern das Ende eines Prozesses: die Abspaltung und melodische Reduktion einer mehrtaktigen Phrase. Das Orchester teilt sich in zwei gleichberechtigte Stimmen. Als Gegenstimme zu dem Wechselnotenmotiv erklingen Dreiklangsbrechungen. Ihr motivischer Ursprung liegt ebenfalls im Satzanfang: Sie beruhen auf der Dreiklangsbrechung des Horns. Im Augenblick des motivischen Zerfalls treten erneut die Motive des Anfangs einander gegenüber. Ihr Auflösungsprozess setzt sich jedoch weiter fort. Die Wechselnote erklingt nunmehr in diminuierten Achteln. Zwei Takte später übernimmt die Oboe diese Figur im Staccato. Als letzte Reduktion bleibt schließlich nur der abgespaltene Quartsprung. Das Motiv hat sich in seine Bestandteile aufgelöst. Auch die Gegenstimme wird weiter reduziert. Es verbleiben nur ihre ersten drei Töne, jene Töne, die die Hornstimme des Anfangs intervallgetreu wiedergeben.
Die Instrumentation unterstützt diese motivische Entwicklung. Analog dem Wechsel der Satzart teilt sich das Orchester wieder in verschiedene, selbständig agierende Instrumentengruppen, und nach einem schroffen instrumentalen Bruch kehrt schließlich, in Takt 66, eine kleine Besetzung zurück. Gegenüber dem Satzanfang sind die zwei zentralen Figuren, Dreiklang und Wechselnote, jetzt in ihrer zeitlichen Abfolge und ihrer Klangfarbe deutlich voneinander getrennt. Am Ende des Abschnitts erfolgt ein Stimmtausch zwischen Bläsern und Streichern. Zum klanglichen Kontrast tritt einer der Register hinzu.
Beispiel 20: Johannes Brahms, 2. Sinfonie, 1. Satz, T. 74–77
Der einheitliche Orchesterklang von Takt 44 wird nach und nach aufgespalten, bis sich am Ende zwei unvereinbare Gestalten gegenüberstehen: Sie unterscheiden sich in Motivik, Register, Klangfarbe und sogar in ihrer Satzart.
Auch das Seitenthema findet zu keiner vollendeten melodischen Entfaltung. Der kantable Anfang verspricht eine weitläufige Melodie, die jedoch bereits nach acht Takten jäh unterbrochen wird. Ein verminderter Septakkord bremst den harmonischen Fluss, die Melodiestimmen verharren in rhythmischer und melodischer Bewegungslosigkeit.
Beispiel 21: Johannes Brahms, 2. Sinfonie, 1. Satz, T. 82–93
Die Wiederholung des Themas in den Bläsern währt nur kurz. Mehrere Anläufe in Streichern und Bläsern enden auf lang ausgehaltenen Tönen. Die gleichmäßige Viertaktigkeit wird durch Phrasenverschränkung der beiden Gruppen aufgebrochen, ein Terzfall lässt den Hörer ins harmonisch Bodenlose fallen.
Beispiel 22: Johannes Brahms, 2. Sinfonie, 1. Satz, T. 102–114
Die Fortführung des Seitensatzes vollzieht erneut ein drastischen Bruch. Die Idylle wird unvermittelt von einem schroffen Tuttiabschnitt verdrängt. Nach der kantablen Cellomelodie zu Beginn des Seitensatzes erklingt nun ein rhythmisch akzentuierter, unmelodiöser Abschnitt, der den elegischen Tonfall des Seitenthemas gewaltsam zerstört.
Beispiel 23: Johannes Brahms, 2. Sinfonie, 1. Satz, T. 188ff.
Die Idylle wird unvermittelt durch einen schroffen Tuttiabschnitt verdrängt. Es scheint, als sei die uneingeschränkte Hingabe zu gelöstem Klang und lyrischer Melodik schlicht nicht möglich.
Die Eigenart dieses Satzes veranlasste Maurice Ravel zu einer generellen Kritik an Brahms. Er sieht in dessen Musik zwei, seiner Ansicht nach nicht vereinbare, Elemente: Brahms’ intuitive Melodik gepaart mit Beethovens Verarbeitungstechnik:
The themes bespeak an intimate and gentle masculinity; […] Scarcely have they been presented than their progress becomes heavy and laborious. It seems that the composer was ceaselessly haunted by the desire to equal Beethoven. Now the charming nature of Brahms’s inspiration was incompatible with his vast, passionate, almost extravagant developments, which are the direct result of Beethovenian themes, or rather, themes which spring from Beethovenian inspiration.[27]
Ravel sieht eine tiefe Kluft zwischen der Brahms zugesprochenen liedhaften Poetik und der Struktur in Brahms’ Werk. Um sie zu erklären, unterscheidet er zwischen den Stilen zweier Komponisten bzw. Epochen. Brahms selbst steht dabei für den emotionalen, romantischen Geist, Beethoven dagegen für den rationalen, klassischen. Diese Unterscheidung erlaubt es Ravel einerseits, das poetische Moment in Brahms’ Musik bewundernd hervorzuheben, andererseits aber alle Konstruktivität als untypisch für Brahms zu verurteilen. Er unterstellt Brahms, sich ein kompositorisches Vorbild genommen zu haben, das mit dem musikalischen Gehalt seiner Themen nicht vereinbar sei. Gerade der Kopfsatz der 2. Sinfonie zeigt jedoch beispielhaft wie beide Aspekte, das Liedhafte und die motivisch-thematische Konstruktion, sich bei Brahms zu einem gelungenen Ganzen verbinden. Immer wieder wird die Sehnsucht nach einer Idylle deutlich, die Brahms, kaum erreicht, mit schmerzhaftem Abbruch wieder verlässt. Er erschafft ›wunderschöne‹ lyrische Themen, die im Moment ihres ersten Erscheinens zugleich ihren klanglichen Höhepunkt haben. Statt aber den zugrundeliegenden Affekt seiner Melodien auszuleben, unterbricht Brahms sie mit dynamischen, den Satz vorantreibenden Elementen. Der Kontrast zwischen Verweilen und Entwicklung ist keine kompositorische Schwäche, sondern die eigentliche Idee des Satzes: Die ›Beethoven’sche‹ Technik steht nicht der Idee im Wege, sondern ist ein Teilmoment ihrer Umsetzung.
* * *
Indem Brahms bewusst an tradierte Techniken und Formen anknüpft, geht er eine Verpflichtung ein: Seine Musik ist an bestimmte Kompositionsweisen gebunden; sie bleibt dadurch letztlich immer kontrolliert. Bestimmte Formen der Exzentrik und Experimentierfreudigkeit, wie sie in Werken seiner Zeitgenossen begegnen, versagt sich Brahms. Stattdessen testet er innerhalb des selbstgewählten Rahmens die Möglichkeiten aus. Dies erklärt die Art der kompositionstechnischen Neuerungen, auf denen die individuelle Ausdruckskraft seiner Musik beruht.
Dies zeigt sich nicht zuletzt in Brahms’ Umgang mit der Polyphonie. Auch scheinbar homophon verlaufende Ausschnitte enthalten neben der Hauptstimme vielfach verborgene Motive oder Motivpartikel. Brahms’ spätere, in ihrem Ausdruck häufig vereinfachte Werke verlagern polyphone Techniken auf Ebenen, wo sie für einen Hörer nicht mehr unmittelbar wahrnehmbar sind. Eine ›Begleitfigur‹ etwa, die Elemente eines zentralen Motivs enthält, ist eine subtile motivische und gleichsam polyphone Ergänzung zu der Figur, die sie ›begleitet‹. Das ›obligate Accompagnement‹ wird hier von großer Bedeutung: Auf satztechnischer Ebene wird begleitet, auf motivischer Ebene aber thematisch verarbeitet. Trotz der hierarchischen Abstufung sind die beteiligten Stimmen motivisch im Gleichgewicht.
Ein Beispiel aus dem Kopfsatz der 4. Sinfonie mag dies verdeutlichen.[28] Gegen Ende des Hauptthemas formt sich allmählich eine fallende Linie. Sie umfasst vier Töne (als einzige Ausnahme stehen am Ende der Phrase fünf absteigende Töne).
Beispiel 24: Johannes Brahms, 4. Sinfonie, 1. Satz, T. 13–19
Diese Linie – eben hier als Schlussmotiv des Hauptthemas im Vordergrund – tritt in der anschließenden Variation als Begleitelement hinzu. Es ersetzt die rhythmische Begleitfigur der Celli und Violen, die am Satzbeginn gebrochene Dreiklänge in aufsteigenden Achteln zum Hauptthema ergänzen.
Beispiel 25: Johannes Brahms, 4. Sinfonie, 1. Satz, a) Satzbeginn, b) T. 19–22
Die neue Begleitfigur setzt ein motivisches Gegengewicht zum Hauptthema: Ihre lineare Bewegung kontrastiert dessen Dreiklangsbrechung. Durch verstärkte Instrumentation verschafft sie sich motivische Gleichberechtigung: Während die Achtelfigur vom Satzbeginn noch zwischen Celli und Violen hin und her gereicht wurde – eine homogene Klangfarbe neben den führenden Violinen – tragen nun die Bläserstimmen in einer höheren Lage zur Stärkung des Melodischen bei. Die Achtelfigur umspielt nun, ab Takt 19, den Terzfall der Hauptstimme, denn jede Vier-Ton-Linie beginnt um eine Terz versetzt. Somit ist es möglich, die vermeintliche Begleitfigur als eine Variante der Hauptstimme zu betrachten. Je nach Blickwinkel ist sie demnach das Echo des Hauptthemas oder dessen Begleitung. Der Quintsextakkord, aus dem sich der Themenkopf zusammensetzt, ist der zentrale Klang innerhalb eines geisterhaften Reprisenbeginns.
Beispiel 26: Johannes Brahms, 4. Sinfonie, 1. Satz, Reprisenbeginn T. 246–252
Stark augmentiert setzt in Takt 246 die Hauptstimme ein. Sie stagniert bei ihrem vierten Melodieton. Vier Takte lang breitet sich nun ein Klang flächenhaft aus, entfaltet sich wellenförmig aus der Tiefe heraus, in auf- und wieder absteigenden Achteln. Diese Klangfläche ist mehr als nur Begleitung oder auskomponierte Klangmalerei: Sie ist eine transformierte Variante des Themenkopfes, denn auch sie basiert auf dem Quintsextakkord. Demnach erklingt der Themenkopf in zwei unterschiedlichen Fassungen: zum einen stark augmentiert, in einer Variante, die sich über mehrere Takte hin dehnt, zum anderen in Achteln diminuiert, wobei nicht mehr die exakten Intervallsprünge erklingen, sondern nur der Quintsextakkord, als klangliches Korrelat des Terz- und Sextsprunges. Dabei spielt das Orchester in zwei Gruppen mit je eigener Klangfarbe. Die Bläser übernehmen die lang ausgehaltenen Töne, die Streicher die Achtel. Mit der Individualisierung der Instrumentengruppen und ihrer Figuren intensiviert Brahms ihre Gegensätze aufs Äußerste. Essentiell an dieser Kompositionstechnik ist gerade die Verwendung des gleichen Motivs zur kontrastierenden Ergänzung oder Klanganreicherung. Brahms’ kontrapunktische Arbeit beinhaltet häufig ein Moment der Synthese: die Verschmelzung des Materials in einem Stimmennetzwerk gleichen strukturellen Ursprungs. Polyphone Mittel machen dann Poetisches erlebbar: Sie erzeugen Aspekte wie Atmosphäre, Klangfläche oder Farbe.
Es geht mir eigen mit dem Stück; je tiefer ich hineingucke, je mehr vertieft auch der Satz sich, je mehr Sterne tauchen auf in der dämmrigen Helle, die die leuchtenden Punkte erst verbirgt, je mehr einzelne Freuden habe ich, erwartete und überraschende, und um so deutlicher wird auch der durchgehende Zug, der aus der Vielheit eine Einheit macht. Man wird nicht müde, hineinzuhorchen und zu schauen auf die Fülle der über dieses Stück ausgestreuten geistreichen Züge, seltsamen Beleuchtungen, rhythmischer, harmonischer und klanglicher Natur, und Ihren feinen Meißel zu bewundern, der so wunderbar bestimmt und zart zugleich zu bilden vermag […].[29]
Das Zitat wird in der Regel herangezogen, um die strukturelle Auffassungsgabe einer Zeitgenossin zu demonstrieren. Eine andere Deutung weist aber darüber hinaus: Elisabeth von Herzogenbergs Vergleich mit dem Sternenhimmel zeichnet ein anschauliches Bild für die Unendlichkeit, die sich aus den zahlreichen Verknüpfungen ergibt. Brahms’ Musik errichtet einen Kosmos aus Querverbindungen und Assoziationen, der so umfassend ist, dass sich zuweilen im Detail das Ganze und das Ganze im Detail spiegeln. Im Fraktalen liegt das Geheimnis seiner Musik: Wenn alles mit allem zusammenhängt, wird es gleichsam unendlich.
Schluss
Brahms’ Musik ist prädestiniert, Schumanns sinfonische Visionen zu erfüllen. Schumann hat Brahms als Sinfoniker zwar nicht mehr erlebt, wohl aber den jungen Brahms, den er mit seinem Artikel »Neue Bahnen« euphorisch begrüßte.[30] Von Brahms erhofft er sich die Erfüllung seiner musikalischen Vision: die Fortführung einer historisch verwurzelten Kompositionsweise, in der sich Handwerk und Genie verbinden. Ich beschließe daher meine Ausführungen über Brahms mit einem letzten Verweis auf Schumanns und sein musikalisches Erbe.
Einige Musikschriftsteller sahen in Schumann eine ›dritte Partei‹. Von besonderer Bedeutung ist dabei Adolf Schubrings fünfte Schumanniana, in der erstmals der vielzitierte Begriff der ›Schumann-Schule‹ fällt:
Um die gegenwärtig das musikalische Deutschland beherrschenden Schulen kurz zu kennzeichnen, so legt die eine das überwiegende Gewicht auf die (alte) Form, die andere auf den (neuen) Inhalt, die dritte, in der Mitte stehende aber gleiches Gewicht auf Form und Inhalt. Sind die Componisten dieser Schule im Wesentlichen beflissen, neuen Inhalt in die altbewährten Formen zu giessen, so schliesst dies selbstverständlich nicht aus, dass der Inhalt, da wo er in der That neu ist, diese Formen erweitert, durchbricht, überspringt. Es sei mir gestattet, diese Schule kurzweg die Schumann’sche zu nennen […].[31]
Im Vergleich zu den anderen Schulen wirkt die Schumann’sche – ihre Synthese zwischen Altem und Neuem – für Schubring als die erstrebenswerte. Selmar Bagge, der zwischen 1860 und 1862 die Deutsche Musik-Zeitung herausgab, verwendet zwar andere Begriffe, teilt aber die deutsche Musiklandschaft im Grunde ähnlich ein. Er schreibt von den »Progressisten«, den »Reactionären« und den »Liberalen«, zu denen er auch Schumann und Brahms zählt. Es war demnach durchaus üblich, in Schumann den Vertreter eines eigenen Entwicklungsstrangs zu sehen. Nachdem Schumanns Aufsatz über Brahms erschien, wurde dieser wie selbstverständlich in den Schumann’schen Bannkreis gezogen. In der Tat sind die kompositorischen Haltungen beider Künstler durch einen Aspekt miteinander verbunden. Schumann bemerkt in seinen Schriften, die Aufgabe der zeitgenössischen Komponisten sei es,
an die alte Zeit und ihre Werke mit allem Nachdruck zu erinnern, darauf aufmerksam zu machen, wie nur an so reinem Quelle neue Kunstschönheiten gekräftigt werden können, – sodann, die letzte Vergangenheit, die nur auf Steigerung äußerlicher Virtuosität ausging, als eine unkünstlerische zu bekämpfen, – endlich eine neue poetische Zeit vorzubereiten, beschleunigen zu helfen.[32]
In diesem Sinne gibt es durchaus eine ideelle Verbindung zwischen Schumann und Brahms. Musikalisch entfernt sich Brahms jedoch von Schumann. Aspekte wie das fein verästelte obligate Accompagnement, die Verbindung von Microstruktur und groß angelegter Fläche oder das alles durchdringende Variationsprinzip sind etwas ganz Brahmsspezifisches. Die Bezeichnung »Schumann-Schule« ist dahingehend irreführend, dass Brahms zwar im Sinne Schumanns wirkte, dabei jedoch neue, auch von Schumann selbst unbegangene Wege beschritt.
Brahms’ vier Sinfonien sind ein Beitrag zur Befreiung der Sinfonie aus ihren erstarrten Mustern. Es wäre jedoch verfehlt, sie als Meilensteine zu betrachten, mit denen er die Gattung von Grund auf reformiert hätte. Sie boten nachfolgenden Komponisten kein imitierbares Konzept, sie blieben vielmehr genuine, an die Person gebundene Lösungen, deren gelungene Verbindung von motivischem Detail, Großform und Klang in der persönlichen Handschrift begründet ist.
Anmerkungen
Die 1. Sinfonie wird nach einem jahrelangen Entstehungsprozess (die Arbeit ist seit 1862 dokumentiert, reicht aber wahrscheinlich weiter zurück) erst 1876 uraufgeführt. | |
Hirschbach 1842, 118. | |
»Seconde Sinfonie à grand Orchestre composée par J.W. Kalliwoda […]« (1829, 721). | |
Dahlhaus 2008, 259f. | |
Die Krise bezieht sich nach Dahlhaus 2008 auf den Zeitraum 1850 bis 1870. Über diese Eckdaten ist viel diskutiert worden, denn im Grunde kann auch die Zeit vor dem Erscheinen der Sinfonien Schumanns und Mendelssohns als krisenhaft bezeichnet werden. Bekanntlich haderte Schumann bereits stark mit der Gattung und bekam entscheidende Impulse zu seiner 1. Sinfonie erst, nachdem er im Jahr 1839 Schuberts C-Dur Sinfonie in dessen Nachlass gefunden hatte. Dies spricht dagegen, Schumann und Mendelssohn zusammen mit Beethoven unter das »erste Zeitalter« der Sinfonie zu subsumieren. | |
Fink 1837, 220. | |
Becker 1845, 17. | |
Ebd., 18. | |
In einem Beitrag der AmZ (»Musik in Leipzig. […] Instrumentalmusik. Symphonieen« 1820, 41) heißt es: »In jedem Conzert ohne Ausnahme, wird gegen jetzige Art – oder vielmehr gegen jetzige Unart – eine grosse Symphonie ganz und ungetrennt gegeben; wofür dem Directorium nicht nur der Kenner, sondern auch die gemischte Menge Dank sagt.« | |
Die folgende Textpassage rekurriert auf Gedanken aus Grotjahn 1998. | |
Auch wenn sich das Werk über mehrere Spielzeiten im Konzertrepertoire hält, was es von den eigentlichen Novitäten, auf die Grotjahn 1998 anspielt, unterscheidet, ist es ein geeignetes Beispiel für die Sinfonie ›mittleren‹ Anspruchs, denn es entsprach offenbar für einen gewissen Zeitraum genau den Bedürfnissen der Öffentlichkeit nach Neuheit, ehe es wieder aus dem Konzertrepertoire verschwand. | |
Die folgende Textpassage rekurriert auf Gedanken aus Ritzel 1968. | |
Ebd., 225. | |
Die Einleitung selbst ist recht einfach gestrickt: Sie bringt die vollständige Melodie des späteren Hauptthemas, wonach sie allmählich verebbt. Auch hier steht die Melodie im Vordergrund. Hinzu treten atmosphärische und klangliche Aspekte. Dabei kommt es gerade auf die simple Machart des Satzes an, zum Beispiel auf den behutsam eingeführten, warmen Streicherklang, oder die sparsam verwendeten Bläsersätzen, die eben nicht ›colla parte‹ mit den Streichern gehen, sondern klanglich hervorleuchten dürfen. Auch der volksliedhafte Rückzug auf Terz- und Sextparallelen und das wiegende Gleichmaß des 6/4-Taktes sind hier zu nennen. | |
Die Punktierung stellt zwar eine Verbindung zum Thema her, sie hat jedoch eine allgemeinere Funktion: Sie ist der zugrundeliegende rhythmische Puls, auf den der Satz immer wieder zurück kommt. Dagegen hebt sich der Quartsprung als ein offensichtlich neues Element vollkommen vom Thema ab. Er gibt den Impuls zu einer geradlinigen Bewegung, die das liedhafte Kreisen des Themas kontrastierend umrahmt. | |
Allerdings ergänzt Gade noch ein metrisches Spiel. Der Quartsprung, der auf Grund des Akzents auf dem c immer auftaktig klingt, ist zunächst volltaktig notiert. Dadurch wirkt der dritte Takt gestaucht: Das c bleibt nicht als eine übergebundene Halbenote liegen, wie es im Fall eines echten Quartauftaktes eigentlich geschehen müsste, und die aufsteigende Linie setzt eine Viertel eher ein als erwartet. | |
Das Modell bekommt durch den 5. Takt eine besondere Prägung: Auf Grund der realen Sequenz erklingt ein Des-Dur Sextakkord an Stelle des zu erwartenden d-Moll Sextakkordes. | |
Die Sequenz ab Takt 14 verläuft ohne jegliche Veränderungen. Außerdem sind der chromatische Bassgang in Takt 34 und der anschließende Orgelpunkt gängige Gestaltungsmittel. | |
Schumann 1836, 93. | |
Schumann 1839, 2. | |
Ebd. | |
Schumann 1839, 1. | |
Brahms’ Motivarbeit wird in der Forschung häufig unter Verwendung von Arnold Schönbergs Begriff der ›entwickelnden Variation‹ beschrieben. Schönberg verwendet den Begriff über seine gesamten Schriften verteilt in unterschiedlichen Zusammenhängen, ohne ihn empirisch zu begründen (eine Übersicht aller Textstellen, in denen Schönberg den Begriff verwendet, findet sich bei Frisch 1984, 1ff.). Ein expliziter Zusammenhang findet sich in Schönberg 1976, 126: »Anpassungen an die volkstümlichen Forderungen wurden noch unumgänglicher, als Wagners Evolution der Harmonie sich zu einer Revolution der Form ausweitete. Während vorausgegangene Komponisten und selbst sein Zeitgenosse, Johannes Brahms, Phrasen, Motive und andere strukturelle Bestandteile von Themen nur in variierter Form wiederholten, wenn möglich in der Form dessen, was ich entwickelnde Variation nenne, mußte Wagner, damit seine Themen erinnerbar wurden, Sequenzen und Halbsequenzen verwenden, das heißt, unveränderte oder leicht variierte Wiederholungen, die sich in nichts wesentlichem vom ersten Auftreten unterscheiden, außer daß sie exakt auf andere Stufen transponiert sind.« | |
Vgl. Schönberg 1975, 288. | |
Sie entsprechen also nicht dem klassischen Kontrast-Prinzip, bei dem durch Veränderung sämtlicher Parameter auch innerhalb kleinerer Takteinheiten starke Brüche entstehen. | |
Vgl. Brinkmann 1990. | |
Musgrave 1999, 266f. | |
Aus Platzgründen konzentriere ich mich hier auf die Exposition. In der Durchführung schwankt die Zuordnung des Motivs zwischen Hauptsache und Begleitung noch weit mehr als hier. | |
Brief vom 8.9.1885 (Kalbeck 1907, 86). | |
Das Versprechen einer großartigen Sinfonie, das Schumann dort unglücklicherweise für Brahms abgibt, führt bekanntlich zu großem Argwohn seiner Zeitgenossen und steigert bereits frühzeitig deren Erwartungen, besonders bezogen auf die Sinfonik. | |
Schubring 1861, 53. | |
Schumann 1854, 60. In Schumann 1835, 3 lautet die Passage: »[…] die alte Zeit und ihre Werke anzuerkennen, darauf aufmerksam zu machen, wie nur an so reinem Quelle neue Kunstschönheiten gekräftigt werden können – sodann, die letzte Vergangenheit als eine unkünstlerische zu bekämpfen, für die nur das Hochgesteigerte des Mechanischen einigen Ersatz gewährt habe – endlich eine junge, dichterische Zukunft vorzubereiten, beschleunigen zu helfen.« |
Literatur
Becker, Julius (1845), »Nils W. Gade, Symphonie für das große Orchester Op. 5 […]«, NZfM 22, 17–19.
Brinkmann, Reinhold (1990), Johannes Brahms. Die zweite Symphonie. Späte Idylle (= Musik-Konzepte 70), München: edition text + kritik.
Dahlhaus, Carl (2008), »Das zweite Zeitalter der Symphonie«, in: ders., 19. Jahrhundert II (= Gesammelte Schriften 5), hg. von Hermann Danuser, Laaber: Laaber, 259–70.
Danuser, Hermann (1997), Art. »Musikalische Prosa«, in: Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. Aufl. hg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd. 6, Kassel: Bärenreiter, 858–866.
Fink, Gottfried Wilhelm (1837), »Preis-Symphonie von Franz Lachner«, AmZ 39, 217–22.
Frisch, Walter (1984), Brahms and the Principle of Developing Variation (= California Studies in 19. Century Music 2), Berkeley u.a.: Univ. of California Press.
Gülke, Peter (1984), »Sagen und Schweigen bei Brahms«, in: Brahms-Analysen. Referate d. Kieler Tagung 1983, hg. von Friedhelm Krummacher und Wolfram Steinbeck, 12–32.
Grotjahn, Rebecca (1998), Die Sinfonie im deutschen Kulturgebiet 1850 bis 1875. Ein Beitrag zur Gattungs- und Institutionengeschichte, Sinzig: Studiopunkt (= Musik und Musikanschauung im 19. Jahrhundert 7).
Hirschbach, Hermann (1842), Die Instrumental-Compositionen der letzten zehn Jahre, NZfM 30, 117–19.
Hofmann, Kurt (Hg.) (1971), Erinnerungen an Johannes Brahms. Tagebuchnotizen aus d. Jahren 1875–1897 / Richard Heuberger, Tutzing: Schneider.
Kalbeck, Max (Hg.) (1907), Johannes Brahms im Briefwechsel mit Heinrich und Elisabet von Herzogenberg, 2. Bd., Berlin: Verlag der Deutschen Brahms-Gesellschaft.
Musgrave, Michael (1999), A Brahms Reader, New Haven u.a.: Yale Univ. Press.
»Musik in Leipzig. […] Instrumentalmusik. Symphonieen« (1820), AmZ 22, 41–49.
Ritzel, Fred (1968), Die Entwicklung der Sonatenform im musiktheoretischen Schrifttum des 18. und 19. Jahrhunderts (= Neue musikgeschichtliche Forschungen 1), Wiesbaden: Breitkopf & Härtel.
Schönberg, Arnold (1975) »Connection of Musical Ideals«, in: Style and Idea, hg. von Leonard Stein, New York: St. Martins Press, 287–88.
––– (1976), »Kriterien für die Bewertung von Musik«, in: Stil und Gedanke (= Gesammelte Schriften 1), hg von Ivan Vojtěch, 123–33.
Schubring, Adolf (1861), »Schumanniana 5. Die Schumann’sche Schule«, NZfM 55, 53–55.
Schumann, Robert (1835), »Zur Eröffnung des Jahrganges 1835«, NZfM 2, 2–4.
––– (1836), »Pianoforte. Concerte«, NZfM 22, 92–93.
––– (1839), »Neue Symphonieen für Orchester«, NZfM 11, 1–3.
––– (1854), »Zur Eröffnung des Jahrganges 1835«, in: Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, Bd. 1, Leipzig: Georg Wigand, 59–63.
»Seconde Sinfonie à grand Orchestre composée par J.W. Kalliwoda […]« (1829), AmZ 31, 721–22.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.