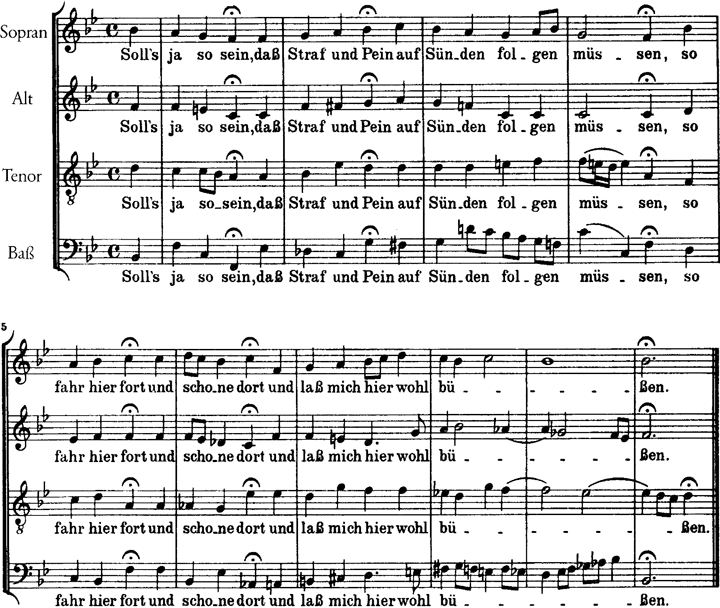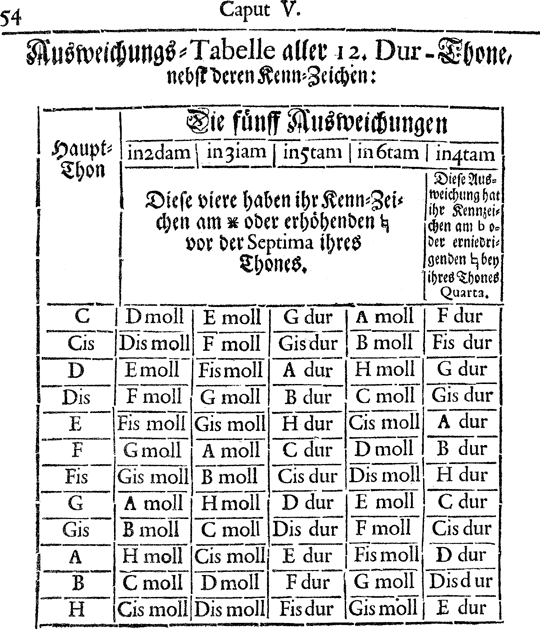Werkbetrachtung und Analyse im Musikunterricht[1]
Johannes M. Walter
Werkbetrachtung und Analyse im Musikunterricht werden von Schülerinnen und Schülern oft als unattraktiv empfunden, wenn nicht gar gefürchtet; Lehrerinnen und Lehrern geht es möglicherweise ähnlich.[2] Gründe, die zur Unbeliebtheit dieser Disziplin im Schulalltag beitragen, sind insbesondere zu sehen (1.) in dem der Materie innewohnenden hohen Abstraktionsgrad, (2.) in einer Problematik, die daraus resultiert, dass sich im Verlauf der Musikgeschichte Normen und Regeln verändern, weshalb bei der Analyse nicht nach ›Schema F‹ vorgegangen werden kann, und (3.) in der oft extrem hohen Komplexität insbesondere der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Im Beitrag werden anhand ausgewählter Kompositionen unterrichtliche Umgangsweisen aufgezeigt, die den genannten Schwierigkeiten entgegenwirken können. Ziel ist es, (1.) den Abstraktionsgrad zu mindern, indem zum einen Nähe zum Gegenstand geschaffen und zum anderen die Bedeutung der Werkanalyse erkannt wird, (2.) Schülern und Lehrern deutlich zu machen, wie förderlich der Einbezug der historischen Perspektive sein kann, und (3.) aufzuzeigen, dass gerade die Beschäftigung mit Neuer Musik äußerst bereichernd und attraktiv sein kann. Verwirklichen lässt sich dies am ehesten in einem Unterricht, in dem sich Schüler und Musik auf Augenhöhe begegnen: auf der einen Seite das Kunstwerk, mit dem eine ernsthafte Auseinandersetzung stattfindet, auf der anderen Seite die Schüler, die im Rahmen dieser Auseinandersetzung gewinnbringende und bildende Erfahrungen machen. Abschließend werden Regeln formuliert, die im Musikunterricht bei der Betrachtung von Werken und bei deren Analyse berücksichtigt werden sollten.
1. Vorbemerkung: Bildender Musikunterricht[3]
»Du behandelst das Leben nicht als Gestalt, sondern als bloße Addition[!]«[4] Diesen Vorwurf muss sich Max Frischs Homo faber von Hanna zurecht gefallen lassen, da ihn sein technologisches Weltverständnis dem Dasein gegenüber blind macht. Und darum ist der Unesco-Ingenieur Walter Faber auch kein gebildeter Mensch, denn Bildung schiebt sich nicht trennend zwischen den Menschen und die Wirklichkeit. Im Gegenteil: Sie verleiht dem Menschen ein tief gegründetes Fundament, das ihn in der Welt verankert und mit ihr verbindet. Fatalerweise geht genau dieses Fundament dem Menschen verloren durch leeres Faktenwissen, das sich – so der Physiker, Mathematiker und Pädagoge Martin Wagenschein – »vom Phänomen abgeschnürt hat, und es oft genug sogar verdunkelt, statt es zu erhellen«.[5] Dem stellt Wagenschein sein Ideal einer wahrhaft bildenden Schule mit einer am Menschen und an der Sache orientierten Didaktik gegenüber, das zu unserem Schulsystem mit seinen häufig überfüllten Lehrplänen, mit unkonzentrierten und überforderten, teilweise aggressiven Schülern, zahlreichen lustlosen und resignierten Lehrern, eine geeignete Alternative bietet.
Freilich muss der Unterricht den Schüler dazu ganzheitlich ansprechen. So wenig wie etwa die Wellenlänge die Farbe oder die Luftdruckkurve die Musik in sich begreift, kann das Fach Physik mit der Natur gleichgesetzt werden; es bietet lediglich Erklärungsmodelle an. Im Mathematikunterricht kann das Ziel nicht darin bestehen, Formeln zu kennen und sie anzuwenden. Ebenso wenig kann es im Musikunterricht ausreichen, sich auf musiktheoretische Fakten zu beschränken – als (Auch-)Musiktheoretiker darf ich das sagen, ohne missverstanden zu werden. Als Bildenden Musikunterricht begreife ich daher
Unterricht, in dessen Mittelpunkt der Schüler steht,
Unterricht, in dem sowohl rationales Verstehen als auch emotionales Erleben von Musik breiten Raum einnehmen,
Unterricht, in dem anhand einer musikalischen Erscheinung, eines musikimmanenten Phänomens oder eines Musikwerks Fundamentales und Exemplarisches aufgezeigt oder – noch besser – von den Schülern selbst entdeckt, erarbeitet, durchschaut wird[6],
Unterricht, der sich intensiv mit dem Gegenstand auseinandersetzt, also auf Gründlichkeit, Verstehen und Erkenntnis ausgerichtet ist, und dessen höchstes Ziel eine abstandnehmende, wissenschaftstheoretische und philosophische Betrachtung ist, die über fachwissenschaftliche Information hinausgeht und über das Fach hinausweist.[7]
Im Folgenden möchte ich es mir schwer machen und meine Vorstellungen von einem bildenden Musikunterricht anhand eines Themenkomplexes skizzieren (und gewissermaßen an ihm messen), der häufig nicht nur als diffizil, sondern sogar als schülerfeindlich bezeichnet wird: Werkbetrachtung und Analyse.
2. Musikunterricht und Analyse
2.1 Zur Legitimation
Um es vorweg zu sagen: Ich halte Musikalische Analyse für eine zentrale Disziplin – auch und gerade in der Schule. Sie stellt ein der Musik und dem Menschen angemessenes Werkzeug (neben anderen) dar. Dies sage ich nicht, weil ich das Fach Musiktheorie studiert und unterrichtet habe, sondern weil ich an mir selbst, aber auch im Umgang mit Schülern immer wieder erfahre, welche faszinierende Erkenntnisse und welchen Gewinn diese Art von Beschäftigung mit der Musik dem Menschen bringen kann, obgleich es sich hier um eine Umgangsweise mit Musik handelt, die in der Regel zunächst noch außerhalb des Bewusstseinshorizontes der Schüler liegt – anders als gebräuchlichere, ihnen vertraute Umgangsweisen wie Hören, Singen, Spielen, etwas (Aus-)Probieren, sich zu Musik Bewegen usw. Mit Hilfe der Analyse kommt man einem gewichtigen bildenden Ziel des Musikunterrichts näher: dem Nachdenken über und dem Verstehen von Musik. Entscheidend ist hierbei, dass die Schüler selbst die Erfahrung machen, dass Analyse eine lohnenswerte, weil enorm bereichernde Tätigkeit ist. Entsprechend hat der Musikunterricht Anregungen und Hilfsmittel an die Hand zu geben und einen analytischen Umgang mit Musik im besten Sinne einzuüben.
Nun gehört aber musikalische Analyse zu den eher unbeliebten Disziplinen im Musikunterricht – und die Frage nach dem Warum führt direkt zu Problemfeldern und möglichen Gefahren, die hier drohen.
2.2 Problemfelder[8]
2.2.1 Hoher Abstraktionsgrad / Gefahr der ›Kopflastigkeit‹
Analysieren stellt in der Schule häufig eine trockene, weil abstrakte und somit für die Schüler eher uninteressante Tätigkeit dar. Oft verstehen sie den Sinn ihres Tuns nicht, vor allem dann, wenn der Bezug zur Musik verloren zu gehen droht. Um der Abstraktionsgefahr vorzubeugen, halte ich es für ein Hauptgebot, dass Analyse im Musikunterricht im Regelfall von klingender Musik auszugehen hat – also etwa vom Höreindruck, von den durch die Musik hervorgerufenen Emotionen und Assoziationen, ihrem Charakter, insbesondere von interessanten, ungewöhnlichen, durchaus auch von zunächst noch unverständlich erscheinenden Phänomenen.
Im Unterricht verschärft sich die Situation häufig noch: Oft gibt der Lehrer sich beispielsweise bei einer harmonischen Analyse damit zufrieden, dass die richtigen ›Funktionsbezeichnungen‹ an der richtigen Stelle stehen. Er merkt in diesem Fall womöglich gar nicht, dass häufig überhaupt nicht(s) verstanden, sondern nur mechanisch ›gerechnet‹ wurde, und ist zufrieden: Das Ergebnis stimmt schließlich. Und auch der Schüler wird sich kaum beschweren: Immerhin erhält er so eine gute Note. Doch nicht nur unverstandene, schablonenhaft durchgeführte Analyse, auch routiniertes Analysieren auf hohem Niveau, das rein technisch ausgeführt wird, ist definitiv unzureichend. Musikalische Analyse legitimiert sich erst dadurch, dass mit ihr ein Erkenntnisgewinn einhergeht, der den usuellen Umgang mit Musik um eine weitere Dimension bereichert. Analyse im Musikunterricht muss fundamentale Einblicke in die der Musik wesenseigene Sprache ermöglichen und somit ein tieferes Verstehen von Musik evozieren.
Im Schulalltag muss daher vor allem verhindert werden, dass Schüler beim Analysieren von Musik einzelne Kategorien der Analyse (wie Rhythmik, Melodik, Harmonik, Form usw.) lediglich abarbeiten. Dies zeitigt ohnehin oft unbefriedigende, zum Teil sogar irrelevante Ergebnisse. Häufig wird hierbei Selbstverständliches oder Unnötiges aufgebauscht oder der Notentext lediglich in einer ›anderen Sprache‹ dupliziert. Wesentliche Aspekte geraten dagegen leicht aus dem Blickfeld. Die Kunst besteht also darin, herauszufinden, was überhaupt analysierenswert ist. Hierzu gehört bereits die Auswahl derjenigen Kategorien, deren Analyse gewinnbringende Erkenntnisse verspricht, die über eine bloße Auflistung hinausweisen und Einsicht in das Werk, seine Konstruktion und seine besonderen Qualitäten erlauben.
Der Lehrer ist dafür verantwortlich, dass diese Kunst bereits bei der Unterrichtsplanung zum Tragen kommt. Er muss sich fragen: Was lasse ich überhaupt ausführlich analysieren – und warum? Solche Überlegungen sollten jedoch auch im Unterricht thematisiert werden, damit die Schüler hierfür selbst ein Gespür entwickeln können; sie müssen lernen, die der Sache angemessene Brille aufzusetzen.
2.2.2 Die Problematik der historischen Perspektive(n)
Ein weiteres Problem im Umgang mit musikalischer Analyse besteht bekanntlich darin, dass in verschiedenen Epochen unterschiedliche musiktheoretische Kriterien Gültigkeit besitzen. Da in der Kunst der unkonventionelle Umgang mit bestehenden Normen oder die Abkehr von diesen interessant und kennzeichnend für Entwicklungen und Fortschritte sind, muss bei der Analyse ein historischer Vergleichsmaßstab angelegt werden. Dies setzt entsprechendes Wissen über die jeweilige Zeit und ihren Musikstil voraus. Der Schüler sollte beispielsweise erfahren, dass eine heute konventionell erscheinende harmonische Wendung im Barockzeitalter möglicherweise als skandalös empfunden wurde. Analysen, die diese geschichtliche Dimension nicht berücksichtigen, gehen oftmals am Kern der Sache vorbei, ohne dass sie ›sichtbare‹ Fehler enthalten müssten. Eine didaktisch reduzierte ›Schmalspurtheorie‹, wie sie häufig auf den Zeitraum vom Mittelalter bis zur Gegenwart, auf die Motette der Ars Antiqua wie auf Popmusik angewendet wird, stößt zwangsläufig immer, und das sehr schnell, an ihre Grenzen – und hinterlässt unbefriedigte Schüler und Lehrer, da die wichtigsten und entscheidenden Dinge, die in der Regel auch die interessantesten sind, meist durch ihr weitmaschiges Netz fallen.
Die Problematik der historischen Perspektive(n) muss dem Lehrer nicht nur bewusst sein, sondern auch anhand ausgewählter, geeigneter Beispiele im Unterricht thematisiert werden. Dies scheint auf den ersten Blick vielleicht zu kompliziert, vereinfacht in der Regel den Sachverhalt jedoch ungemein. In diesem Kontext erfahren die Schüler, dass in der Kunst Entwicklungen stattfinden, Regeln sich ändern, ablösen, dass Geschmack sich wandelt – bildende Aspekte, die einen fächerübergreifenden Unterricht geradezu provozieren. Neben der angemessenen Brille benötigt man also auch eine historische Brille; am besten wäre ein ›Gleitsichtmodell‹, das verschiedene ›Glassorten‹ in sich vereinigt.
2.2.3 Neue Musik[9] und der Umgang mit ihr
Die Betrachtung Neuer Musik bereitet im Schulalltag häufig besondere Schwierigkeiten. Hier brechen Komponisten in höherem Maße mit der Tradition als zu früheren Zeiten. Dies hat zur Folge, dass die geläufigen analytischen Kategorien, die sich der Schüler vielleicht bereits erarbeitet hat, oft überhaupt nicht mehr greifen. Die bereits zur Verfügung stehenden Brillen müssen bei Bedarf also auch wieder abgenommen werden können. Gerade dadurch aber wird es möglich, sich der Musik offen und vorurteilsfrei zu nähern und zu versuchen, ohne einengende Modelle und Schablonen erkennbare Strukturen, etwa den zeitlichen Verlauf, das Material, seine Verarbeitung usw. mit eigenen Worten zu beschreiben.[10] Im Schulalltag wird gleichwohl häufig ein Bogen um diese Musik gemacht. Oft resultiert dies daraus, dass Lehrer im Rahmen ihres Studiums mit dem Gegenstand nicht ausreichend in Berührung gekommen sind bzw. die Inhalte nur pflichtgemäß und somit möglicherweise lustlos abgearbeitet haben – sicher auch, weil gerade dieser Bereich die Gefahr in sich birgt, selbst an Hochschulen überwiegend kognitiv vermittelt zu werden, was oft Distanz statt Nähe schafft und Begegnung erschwert.
Ich möchte nun die drei genannten Problemfelder (den hohen Abstraktionsgrad / die historische Perspektive / die ›Crux mit der Neuen Musik‹) nochmals beleuchten, und zwar unter dem Gesichtspunkt, wie im Schulalltag mit ihnen umgegangen werden könnte.
2.3 Mögliche Umgangsweisen im Musikunterricht
2.3.1. Zum Thema ›Hoher Abstraktionsgrad‹
2.3.1.1 Nähe schaffen[11]
Schülerinnen und Schüler einer elften Klasse hören den Anfang von Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 6 in a-Moll, der sogenannten Tragischen. Ihre Aufgabe besteht darin, erste Höreindrücke zu notieren. Hier folgt eine Auswahl der Nennungen, nachträglich und gemeinsam mit den Schülern geordnet nach Aussagen, die Emotionen, Assoziationen und die Struktur des Musikstücks betreffen – was nicht immer ganz trennscharf möglich ist.
Spektrum Emotion: gruselig – gefährlich – Furcht – aufregend – bedrohlich – dramatisch – unheimlich – majestätisch – Erleichterung – neue Lebenslust – verträumt
Spektrum Assoziation: Schiff – Sturm – Armee – Star Wars – Krieg – Soldaten marschieren – historischer Film mit Rittern – Hetzjagd – Ein einsamer Mensch – Flucht
Spektrum Struktur: laut, dann leise – am Anfang schnell – Schlagzeug – Marsch – punktierte Noten – Moll - abstürzende Linien – schiefe Klänge – plötzlich ein neuer Teil – Anfang wird wiederholt
Es entwickelt sich nun ein Gespräch darüber, dass die emotionalen und assoziativen Äußerungen zu Musik sehr individuell und subjektiv sein können, die Aussagen zur Struktur der Musik sich hingegen objektiv überprüfen lassen. Ein geeignetes Mittel, sich mit der objektiven Ebene auseinanderzusetzen, ist die musikalische Analyse. Deren Ergebnisse können und sollen auf die emotionalen Eindrücke und assoziativen Bilder bezogen werden; so kann etwa die Frage beantwortet werden, mit welchen musikalischen Mitteln der Komponist diese oder jene (emotionale) Wirkung erreicht oder womit es ihm gelingt, beim Hörer eine bestimmte Assoziation hervorzurufen.
Ferner kann vielen der angedeuteten Schwierigkeiten vorgebeugt werden, wenn die erforderlichen analytischen Verfahrensweisen, d.h. Systeme, Modelle und Schemata im Unterricht grundsätzlich von den Schülern selbst entdeckt bzw. erarbeitet werden, anstatt dass sie vom Lehrer den Schülern (und auch der Musik) quasi übergestülpt werden. Im Unterricht habe ich oft die Schüler die infrage kommenden analytischen Kategorien selbst entwickeln lassen, indem sie von ihren eigenen Aussagen zum Bereich Struktur ausgingen, diese nach inhaltlichen Kriterien sortierten und die entstandenen Gruppen mit geeigneten Oberbegriffen versahen. In der Regel kamen sie zu dem erwarteten Ergebnis (Rhythmik, differenziert nach Tempo/Taktart/Rhythmus, Melodik, Harmonik usw.). Fehlende Fachtermini ließen sich abschließend leicht ergänzen.
2.3.1.2 Analysierenswertes aufzeigen – Robert Schumann, »Sitz ich allein« op. 25,5 (Text: Johann Wolfgang von Goethe, Schenkenbuch im Divan)[12]
Beispiel 1: Robert Schumann, »Sitz ich allein« op. 25,5
In Goethes Gedicht verlässt das Lyrische Ich einen gewohnten Raum oder Ort oder – noch treffender – einen Alltagszustand: Es zieht sich zurück an einen für ihn idealen Ort: »Sitz’ ich allein, wo kann ich besser sein?« An diesem Platz und in diesem Zustand, weg von den anderen Menschen und fernab der Alltagswelt findet es Raum und Freiheit, seinen eigenen Gedanken nachzuhängen; frei von Zwängen, Pflichten, bürgerlichen und spießbürgerlichen Konventionen.
Bei der Vertonung des Textes verwendet Schumann eindrucksvolle musikalische Mittel zur Darstellung dieses Frei-Raums (T. 10): Wechsel der Taktart, schlagartige Veränderung der melodischen, der harmonischen und der rhythmischen Struktur, vor allem aber ein unerwarteter Tonartwechsel. Nachdem im sechsten Takt die Quinttonart von EDur, also HDur erreicht ist, wird beim Übergang von Takt 9 auf 10 plötzlich und unerwartet die Tonart CDur ergriffen. So wird der gewonnene Frei-Raum mit seinen jetzt näher beschriebenen Vorzügen (»Niemand setzt mir Schranken«) in ein eigenes Licht gerückt. Der immensen Distanz zwischen der Alltagswelt und diesem Ort oder Fluchtort entspricht in musikalischer Hinsicht die Entfernung der beiden aufeinanderprallenden Tonarten HDur und CDur, die sich im Quintenzirkel fast diametral gegenüberstehen.
Nun ist zwar zu Schumanns Zeit die Verwendung entlegener Tonarten innerhalb eines Musikstückes nichts Besonderes mehr. Dennoch ist es ungewöhnlich, in einem so kurzen Lied bereits nach wenigen Takten in eine dermaßen weit entfernte Tonart zu wechseln, und dies unerwartet und unvermittelt, also ohne zu modulieren.[13] Die auf den C-Dur-Teil folgende Rückkehr in die ›Normalität‹ lässt sich ebenfalls in den Deutungsprozess mit einbeziehen. Während das Betreten des Frei-Raumes schnell und unkompliziert geschehen konnte, fällt sein Verlassen schwer. Die ›Rückkehr in die Alltagswelt‹ von C-Dur nach E-Dur vollzieht Schumann mithilfe einer enharmonischen Modulation, die etwas widerborstig anmutet: Am Ende von Takt 13 erklingt der übermäßige Dreiklang c-e-gis, der sich eigentlich in einen subdominantischen F-Dur-Akkord auflösen müsste, so wie das in den Takten 2f. und 6f. bereits demonstriert wurde. Die Fortsetzung aber macht deutlich, dass der Akkord enharmonisch umgedeutet wird: Korrekterweise müsste er als his-e-gis notiert werden, denn er bildet eine Zwischendominante zu A-Dur, das sich als Subdominante der Grundtonart E-Dur entpuppt.
Das Lied bietet sich in mehrfacher Hinsicht für eine unterrichtliche Beschäftigung an. Der Text schafft erste Nähe: Es geht um etwas Außergewöhnliches, außerhalb der Norm Befindliches, um das Überschreiten von Konventionen und Grenzen, das Gewinnen eines Freiraums – was durchaus Bezug zur Lebenswelt der Schüler aufweist. Um der Textvorlage gerecht zu werden, verwendet Schumann eine Tonart, die im Kontext gewissermaßen einen ›Fremdkörper‹ darstellt. Die Musik überschreitet somit also ebenfalls eine Grenze: Die unvermittelt ergriffene entfernte Tonart verkörpert den gewonnenen Freiraum. Als geeignet erweist sich die Komposition auch deshalb, da Wesentliches schon beim ersten Hören erfahrbar wird, und zusätzlich auch ›lesend‹ bestätigt werden kann: Der Höreindruck korrespondiert mit dem anschaulichen Notenbild (hier insbesondere der Wechsel der Tonart und der Taktart).
Die Schüler erkennen, dass und wie Musik in der Lage ist, mit ihr immanenten Mitteln über das bloße Abbilden realer Räume hinausgehend gerade auch solche Räume darzustellen, die nicht fassbar sind – Räume, die nur in der Vorstellung, der Phantasie oder im Inneren eines Menschen existieren. Ausgehend etwa von Fragen wie »Mit welchen Mitteln erreicht der Komponist das?«, »Wohin wird moduliert?«, »Wie geschieht das?« usw. fokussieren die Schüler einzelne kompositorische Details. Dass sie durch die Auseinandersetzung mit dem musikalischen Phänomen entsprechendes Fachwissen erwerben, ist gleichwohl nicht eigentliches Ziel des Unterrichts, sondern ein (durchaus positiver) Nebeneffekt. Im Zentrum des Unterrichts steht das Lied. Mit ihm treten die Schüler von Anfang an in eine affektive Beziehung; es steht im Mittelpunkt – nicht die Funktionstheorie oder andere analytische Techniken. Der Lehrer wiederum trägt die Verantwortung dafür, dass die richtige Brille aufgesetzt und der Blickwinkel geschärft wird: bei der Stückauswahl, bei der Entscheidung für die Details, im Unterricht selbst. Er muss Gespür dafür entwickeln, welche Aspekte, Abschnitte oder Phänomene eines Musikwerks analysierenswert sind, da deren Betrachtung gewinnbringende Erkenntnisse verspricht.
2.3.2 Zum Thema ›Historische Perspektive(n)‹ – Johann Sebastian Bach, Kantate BWV 48, Choral Soll’s ja so sein[14]
Beispiel 2: Johann Sebastian Bach, Kantate BWV 48, Choral Soll’s ja so sein (Chorpartitur)
Im Mittelpunkt des Chorals steht die Bitte, Gott solle den Sünder lieber im Diesseits, also auf der Erde für seine Schuld büßen lassen (»So fahr hiefort … und lass mich hie wohl büßen!«). Dafür möge er ihn bzw. seine Seele nach dem Tode vor ewiger Verdammnis bewahren (»und schone dort«). Der in der Tonart B-Dur stehende Choral weicht bereits im ersten Takt in die Tonart F-Dur aus, im zweiten Takt in die Tonart g-Moll; der dritte und vierte Takt stehen wieder in F-Dur. Der Abschnitt »So fahr hiefort« endet mit einem Halbschluss in der Grundtonart B-Dur, während die sich anschließende Phrase »Und schone dort« in der Tonart As-Dur beschlossen wird. Über mehrere unmittelbar aufeinander folgende ausfliehende Kadenzen (in B-Dur, c-Moll und d-Moll) und nach weiteren Ausweichungen schließt der Choral in der Grundtonart.
Die tonartliche Konzeption ist insofern bemerkenswert, da zu Bachs Zeit in einem in einer Durtonart stehenden Stück nur in die Tonarten der II., III., IV., V. und VI. Stufe moduliert werden kann. Eine für Schüler sehr anschauliche Darstellung dieses Sachverhalts findet sich etwa bei David Kellner. In seinem Lehrbuch Treulicher Unterricht im General-Baß (1737) ist eine sogenannte »Ausweichungs=Tabelle aller 12. Dur-Thone, nebst deren Kenn=Zeichen« abgebildet[15]; daneben findet sich die entsprechende Übersicht für die Molltonarten (dort kann in die Tonarten der III., IV., V., VI. und VII. Stufe moduliert werden).
Abb. 1: David Kellner, Treulicher Unterricht im General-Baß (1737), Ausweichung »aller 12 Dur-Thone«
Dieser Tonartenrahmen wird in der Barockzeit lediglich in Rezitativen und Fantasien überschritten. Kommen jedoch in anderen Satztypen – also etwa einem Choralsatz – Ausweichungen in fremde Tonarten vor, handelt es sich um Regelverstöße, die legitimiert werden müssen; bei Vokalkompositionen geschehen sie meist im Dienst der Textausdeutung. So auch hier: Die regelwidrige Ausweichung in die nicht zum Tonartenspektrum der Grundtonart B-Dur gehörende Tonart As-Dur verwendet Bach, um den Textinhalt und speziell das Wort ›dort‹ hervorzuheben. Hiermit schafft er eine überzeugende musikalische Entsprechung für den weit entfernten Himmel bzw. das außerhalb der menschlichen Vorstellung liegende Jenseits: Die Tonart As-Dur entstammt quasi einer anderen Sphäre. Da die vorangegangene Choralzeile (»So fahr hiefort«) ebenfalls mit der Tonfolge b1-c2 beschlossen wird, ist die Wirkung der Stelle besonders groß: FDur und As-Dur erklingen an unmittelbar aufeinander folgenden, korrespondierenden Einschnitten.
Anders als der Hörer der Barockzeit können wir die volle Bedeutung des Abschnittes wohl kaum unmittelbar nachempfinden, da wir vor dem Hintergrund der uns bekannten Musik diese Regelübertretung nicht als solche wahrnehmen. Erst mit Kenntnis des spätbarocken Tonartbegriffs wird das Außergewöhnliche, die im wahrsten Sinne des Wortes ›Un-Erhörtheit‹ dieser Ausweichung nachvollziehbar und ihre Intention verständlich.[16] Die Schüler erkennen somit, dass musiktheoretische Regeln und Konventionen einem historischen Wandel unterliegen, dass Musik zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich gehört und verstanden wird.[17] Ein vergleichbarer Erkenntnisgewinn hätte sich nicht einstellen können, wenn etwa jeder einzelne Akkord des vorliegenden Chorals – fleißig, aber unreflektiert – lediglich benannt und dann möglicherweise noch mit (ahistorischen) Funktionsbezeichnungen versehen worden wäre.
2.3.3 Zum Thema ›Neue Musik‹ – Olivier Messiaen, Mode de valeurs[18]
Ich habe bereits erwähnt, dass man sich der sogenannten Neuen Musik offen und vorurteilsfrei nähern und nach Möglichkeit versuchen sollte, ohne einengende Modelle und Schablonen Sachverhalte mit eigenen Worten zu beschreiben. In diesem Zusammenhang möchte ich zunächst einige Schüleräußerungen zu Olivier Messiaens Mode de valeurs vorstellen, zu einem Stück, bei dem man leicht Gefahr läuft, es rein intellektuell zu behandeln. Es ist erstaunlich, was Schüler – hier übrigens Siebtklässler – bereits beim konzentrierten ersten Hören der komplexen Komposition erspüren und dann in eigenen Worten wiedergeben können. Ich beschränke mich auf einige Äußerungen, die die Struktur des Werks ins Visier nehmen; sie sind übrigens erstaunlich nahe am musiktheoretischen Sachverhalt:
Ein Schüler schreibt: Die Musik wirkt »zusammenhanglos, aber dennoch durchdacht; jeder Ton [ist] ein Individuum« – eine fast poetische, metaphorische Beschreibung der Determination der Einzeltöne; schöner kann man das eigentlich kaum ausdrücken.
Ein weiterer Schüler beschreibt den Höreindruck: »Es regnet und man hat ein kaputtes Dach und darunter [steht] ein Klavier«. Und er erklärt dann im Gespräch näher: »Die Tropfen kommen eben unregelmäßig; das Klavier« – er verbessert sich: »nein, der Flügel steht offen da [also mit abgenommenem Deckel] und die Tropfen fallen einfach auf die Saiten. Alle Töne sind schon da, und man weiß nur nicht, wann welcher kommt.«
Ein anderer Schüler entwickelt die Vorstellung im Rahmen des Gesprächs weiter: »Da stehen lauter Trommeln und Bongos und so was rum, und von oben fallen kleine Steinchen wie Tropfen runter.«
Ein weiterer Schüler fixiert seine Assoziation beim Hören schriftlich mit folgenden Stichworten: »Bild: Autobahn, Stau, Töne = verschiedene Hupen«. Er präzisiert dies im Gespräch: »Das klingt, als ob in einem Stau überall Autos rumstehen. Jede Hupe klingt anders, und alle hupen sie irgendwie durcheinander, aber man kann genau hören, welches Auto gerade wieder hupt!« – Über diesen Hörer hätte sich Messiaen bestimmt gefreut, denn auch seine Beschreibung trifft minutiös den zentralen Sachverhalt der Determination der Töne und den Eindruck ihrer scheinbar zufälligen Verwendung.
Solche Äußerungen schaffen eine ausgezeichnete Motivationsgrundlage für die weitere unterrichtliche Auseinandersetzung. Sie erzeugen Nähe zum Werk und rufen Fragen hervor, etwa: »Wie ist das denn nun eigentlich gemacht?«, »Gibt es Regeln oder ist es improvisiert?« In dieser Phase ist im Übrigen auch all das willkommen, was man sonst im Schulalltag als Fehler oder falsch bezeichnen würde. Irritationen und anfängliches Unverständnis, sogar Protest sind wichtige Schritte auf dem Weg hin zum Werk. Gerade hier stößt man auf fundamentale Fragen, die leider zu oft aus dem Unterricht verbannt werden, etwa: »Warum schreibt ein Komponist so eine merkwürdige Musik?« oder »Wer will denn so etwas hören?«
Ergänzend sei berichtet, wie spannend eine Annäherungsphase an Mode de valeurs in einer elften Klasse verlaufen ist – einer Klasse, die mit negativen Vorerfahrungen und großen Vorbehalten gegen das Fach Musik zum Unterricht kam. Zu Beginn einer der ersten Stunden des Schuljahres bat ich die Schüler, während des Hörens eines etwa sechs Minuten dauernden Musikstückes – mehr wussten sie nicht darüber – anonym zu notieren, was ihnen beim Hören dazu einfiele – die gleiche Aufgabe also, die die Siebtklässler erhalten hatten. In dieser elften Klasse fielen bereits während des Hörens abfällige Bemerkungen wie »Das soll Musik sein?«, »So was Verrücktes!« u.ä. Im Anschluss wurden die beschriebenen Blätter eingesammelt und einzelne Äußerungen vorgelesen, etwa: »Rumgehacke auf den Tasten des Klaviers«, »Kleinkinder am Klavier«, »Von zweijährigem Kind gespielt?«, »Hört sich an, als ob jemand willkürlich auf irgendwelche Tasten haut«, »Klingt nicht, als ob jemand nach Noten spielen würde«, und natürlich hieß es auch »Katze läuft übers Klavier«. Alle Schüler pflichteten dem bei und formulierten: »Das kann doch jedes Kind!«
Diesen Vorwurf griff ich auf. Sollte das zutreffen, müsste es ein Leichtes sein, ein ähnlich klingendes Stück am Flügel zu improvisieren. Dies könnte auch von den Schülern bewerkstelligt werden, die nicht Klavier spielen, also vom Großteil der Klasse. Nach kurzem Zögern meldeten sich etliche Interessenten.
Der Erste spielte wahllos auf der Klaviatur, verwendete jedoch ausschließlich weiße Tasten. Die Mitschüler beschrieben den Höreindruck: »Das klingt alles viel langweiliger.« Zwei Schüler erkannten bei der Wiederholung des Versuchs: »Er benutzt ja die schwarzen Tasten überhaupt nicht!« Man kam zu dem Schluss, dass ein Stück, in dem ausschließlich weiße Tasten verwendet werden, »irgendwie immer nach C-Dur und damit trotz des Durcheinanders immer noch harmonisch klingt«. Also folgerte die Klasse: »In dem Stück, das wir gerade gehört haben, müssen auch schwarze Tasten vorkommen!«
Der nächste Schüler erhielt also von seinen Mitschülern die Aufgabe, weiße und schwarze Tasten zu verwenden. Als Nichtpianist spielte er mit den Zeigefingern der beiden Hände jeweils eine weiße und eine in der Nähe liegende schwarze Taste (oder umgekehrt), worauf er eine kleine Pause benötigte, um die Finger umzusetzen. Es erklangen somit überwiegend halbtönige Bildungen. Die Zuhörer waren auch mit diesem Ergebnis nicht zufrieden. Sie beschrieben die Zweierbindungen als prägnante musikalische Gestalt: »Das klingt ja fast so wie ein Thema!« Da die Klasse jedoch im Hörbeispiel keine wiederkehrenden Motive vernommen hatte, verlangte sie, dass im nächsten Versuch schwarze und weiße Tasten nicht im Halbtonabstand, sondern möglichst gleichmäßig über die Klaviatur verteilt gespielt werden sollten: »Das muss alles viel zufälliger klingen!«
Nach einigen Versuchen schaffte es der Nächste tatsächlich, die Töne unregelmäßig über den ganzen Tonraum zu verteilen. Wieder kritisierten die Hörer: »Das sind ja lauter Viertelnoten! Im Stück war das viel unregelmäßiger.« Schließlich gelang es einem Schüler, entsprechende Tonhöhenfolgen so überzeugend mit unregelmäßigen Tondauern zu kombinieren, dass die Mitschüler Ähnlichkeit mit dem Original konstatierten. Allerdings meinte ein Schüler, die Komposition habe sich noch interessanter angehört. Ihm war nämlich aufgefallen, dass dort neben extrem leisen auch sehr laute Töne erklungen waren, sein Mitschüler jedoch immer in etwa gleich laut gespielt hatte. Prompt kam der Vorschlag, einen erneuten Versuch zu unternehmen, bei dem unterschiedliche dynamische Werte verwendet werden sollten. Mehrere Schüler probierten dies; einige gelangten zu recht eindrucksvollen Ergebnissen.
Nun wurde zum Vergleich die Aufnahme nochmals abgespielt. Diesmal hörte die Klasse ohne zu stören mit großer Aufmerksamkeit zu und registrierte weitere Unterschiede. Ein Schüler beschrieb die größere Dichte: »Das ist alles viel kompakter«. Die Klasse pflichtete ihm bei. Außerdem stellte sie fest, dass Töne angeschlagen werden, während andere noch klingen. Ein Schüler wies sogar darauf hin, dass ab und zu Töne gleichzeitig angeschlagen werden: »Da kommen auch Akkorde vor.« Die Improvisationsversuche hatten ausschließlich einstimmige Linienzüge ergeben; die Komposition hingegen ist mehrstimmig. Einige Schüler erkannten, dass bestimmte Töne öfter erklingen. Genannt wurde »ein ganz lauter, langer und tiefer« sowie ein kurz vor Schluss vermehrt auftretender »höherer, kürzerer, aber ebenfalls lauter Ton«. An den tiefen Ton (Cis1) erinnerten sich fast alle Schüler. Der höhere (g2) wurde bei erneutem Hören eines geeigneten Ausschnittes ebenfalls deutlich wahrgenommen und von den Schülern am Klavier aufgesucht, gefunden und benannt.
Am Ende der Stunde war ein wesentliches Ziel erreicht: Allen Schülern war ›ohrenfällig‹ und, ohne dass der Lehrer dies verbalisieren musste, klar geworden, dass die zunächst geäußerten Vorwürfe der Komposition nicht gerecht wurden. Die Schüler formulierten wörtlich: »Das ist ganz schön schwer nachzumachen!« und vor allem: »In dem Chaos scheint ein gewisses System zu stecken!« Die Klasse war sich darüber einig, dass in der nächsten Stunde nochmals über das Stück gesprochen werden solle. Es bestand ein außerordentlich großes Interesse daran, zu erfahren, wie diese Musik gemacht ist, und es wurde sogar der Wunsch nach dem Notentext laut. Vor allem aber machten die Schüler im Verlauf der skizzierten Stunde eine fundamentale bildende Erfahrung: Sie erkannten, dass ihr erster Eindruck falsch war und dass ein vorschnell gefasstes Urteil am Kern einer Sache vorbeigehen kann. Diese Einsicht dürfte den zukünftigen Umgang der Schüler insbesondere mit moderner Kunst nachhaltig prägen. Aufgrund der geweckten Neugier war die Klasse motiviert, in den folgenden Stunden die Struktur des Materials und die Faktur der Komposition zu ergründen. Dabei gewann sie hochinteressante Einblicke in Messiaens ›Kompositionswerkstatt‹ und wurde darüber hinaus empfänglich für ästhetische Fragestellungen.
3. Regeln für den Schulalltag
Ich möchte abschließend versuchen, ein paar Regeln für den Umgang mit Musikalischer Analyse im Unterricht zu formulieren.
Grundregeln
(1) Klarheit darüber, in welcher Tonart man sich befindet
Das Wissen darum, in welcher Tonart man sich befindet, bildet eine wichtige Voraussetzung für die Analyse traditioneller Musik; erst auf dieser Basis können vernünftige Aussagen getroffen werden. Dies gilt nicht nur für die Betrachtung von harmonischen Sachverhalten, sondern insbesondere auch für die Analyse von Werken, deren formaler Aufbau auf Tonartverhältnissen beruht – so etwa die Sonate. Tonarten-Erkennen kann man üben; man hört und sieht, in welcher Tonart man sich gerade bewegt.[19] Das Ohr ist hierbei der verlässlichste und beste Helfer. Im Notenbild werden Modulationen häufig sichtbar durch Hochalteration von Tönen zu Leittönen oder Tiefalteration von Tönen zu Dominantseptimen.[20]
(2) Reflektierter Einsatz der Funktionstheorie
Diese Regel hängt mit der soeben genannten eng zusammen: Nichterkennen der herrschenden Tonart führt nämlich – etwa bei der harmonischen Analyse eines in einer Durtonart stehenden Sonatensatzes – zu merkwürdigen Formulierungen. Da heißt es dann: »Die Exposition schließt in der Dominante« (statt: »… in der Tonart der V. Stufe bzw. der Dominant-Tonart«). Anstatt bei einer in einer Molltonart stehenden Fuge zu sagen: »Der Comes steht in der Tonart der V. Stufe«, redet man von einer ›Molldominante‹ – ein abstruser Begriff. Die Funktionsbezeichnungen reimen sich dann nicht mit dem, was man hört, und hebeln gleichzeitig den eigentlichen Sinn des Systems aus, das auf unterschiedlichen, insbesondere tonikalen und dominantischen Klangqualitäten fußt.
Bezieht man die Funktionsbezeichnungen auf die jeweils herrschende Tonart, kommt man mit einfachen Bezeichnungen aus. Man kann etwa auf doppelte Subdominanten oder Zwischendominanten zu vermollten Molltonikagegenklängen verzichten und benötigt keine Konstrukte wie etwa die gerade erwähnte Molldominante. Der Begriff ist musikalisch und vom System her widersinnig; dies gilt auch für die Bezeichnung Dominantparallele, da Mollakkorde grundsätzlich keine dominantische Wirkung entfalten können. Der auf dem Papier zwar enthaltene Leitton erscheint in ihnen als Quinte, die mit dem Grundton aufgrund des Obertonverhältnisses verschmilzt und von daher jegliche Leittonwirkung eingebüßt hat.
(3) Berücksichtigung des Genetischen Aspekts
»Nicht nur die Ergebnisse der Wissenschaften lehren, sondern auch die zugehörigen Wege entdecken und gehen lernen, die zu diesen Ergebnissen geführt haben«.[21] Die Reflexion über den Entstehungsprozess eines Musikwerkes motiviert nicht nur dazu, diesen zu verfolgen, zu beleuchten und nachzuvollziehen, sondern auch, selbst zu experimentieren. Dies ist meist spannender als dem Schüler das fertige Ergebnis lediglich vorzusetzen und es dann mehr oder weniger analytisch ›abklopfen‹ zu lassen. Darüber hinaus ist jedes Werk auch genetisch in die Musikgeschichte eingebettet: Es entstand nicht in luftleerem Raum, sondern steht in einem historischen Kontext; es hat eine Vorgeschichte und eine Wirkungsgeschichte, die bis heute reicht. Beide lassen sich verfolgen, was anregenden Unterricht ermöglicht und Querverbindungen nahe legt.
Auch musiktheoretische Sachverhalte lassen sich oft genetisch plausibler erklären. Ein Beispiel hierfür: Der Neapolitaner wird oft definiert als ›Sextakkord auf der kleinen zweiten Stufe‹ und wäre somit in c-Moll ein Des-Dur-Sextakkord. Dies entspricht nicht seinen genetischen Wurzeln. Die Schüler müssen die Genese des Klanges nachvollziehen können:
Die IV. Stufe in c-Moll ist ein f-Moll-Akkord.
In diesem Akkord wird die Quinte häufig durch die Sexte ersetzt; es erklingen dann die Töne f-as-d.
Hieraus entwickelt sich der Neapolitaner, indem die große Sexte d zur kleinen Sexte des tiefalteriert wird; es erklingen nun die Töne f-as-des.
Der in c-Moll fremde Ton des und die bei der unmittelbaren Fortführung des Neapolitaners in die Dominante G-Dur entstehende Relatio non harmonica des-h sind für den Affektcharakter der Wendung verantwortlich. Das des ist eine Art Chorda elegantior, die die Harmonie entscheidend bereichert; somit ist es durchaus auch der interessanteste Ton des Akkords. Gleichwohl ist f Grundton, der in der Regel ja auch verdoppelt wird. Die gut gemeinte Hilfestellung, den Neapolitaner als Sextakkord auf der kleinen zweiten Stufe zu bezeichnen, verdient den Namen Hilfestellung eigentlich nicht, da sie Einsicht und Verstehen verstellt.
Bei der Unterrichtsvorbereitung
(1) Gewissenhafte didaktische Begründung
Die Entscheidung darüber, was im Unterricht analysiert werden soll, bedarf einer gewissenhaften didaktischen Begründung. Der Lehrer muss erwägen, ob der Gegenstand es wert ist, die Lebenszeit der Schüler (aber auch die kostbare, meist ohnehin knappe Unterrichtszeit) damit auszufüllen. Gerade auch in Anbetracht des Zeitfaktors darf im Unterricht niemals nur aus Prinzip oder gar als Disziplinarmaßnahme analysiert werden (Originalton eines Lehrers: »Wenn ihr anständig seid, singen wir, sonst gibt’s eine Analyse!«).
(2) Detaillierte Textkenntnis
Der Lehrer selbst muss das zu behandelnde Stück bis ins Detail analysiert haben. Erst dann kann er nämlich das auslesen, was für den Unterricht und für die Schüler essentiell ist. Er muss fachlich absolut über der Sache stehen und darf nicht Gefahr zu laufen, nur das, was er sich angeeignet hat, für wichtig oder gar das Wichtigste zu halten. Zu oft werden unreflektiert diejenigen Einzelkenntnisse weitergegeben, die man punktuell und möglicherweise zufällig, etwa im Rahmen seines Studiums, erworben hat.
(3) Einsatz von Primärquellen
Primärquellen können einen Sachverhalt oft beträchtlich veranschaulichen, auch wenn sie auf den ersten Blick schwerer verständlich als Sekundärquellen erscheinen. So ist beispielsweise für die Beschäftigung mit der Sinfonie bzw. der Sonate der Klassik die Lektüre der entsprechenden Kapitel aus Heinrich Christoph Kochs Versuch einer Anleitung zur Composition[22] – zumindest für den Lehrer, aber auch für den Oberstufenschüler – äußerst empfehlenswert. Koch orientiert sich eng an kompositionstechnischen Fragen und hat stets klingende Musik vor Augen und Ohren. Folglich beschreibt er den Formtypus da, wo möglich, mit größter Präzision, ist sich aber gleichzeitig der Freiräume und der Vielfalt der Möglichkeiten der künstlerischen Ausgestaltung bewusst. Legt man Kochs Ansatz zugrunde, muss man sich im Unterricht nicht von einer Entschuldigung zur nächsten hangeln (»Das ist eben eine Ausnahme«, »An dieser Stelle übertritt Haydn eine Regel« oder »Mozart darf das!« usw.), so wie es häufig der Fall ist, wenn dem Schulunterricht das starre, meist noch didaktisch verkürzte Modell der Sonaten(haupt)satzform zugrunde liegt.[23]
Primärquellen sind nicht nur per se näher am Sachverhalt, sondern prägen sich oft gut ein, sowohl durch ihre Diktion als auch durch ihr immer wieder äußerst anschauliches Vokabular: Die Rede ist da vom »Diabolus in musica«, von »betrügenden Kadenzen«, »empfindsamen Noten« und »Takterstickungen«; Johann Mattheson trägt die Kirchentonarten zu Grabe und Joseph Riepel vergleicht die in einem Stück zur Verfügung stehenden Tonarten und ihre Hierarchie mit dem Personal eines Bauernhofs usw. – alles ein im besten Sinne äußerst pädagogisches Vokabular.
Bei der Durchführung von Unterricht
(1) Nähe zum Gegenstand
Der Schüler soll und muss sich im Rahmen der Analyse ausführlich und meist auch über längere Zeit hinweg mit einer Sache beschäftigen. Ohne emotionalen Zugang – es wurde bereits eingangs gesagt – und der daraus resultierenden Motivation wird er diese Wegstrecke nicht oder nur widerwillig mitgehen, was bedeutet, dass sich ein Lernerfolg kaum einstellen wird. Um dem vorzubeugen, sollte das Musikstück bzw. der entsprechende Ausschnitt nicht nur oft genug gehört werden können, sondern auch das Klavier zum Einsatz kommen: Hier können die entscheidenden Wendungen herausgegriffen und vorgeführt werden, etwa wie es mit bzw. ohne Neapolitaner klingen würde, wie und wohin sich z.B. der verminderte Septakkord oder der übermäßige Dreiklang außerdem noch auflösen könnten usw.
(2) Bedeutung des Hörens/Einsatz von Notenmaterial
Es gibt viele Dinge, die von Schülern hörend wahrgenommen werden können, ohne dass dazu der Notentext auf dem Tisch liegen muss. Im Gegenteil: Zumal in der Anfangsphase erschwert der Notentext den Zugang zur Musik oft, da viele Schüler nicht in der Lage sind, einer Partitur zu folgen. Sie klammern sich krampfhaft an einzelne Systeme und blättern dann, wenn der Lehrer oder die ›Profis‹ blättern, und sind dabei so angespannt – der Lehrer sieht ja, wer an der falschen Stelle blättert –, dass sie die Musik selbst kaum noch wahrnehmen.
Die Qualitäten des Notentextes sollten nur gezielt eingesetzt werden: Oft zeichnet er sich durch große Anschaulichkeit aus, und der visuelle Eindruck erleichtert das Verstehen. Außerdem ermöglicht er es, die strenggenommen nur in der Zeit existierende Musik gewissermaßen anzuhalten, sich in der Komposition nach Belieben wie in einem Buch oder auf einem Bild in verschiedene Richtungen zu bewegen, nach vorne, nach hinten zu springen, zu vergleichen usw.[24]
Da gleichwohl der ausschließlich hörende Umgang mit Musik für den Laien, auch für den musikalisch gebildeten, der normale ist – viele musikliebende und verständige Hörer besuchen Konzerte und kommen bereichert nach Hause, obwohl sie keine Notenkenntnisse besitzen –, sollte der Hörerziehung im Musikunterricht ein hoher Stellenwert eingeräumt werden.
(3) Alltagssprache vor Fachsprache
Zum Schluss die meiner Erfahrung nach wohl wichtigste Regel – in Anlehnung an Martin Wagenschein[25]: Kinder hören, spüren, können und wissen so vieles, das nicht ans Tageslicht treten kann, wenn ihnen sofort die Fachsprache abverlangt wird. Die Angst vor einem falschen Fachbegriff ist so groß (ähnlich wie die vor einer falschen grammatikalischen Konstruktion im Fremdsprachenunterricht), dass viele Schüler sich nichts zu sagen trauen, obwohl sie sehr viel Richtiges und Wertvolles in der Alltagssprache ausdrücken könnten, was den Unterricht bereichern würde – erinnert sei nur an die Aussagen der Siebtklässler zu Mode de valeurs. Auch wir, die sogenannten ›Experten‹, denken schließlich über Neues, Unbekanntes, Ungewöhnliches in eigenen, uns zur Verfügung stehenden Worten nach und formulieren dann auch so. Zu oft spielt der Lehrer jedoch eine Art Pingpongspiel mit den wenigen Schülern der Klasse, die die Fachbegriffe parat haben, und vergrößert dadurch den Abstand zu den übrigen immer mehr, die sich dazu auch noch dumm vorkommen. Natürlich ist die Fachsprache wichtig; sie ist aber im Grunde lediglich so etwas wie ein Siegel, das bestätigt, was man vorher bereits in der Alltagssprache verstanden hat.[26]
4. Schlussbemerkung
Zum Schluss sei nochmals betont, dass es im Rahmen eines bildenden Musikunterrichts wichtig ist, die Schüler von Anfang an in eine mehrdimensionale Auseinandersetzung mit der Musik eintreten zu lassen: singend, spielend, handelnd, nachdenkend, analysierend. Ein Unterricht, der diese Erfahrungsmöglichkeiten anbietet und Schüler und Musik gleichermaßen ernst nimmt, kann einen lebenslangen Bildungsprozess initiieren. Er beugt der negativen Erfahrungen vor, die wohl ein jeder Lehrer macht, der ein früher besprochenes Thema aufgreifen will: Meist stößt er bei den Schülern auf derart bestürzende Unkenntnis, dass man glauben könnte, der Gegenstand sei niemals behandelt worden. Horst Rumpf erklärt dieses Phänomen damit, dass »die Sache überhaupt nicht im Ernst ›da‹ war, sie wurde nur durchgenommen, sie war schon verschwunden, ehe sie erschien«.[27] Musikunterricht, aus dem die Schüler nichts mitnehmen, ist zweifellos indiskutabel. Unterricht, aus dem sie lediglich mitnehmen, dass Musik Spaß macht, geht nicht weit oder – besser gesagt – nicht tief genug. Es ist meiner Überzeugung nach eine wesentliche Aufgabe des Musikunterrichts, den Schülern über die fachliche Ausbildung hinausgehend auch Lebensperspektiven aufzuzeigen, beispielsweise:
dass die (intensive) Beschäftigung mit Kunst eine Bereicherung für den Menschen darstellen kann und im wahrsten Sinne des Wortes Lebens-Qualität schafft;
dass Kunst den Menschen zur Auseinandersetzung auffordert: mit ihr, mit sich selbst, mit seiner Welt; und schließlich:
dass Kunst – so verstanden – ein Fundament bilden kann, das Menschen sogar in Situationen, die ihre Existenz erschüttern, zu tragen vermag.
Anmerkungen
Bei diesem Text handelt es sich um die überarbeitete Fassung eines Vortrags, der am 10.10.2008 im Rahmen der Gymnasiallehrerfortbildung am Tag der Schulmusik an der Hochschule für Musik Karlsruhe gehalten wurde. | |
Der besseren Lesbarkeit halber wird im Folgenden darauf verzichtet, beispielsweise von Schüler bzw. Schülerin oder von Lehrer bzw. Lehrerin zu sprechen. Wo also von ›Schüler‹ oder ›Lehrer‹ die Rede ist, sind selbstverständlich immer auch Schülerinnen und/oder Lehrerinnen mitgemeint. | |
Zum Themenkomplex »Bildender Unterricht« vgl. Walter 2003, insbesondere 7–57; die Vorbemerkung zum Vortrag gibt Gedanken aus diesem Text teils sinngemäß, teils wörtlich wieder. | |
Frisch 1980, 170. | |
Wagenschein 1980, 103. Vgl. auch Wagenschein 1970c und – speziell auf das Fach Musik bezogen – Richter 1999. | |
»Je tiefer man sich eindringlich und inständig in die Klärung eines geeigneten Einzelproblems eines Faches versenkt, desto mehr gewinnt man von selbst das Ganze des Faches.« (Wagenschein 1970a, 229) | |
»Je tiefer man sich in ein Fach versenkt, desto notwendiger lösen sich die Wände des Faches von selber auf und man erreicht die kommunizierende, die humanisierende Tiefe, in welcher wir als ganze Menschen wurzeln, und so berührt, erschüttert, verwandelt und also gebildet werden.« (Wagenschein 1970a, 229; vgl. hierzu auch Wagenschein 1970b, 410) | |
Vgl. Walter 2008b, 366 und 2009b, 382f. Passagen aus beiden Werken sind teils sinngemäß, teils wörtlich in diesen Abschnitt des Vortrags eingeflossen. | |
Der Autor ist sich der Problematik dieses Begriffs bewusst; hier und im Folgenden versteht er darunter in der Hauptsache die sogenannte ›E-Musik‹ des 20. und 21. Jahrhunderts. | |
Als nützlich erweist sich möglicherweise die Anfertigung einer Grafik, mit deren Hilfe der Ablauf des Stücks, einzelne Stationen, besondere klangliche Ereignisse und Entwicklungen und Ähnliches festgehalten werden können. | |
Vgl. Walter 2008b, 366. | |
Vgl. Walter 2004, 23ff. sowie Walter 2008b, 370f. | |
Natürlich könnte man den kompositorischen Sachverhalt mittels einer neapolitanischen Modulation erklären und den CDur-Akkord als verselbstständigten Neapolitaner in HDur deuten. Dies hieße aber der Musik Gewalt anzutun und die faszinierende Direktheit dieser Stelle zu bagatellisieren. Schumann hebt das schlagartige, unvermittelte In-Besitz-Nehmen des gewonnenen Frei-Raums durch eine Rückung bzw. ›Nicht-Modulation‹ hervor. | |
Vgl. Deppert 1993, 38-48, insbesondere 43 und Walter 2004, 22f. | |
Kellner 1737, 54. | |
Im Übrigen weist das Beispiel eine Verwandtschaft zu Schumanns Klavierlied auf: Auch hier wird mit harmonischen Mitteln ein außerhalb von ›Welt‹ liegender Raum angedeutet – in diesem Fall das Jenseits. | |
Hier kann im Musikunterricht die interessante Überlegung angestellt werden, wie eine vergleichbare Wirkung heute – etwa in der Musik, die den Schülern vertraut ist – erzielt werden könnte. Anhand eigener Kompositionsversuche werden Erfahrungen gemacht vom Umgang mit Regel und Freiheit, mit Normalem und Außergewöhnlichem, mit Vertrautem und Fremdem; zudem kann der Reiz von ›Störungen‹ entdeckt werden. | |
Vgl. Walter 2003, 139–182. | |
Am besten beginnt man mit einstimmigen Melodien; später folgen Bach-Inventionen, diverse Menuette, Schumanns Album für die Jugend u.a. | |
Freilich ist bereits in der Barockzeit die Erhöhung der vierten Stufe zur Chorda elegantior im Kadenzbereich keine Ausweichung mehr. Auch Acciaccaturen haben selbstverständlich keine modulatorische Funktion. | |
Berg 2006, 99. | |
Vgl. insbesondere Koch 1793, 301–319. | |
Der Autor hat den Versuch unternommen, in einem Musikbuch für die Sekundarstufe II die Sonatenform der Klassik aus Kochs Perspektive darzustellen: Walter 2008a und 2009a. | |
Von daher sollte das Notenlesen (spätestens) von der fünften Klasse an geübt werden – mit entsprechend geeigneten Beispielen, präpariertem Notentext, farbigen Markierungen, mit Hilfestellungen auf der Folie oder dem Bildschirm (der mitlaufende Cursor), durch Arbeit mit reduzierten Partituren, einem Particell usw. | |
Vgl. Wagenschein 1970d. Wagenschein verwendet statt »Alltagssprache« den Begriff »Muttersprache«. | |
Vgl. Wagenschein 1970d, 162. | |
Rumpf 1966, 116f. |
Literatur
Berg, Hans Christoph (2006), »Lehrstückunterricht. Exemplarisch – genetisch – dramaturgisch«, in: Zwölf Unterrichtsmethoden, hg. von Jürgen Wiechmann, Weinheim und Basel: Beltz.
Deppert, Heinrich (1993), Kadenz und Klausel in der Musik von J.S. Bach. Studien zu Harmonie und Tonart, Tutzing: Schneider.
Frisch, Max (1980), Homo faber, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Kellner, David (1737), Treulicher Unterricht im General-Baß, Hamburg: Herold, Reprint Hildesheim u.a.: Olms 1979.
Koch, Heinrich Christoph (1793), Versuch einer Anleitung zur Composition, Bd. III, Leipzig: Adam Friedrich Böhme, Reprint Hildesheim u.a.: Olms 1969.
Richter, Christoph (1999), »Der Beitrag des Faches Musik zum Auftrag der allgemeinbildenden Schule. Gedankensplitter zu einem vernachlässigten Thema«, Diskussion Musikpädagogik 1, 29–56.
Rumpf, Horst (1966), 40 Schultage. Tagebuch eines Studienrats, Braunschweig: Westermann.
Wagenschein, Martin (1970a), »Das Exemplarische Lehren als ein Weg zur Erneuerung des Unterrichts an den Gymnasien«, in: Ursprüngliches Verstehen und exaktes Denken, Bd. I: Pädagogische Schriften, Stuttgart: Klett, 216–241.
––– (1970b), »Das Exemplarische Lehren als fächerverbindendes Prinzip«, in: Ursprüngliches Verstehen und exaktes Denken, Bd. I: Pädagogische Schriften, Stuttgart: Klett, 400–416.
––– (1970c), »Verdunkelndes Wissen?«, in: Ursprüngliches Verstehen und exaktes Denken, Bd. II, Stuttgart: Klett, 58–67.
––– (1970d), »Die Sprache im Physikunterricht«, in: Ursprüngliches Verstehen und exaktes Denken, Bd. II, Stuttgart: Klett, 158–173.
––– (1980): Naturphänomene sehen und verstehen. Genetische Lehrgänge, hg. von Hans Christian Berg, Stuttgart: Klett.
Walter, Johannes M. (2003): Die Bedeutung der Didaktik Martin Wagenscheins für den Musikunterricht und die Musikpädagogik, erörtert an Unterrichtsbeispielen mit Werken Neuer Musik (= Forum Musikpädagogik 54), Augsburg: Wißner.
––– (2004), »Werkkanon oder Erfahrungskanon? Eine mögliche Perspektive für den Musikunterricht«, Diskussion Musikpädagogik 22, 20–26.
––– (2008a), »Die Sonatenform«, in: Musik um uns. Sekundarbereich II, Schülerband, hg. von Markus Sauter und Klaus Weber, Braunschweig: Schroedel, 274–277.
––– (2008b), »Musik: Analysieren und Verstehen«, in: Musik um uns. Sekundarbereich II, Schülerband, hg. von Markus Sauter und Klaus Weber, Braunschweig: Schroedel, 366–377.
––– (2009a), »Die Sonatenform«, in: Musik um uns. Sekundarbereich II, Materialband für Lehrerinnen und Lehrer, hg. von Markus Sauter und Klaus Weber, Braunschweig: Schroedel, 318–320.
––– (2009b), »Musik: Analysieren und Verstehen«, in: Musik um uns. Sekundarbereich II, Materialband für Lehrerinnen und Lehrer, hg. von Markus Sauter und Klaus Weber, Braunschweig: Schroedel 382–385.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.