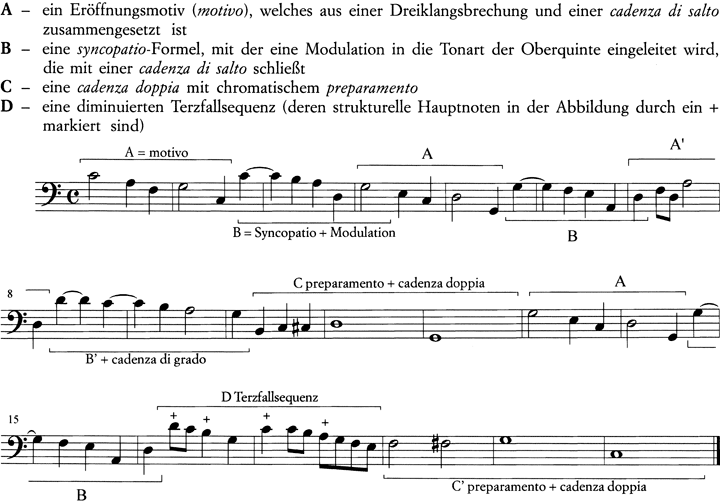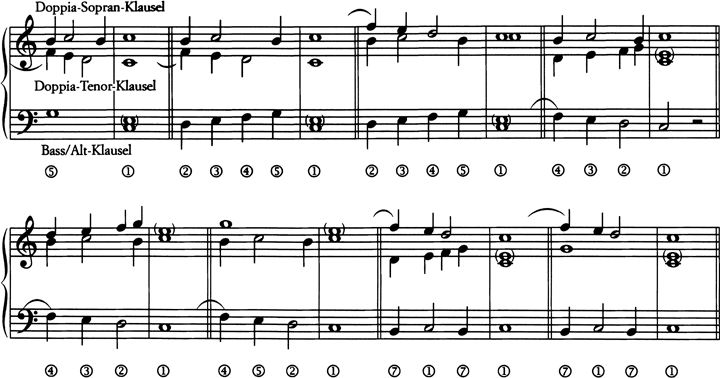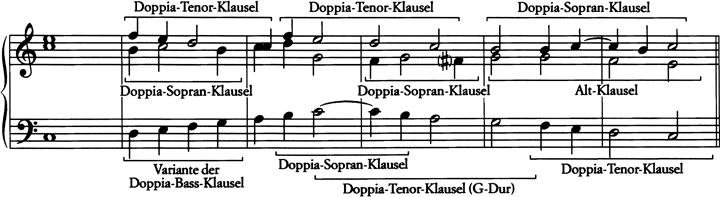Vom Tonsatz zum Partimento
Giovanni Paisiello, Regole per bene accompagnare il partimento o sia il basso fondamentale sopra il Cembalo (= Praxis und Theorie des Partimentospiels 1), hg. von Ludwig Holtmeier, Johannes Menke und Felix Diergarten, Wilhelmshaven: Noetzel 2008
Folker Froebe
Mit Engagement werben Ludwig Holtmeier und eine Reihe überwiegend jüngerer Musiktheoretiker im Umfeld der Freiburger Musikhochschule und der Baseler Schola Cantorum für eine Erneuerung der Musiktheorie aus dem Geiste des ›Partimento‹. Ihnen geht es um nicht weniger als den Anschluss des »geschichtslosen Faches«[1] an die Tradition einer noch ganz im »tonalen Usus«[2] verwurzelten Lehre. In jüngster Zeit nun beginnt sich die Aufarbeitung der Partimento-Tradition für die gegenwärtige Lehre in Publikationen niederzuschlagen. Mit der Edition von Giovanni Paisiellos Regole per bene accompagnare il partimento o sia il basso fondamentale sopra il Cembalo eröffnen Ludwig Holtmeier, Johannes Menke und Felix Diergarten die Publikationsreihe Praxis und Theorie des Partimentospiels.
Ein informatives Vorwort und ein Faksimile von »Paisiellos Regole und Partimenti im Manuskript« (19–62) eröffnen den Band; auf die Wiedergabe der leichter greifbaren Druckfassung (Petersburg 1782) wurde verzichtet. Es folgen »Paisiellos Regole in Transkription und Übersetzung« (63–77) und »Paisiellos Partimenti im modernen Satz in Ausführung und Kommentar« (79–138) sowie »Drei exemplarische Aussetzungen« (139–147). Ein knappes »Glossar« dient der Klärung zentraler Begriffe. Das abschließende »Vademecum«, eine Zusammenfassung der wichtigsten Modelle – Kadenzen (»cadenze«), Formen der Oktavregel (»scale«) und Sequenzen (»movimenti«) –, unterstreicht den pädagogischen Zweck der Publikation.
Allein schon der Umstand, dass mit Paisiellos Regole eine weitere Quelle des 18. Jahrhunderts in einer für die heutige Unterrichtspraxis nutzbaren Gestalt vorliegt, ist erfreulich. Was jedoch in besonderer Weise das Interesse an der Edition weckt, sind die Kommentare, Analysen und Realisierungsvorschläge der Herausgeber: Der Band darf als ein Prüfstein für das Konzept gelten, die historische Lehre für die Gegenwart aufzuarbeiten und ihre implizite Theorie offenzulegen. Eine Quellenedition mit derart umfassendem Anspruch ist nicht allein hierzulande ein Novum. Auch von vergleichbaren Publikationen aus dem anglo-amerikanischen Raum – den von David Ledbetter herausgegebenen Unterrichtsmaterialien Georg Friedrich Händels (1990) und dem von William Renwick edierten Langloz-Manuskript (2001) – unterscheidet sich der Band durch den Umfang und den instruktiven Gehalt der Kommentare sowie die beigefügte Modellsammlung (»Vademecum«). Zwei weitere Bände der Reihe Praxis und Theorie des Partimentospiels sind angekündigt: Der bereits erwähnten amerikanischen Ausgabe von Georg Friedrich Händels Aufzeichnungen zur Kompositionslehre eine weitere zur Seite zu stellen, scheint durch den Mehrwert des Editionskonzepts gerechtfertigt. Mit dem dritten Band sollen Emanuel Aloys Försters schwer greifbare Practische Beispiele allgemein zugänglich gemacht werden.
Intentionen
Das Vorwort des Bandes bietet Informationen zu Begriff und Geschichte des Partimentos, zur Person Paisiellos und zur Spiel- und Aussetzungspraxis. Darüber hinaus lässt sich insbesondere dem zweiten Abschnitt (»Was ist ein Partimento?«) einiges auch über Anliegen und Motivation der Herausgeber entnehmen.[3]
Grundlegend ist zunächst die Abgrenzung von einem rein aufführungspraktisch verstandenen Generalbass. Die Partimenti – bezifferte und unbezifferte Bässe – bildeten als »eigenständige musikalische Erscheinungen« die Grundlage einer modellbasierten Improvisations- und Kompositionsdidaktik (10):
Im Besonderen bezeichnet der Begriff ›Partimento‹ die Stegreif-Aussetzung solcher Generalbassstimmen und eine darauf gestützte musiktheoretische Didaktik […].
Sogleich jedoch wird der Terminus enthistorisiert und in den Rang eines ›Metabegriffs‹ erhoben, der stellvertretend für die gesamte bassbezogene und modellbasierte Lehre zu stehen vermag:
›Partimento‹ wird […] oft auch als Synonym für die gesamte italienische Lehrmethode des 17. und 18. Jh. verwandt.[4]
Damit ist die Basis geschaffen, um den Begriff auch in systematischer Hinsicht mit zusätzlicher Bedeutung aufzuladen:
In der jüngsten Zeit bezeichnet Partimento auch ein spezifisches Verständnis von ›Tonalität‹, das sich der Oktavregel und der Generalbassharmonik bedient und so ein Gegenmodell zur Harmonielehre-Tradition des 19. Jahrhunderts darstellt, die sich auf Rameaus Prinzipien der Umkehrung, Terzschichtung und basse fondamentale beruft.
Offenkundig möchten die Herausgeber den noch unbelasteten Terminus ›Partimento‹ zum Markennamen eines schulbildenden musiktheoretischen Paradigmas aufbauen. Aber ist es wirklich hilfreich, die bassbezogene Lehre als »Gegenmodell« zu propagieren? Wie Ludwig Holtmeier selbst verschiedentlich betont hat, werden von den meisten Theoretikern des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts Aspekte der Generalbass- bzw. Partimento-Tradition mit der Rameauschen Theorie verknüpft, etwa ein primär bassbezogenes Verständnis harmonischer Progression mit einer grundtonbezogenen Akkordtypologie und Kadenzlehre.[5] Gerade dieses In- und Nebeneinander systematisch differenter Denkweisen bietet Anknüpfungspunkte für eine gegenwärtige Musiktheorie, die nicht beim ›Entweder-oder‹ stehenbleiben möchte, sondern unterschiedliche Theoreme als Antworten auf unterschiedliche Fragestellungen und ›Bedarfslagen‹ versteht.
Stil
Mit Paisiellos Regole als Eröffnungsband ihrer Publikationsreihe haben die Herausgeber eine überzeugende Wahl getroffen, liegt ihnen doch daran zu zeigen, dass die Partimento-Tradition Relevanz auch für den ›klassischen Stil‹, das Herzstück gegenwärtiger musiktheoretischer Lehre, beanspruchen kann. Giovanni Paisiello (1740–1816), dessen Lebensspanne sich weitgehend mit der des acht Jahre früher geborenen Joseph Haydn überschneidet, gehörte – obwohl heute weit weniger bekannt als die drei großen Klassiker – zu den führenden Komponisten seiner Zeit. Gibt ein Komponist solchen Ranges eine Lehrschrift heraus, die explizit für die zeitgenössische Öffentlichkeit bestimmt ist, darf man vermuten, diese sei von der zeitgenössischen Kompositionspraxis nicht unberührt geblieben. Und in der Tat stehen neben Bässen, die den üblichen, konservativen Partimento-Stil repräsentieren, auch solche, deren thematische und figürliche Gestaltung ihre Entstehungszeit verrät. Dazu heißt es im Vorwort (9):
Nicht zuletzt sind Paisiellos Partimenti, aus denen sich die verschiedensten Stücke vom einfachen Klavierstück bis zur rauschenden Opernsinfonia gewinnen lassen, Kompositionsentwürfe eines bedeutenden Komponisten. Sie gehen an vielen Stellen über den von barocken Idiomen geprägten, didaktischen Partimento-Stil hinaus und zeigen Elemente des galant-klassischen Stils, in denen man vereinzelt auch Anzeichen eines Personalstils sehen kann, wie etwa pointierte Rhythmen und abrupte Wechsel der rhythmischen Dichte.
Während jedoch Paisiellos ›barocke‹ Partimenti in sich geschlossene und stimmige Kleinformen repräsentieren, scheinen gerade jene umfangreicheren Stücke, die sich einem ›klassischen‹ Idiom annähern, eigentümlich auseinanderzufallen, so etwa das Partimento 20, auf dessen Musteraussetzung sich die Rede von der »rauschenden Opernsinfonia« beziehen dürfte: Die markante, kontrastierende Satzeröffnung weckt (wenigstens beim Autor dieses Textes) Erwartungen, die durch den unvermittelt anschließenden sequenziellen ›Leerlauf‹ ab Takt 10 (spätestens Takt 12) mitsamt der Neo-Corellischen ›Cadenza doppia‹ jäh enttäuscht werden (Beispiel 1).
Beispiel 1: Giovanni Paisiello, Regole, »Realisierung von Partimento 20«, 141
Weitere Aspekte fallen ins Auge, hinsichtlich derer das Stück auch im Ganzen gesehen keinen stimmigen Zusammenhang ausprägt, insbesondere die Häufung vollkommener Ganzschlüsse auf der I. und V. Stufe, die Reihung heterogener, sich gleichwohl beständig wiederholender ›Elemente‹ und das ›Auf und Ab‹ formfunktional mehr oder minder indifferenter Sequenzen. Auch von der Kunst, metrische Unregelmäßigkeiten übergeordnet auszubalancieren, wissen Paisiellos Partimenti wenig. Sie zu »Kompositionsentwürfe[n] eines bedeutenden Komponisten« (9) zu erklären, unterstellt sie einem Anspruch, dem sie kaum gerecht werden können und den sie wohl auch nicht erheben.
Paisiellos Didaktik freilich ist mustergültig. Seine Bässe beruhen auf der Verkettung von Modellen und zeigen, wie sich kleinräumige Syntagmen durch Wiederholung, Transposition und Rekombination zu größeren formalen Einheiten fügen lassen. Diese ›additive‹ Formbildung wird von den Herausgebern präzise beschrieben: Die Form eines Partimento ›ergibt‹ sich aus einer tonal mehr oder minder regulierten Abfolge von Phrasen, die sich aus (gegebenenfalls thematisch markierten) Initial- und Kadenzformeln zusammensetzen und durch interpolierte oder linear kadenzeinleitende Sequenzen zu ›Fortspinnungstypen‹ geweitet werden können (siehe Beispiel 2).
Beispiel 2: Giovanni Paisiello, Regole, »Vorwort«, 14, Partimento 1 als Muster modellbasierter Formbildung
In dieser engen, insbesondere für die Improvisationsdidaktik zentralen Koppelung von Satzmodell und Formfunktion gründen allerdings auch die um 1800 bereits unzeitgemäßen Momente des Partimento-Stils. Vor diesem Hintergrund führt beispielsweise der wiederholte Hinweis auf das chromatische Tetrachordmodell, das den Kopfsatz der ›Waldsteinsonate‹ eröffnet (93, Anm. 3, sowie 101), nicht allein die Relevanz, sondern auch die Grenzen des Ansatzes vor Augen. Zweifellos bildet, wie Felix Diergarten andernorts gezeigt hat, das bei Paisiello exemplifizierte Modell eine Folie, vor der sich die »Besonderheiten« der Beethovenschen Instanz herausarbeiten lassen.[6] Diese Besonderheiten aber – formale Position, metrische Einrichtung und »(un-)melodisch-rhythmische Inszenierung«[7] – markieren eine uneinholbare Differenz, die nicht weniger bedeutend ist als die materiale Identität des Modells.
Realisierungsvorschläge
Von den insgesamt 35 Partimenti sind den ersten 19 jeweils analytische oder instruktive Kommentare und partielle Realisierungsvorschläge beigegeben, die auf satztechnische und stilistische, vereinzelt auch formale Gesichtspunkte Bezug nehmen. Der Textteil ist dabei durchwegs knapp gefasst und zielt weniger auf eine umfassende Analyse der Beispiele als auf den deskriptiven Nachvollzug jeweils zentraler Einzelaspekte, die Identifikation von Modellen und die Offenlegung satztechnischer Implikationen.
Die Realisierungsvorschläge kommen dem, was ein erfahrener und stilkundiger Generalbassist spielen würde, sehr nahe. Insbesondere lösen sich die Herausgeber von der ›akademischen‹ Norm des vierstimmig-akkordischen Generalbasssatzes. Denn in der Partimento-Tradition gilt nicht (wie in der unter anderem auf Johann Philipp Kirnberger zurückgehenden ›deutschen‹ Tradition) der vierstimmige, sondern der dreistimmige Satz als die satztechnische Basis des Generalbasssatzes.[8] Als historisches Idealbild des modellbasierten Triosatzes wird auf die Corellische Triosonate verwiesen (81). Eine gewisse Zurückhaltung hinsichtlich Stimmenzahl und -verteilung dürfte didaktischer Rücksichtnahme geschuldet sein: Obgleich die Herausgeber mit den zeitgenössischen Autoren darin übereinstimmen, dass die Stimmenzahl »von der Zweistimmigkeit […] über die Drei- und Vierstimmigkeit bis zur Sechsstimmigkeit oder Achtstimmigkeit variieren« könne (13), folgen die mitgeteilten Aussetzungsvorschläge beinahe durchwegs dem in ausgesetzten Continuostimmen gängigen Modus, die zwei bis drei Oberstimmen stets der rechten Hand zuzuweisen (einzig in der Musteraussetzung von Partimento 14 finden sich zwei Akkorde zu fünf Stimmen).[9] Das ›geteilte Accompagnement‹ (zwei links, zwei rechts), das zu den Standards des Generalbassspiels im 18. Jahrhundert gehörte, ist durch ein Beispiel vertreten (109); die ›galante‹ Manier, Ariosi über dem zweistimmigen Satz der linken Hand zu entfalten, bleibt ohne Darstellung.[10]
Reichlich Anregungen finden sich zur Diminution, zur Realisierung der im Gerüstsatz latenten imitatorischen Strukturen und zur Ausarbeitung der Partimenti im Sinne unterschiedlicher Charaktere und Satztypen. Stets geben die Herausgeber an, worin jeweils das Anliegen oder die Pointe einer Musteraussetzung besteht. Damit begegnen sie nicht zuletzt der Problematik, dass schriftlich fixierte Generalbass- bzw. Partimento-Realisierungen sich zumeist im Spannungsfeld zwischen einer für weitere Differenzierungen offenen, schematischen Darstellung, der exemplarischen Dokumentation eines improvisatorischen Einzelfalls (einschließlich satztechnischer Manierismen und ›Unschärfen‹) und einer detaillierten, quasi kompositorischen Ausarbeitung bewegen.
»Vademecum«
In Paisiellos Regole finden sich keine Instruktionen oder Beispiele zur Gestaltung der Oberstimme bzw. des Rahmenstimmensatzes. Auch stützt Paisiello sich nicht auf die tradierte Systematik sequenzieller Bassmodelle. Diese Leerstellen füllt das angehängte »Vademecum«, mit dem die Herausgeber unter anderem »die gegenseitige Bezogenheit von Melodie und Harmonie« (15) verdeutlichen möchten.
Klauseln und ›Scale‹
Im Zentrum des »Vademecums« steht die Präsentation der »Scale«, also der Oktavregel und ihrer Varianten. Der Abschnitt zu »Klauseln als melodische Formeln im dreifachen Kontrapunkt« (152) führt Abschnitte der Oktavregel zunächst auf die ›Cadenza doppia‹ bzw. deren Bassfundierung zurück (Beispiel 3).[11] Nicht ganz glücklich ist es freilich, den Klauseltausch schlicht als Stimmentausch im dreifachen Kontrapunkt der Oktave darzustellen: Wird über einem tenorisierenden Bass die Altklausel wörtlich beibehalten, so entsteht eine ›quarta non fundata‹, die sich (wie in Akkolade 2, Beispiel 1) als lizenziöse Superjectio (also ein nicht dem Gerüstsatz zugehöriges Element) verstehen lässt oder (wie in Akkolade 2, Beispiel 2) fehlerhaft ist (korrekt wäre die Führung der Altklausel in Terz- bzw. Dezimenmixturen zum Bass).[12]
Beispiel 3: Giovanni Paisiello, Regole, »Vademecum«, 152, »Klauseln als melodische Formeln im dreifachen Kontrapunkt«
Bereits im Vorwort hatten die Herausgeber demonstriert, dass sich zu Paisiellos erstem Partimento (Beispiel 2) eine Oberstimme bilden lässt, die ausschließlich aus einer Folge von Tenor- und Sopranklauseln besteht (14f.). Hier nun liefern sie dazu den ›Überbau‹, indem sie die vollständige Oktavregel aus der Integration mehrerer Doppia-Kadenzen (152) herleiten (Beispiel 4).[13]
Beispiel 4: Giovanni Paisiello, Regole, »Vademecum«, 152, »Die ›Regola dell’ottava (Oktavregel) als Addition von Klauseln«
Wertvoll ist zudem die Mitteilung zahlreicher Bezifferungs- und Bassvarianten der Oktavregel im vierstimmigen Satz – von der ›Urform‹ »mit Grund- und Sextakkorden« über ›modernere‹ Formen mit charakteristischen Vierklängen bis hin zu chromatischen und zwischendominantisch angereicherten Varianten (153f.). Einzig auf eine Darstellung der tetrachordisch abgeteilten Form mit der 4. Bassstufe als (relativem) Ruheklang wird verzichtet, obgleich auch das konsonant ansetzende Finaltetrachord (4–1) ein zentrales Modell des 18. Jahrhundert darstellt.[14]
In den Überschriften der jeweiligen Beispiele ist von »Zwischendominanten« sowie dem »Einsatz des verminderten Septakkordes und seiner Umkehrungen« die Rede – ein im Interesse besserer ›Anschlussfähigkeit‹ durchaus sinnvoller Eklektizismus. Abweichend vom Reglement der Partimento-Quellen des 18. Jahrhunderts[15] verzichten die Herausgeber vielerorts auf eine kontrapunktisch regulierte Einführung ›dominantischer‹ Vierklänge. Auf diese Weise kann die Darstellung konsequent dem ›Prinzip der besten Lage‹[16] folgen; die melodiebildenden Implikationen der jeweiligen Regola-Segmente – überwiegend zweigliedrige, lokale Penultima-Ultima-Fortschreitungen – treten offen zu Tage.[17]
Generell besteht eine gewisse Spannung zwischen der skalaren Gestalt der Oktavregel, die eine geradezu ontologisch verankerte Einheit suggeriert, und dem Umstand, dass die jeweils auf die 5. und die 1. Bassstufe gerichteten Skalenabschnitte selbständige Modelle mit einem begrenzten Repertoire idealtypischer Oberstimmen repräsentieren. Werden sie zur vollständigen Oktavregel verbunden, so lässt sich ein charakteristischer Rahmenstimmensatz nur mit Hilfe einer Lagenkorrektur im Umfeld der Nahtstelle erreichen.[18] Entsprechend verfahren auch die Herausgeber bei der Vorstellung der beiden wichtigsten Grundformen der Oktavregel (Beispiel 5).
Beispiel 5: Giovanni Paisiello, Regole, »Vademecum«, 153; a) »Grundform der Oktavregel«, b) »Variante mit Terzquartakkorden und Sekundakkord auf der ersten Stufe«
Wer den didaktischen Zweck der Oktavregel nicht zuletzt darin sieht, bestimmte Griff- und Stimmführungsmuster einzuüben, wird bedauern, dass die Lagenkorrektur über der kontinuierlich steigenden Bassskala nur um den Preis einer uncharakteristischen Mittelstimmenführung zwischen der 5. und der 6. Bassstufe (Beispiel 5a) oder einer satztechnischen Lizenz zwischen der 6. und der 7. Bassstufe zu haben ist (Beispiel 5b).[19] Bei manchen Autoren des 18. Jahrhunderts findet sich ein subtiler Hinweis, wie das Problem zu umgehen sei. So wiederholt Francesco Durante die 5. Bassstufe der steigenden Oktavregel, während er die fallende Skala (bei der sich das Lagenproblem nicht in vergleichbarer Weise stellt) kontinuierlich verlaufen lässt.[20] Die Repetition der oktavteilenden Quinte verdeutlicht nicht nur deren gliedernde Doppelfunktion als »intermediary end« und »new beginning«[21], sondern legt zugleich einen Lagenwechsel nahe, der es ermöglicht, die cantizierend auf die 5. und die 1. Bassstufe gerichteten Module der Oktavregel mit der charakteristischen Abfolge von Sext- und Quintsextakkord jeweils idealtypisch zu setzen und gegebenenfalls zu analogisieren.
Sequenzen
Sequenzen bzw. »movimenti« werden, wie vielfach auch in den Quellen, als reine Intervallkonsekutiven über Bässen im Quint- oder Hexachordraum bzw. als Fügungen von drei Sequenzmodulen präsentiert (155–157). Ihre Klassifizierung folgt im Wesentlichen der Systematik des 16. bis 18. Jahrhunderts: Auf steigende und fallende Skalenbässe folgen solche, die auf der regelmäßigen Fortsetzung eines melodischen ›Zick-Zacks‹ bzw. Gegenschrittes beruhen.[22]
Die von den Autoren gewählte Terminologie steht zu heute gängigen Bezeichnungsweisen quer. So beziehen sich beispielsweise die Termini ›Terzfallsequenz‹ oder ›Terzstiegsequenz‹ gemeinhin auf Sequenzen aus terzweise versetzten Gliedern. Die Herausgeber hingegen bezeichnen mit diesen Begriffen Gänge aus alternierenden Terz- und Sekundschritten, die einen übergeordneten Sekundgang figurieren und üblicherweise als ›Sekundfall-‹ oder ›Sekundstiegsequenzen‹ bzw. ›Stufensequenzen‹ angesprochen würden. Damit knüpfen sie an den Sprachgebrauch der italienischen Quellen an, die hier schlicht von einem Gang ›per terze‹ redeten. Bezeichnet wird in dieser Tradition immer der größere Intervallschritt: Ein ›Zickzack‹ aus steigenden Quart- und fallenden Terzschritten wäre demnach ein steigender Gang ›per quarte‹; die Herausgeber sprechen von einem ›Quartstieg sekundweise‹.[23] Freilich ist es keineswegs immer sinnvoll, ›movimenti‹ so zu segmentieren, dass der jeweils größere Intervallschritt des Basses das Sequenzglied bildet: Eine fallende Quintsextakkordkette etwa wird von den Herausgebern als »Terzfall« klassifiziert (Beispiel 6), obwohl die (für das spieltechnische ›Begreifen‹ der Progression zentrale) Koppelung von Dissonanzauflösung und sekundweise steigendem Bass es weitaus naheliegender erscheinen ließe, von einem ›Sekundstieg, sekundweise fallend‹ zu sprechen.[24] (Die Möglichkeit, das Modell auch metrisch verschoben zu gebrauchen, bleibt davon unberührt.)
Beispiel 6: Giovanni Paisiello, Regole, »Vademecum«, 155
Die Reduktion auf dreistimmige Gerüstsätze, in denen die Oberstimmen »oft in Terzen oder Sexten parallelgeführt« (13) werden, überzeugt. Instruktiv sind überdies die Hinweise auf latente Kanonbildungen zwischen Bass und Oberstimmen; modellimmanente Oberstimmenkanons hingegen bleiben unerläutert. Dissonanzenketten werden in der bassbezogenen Darstellung – entsprechend der Systematik in den historischen ›Regole‹ – jeweils als Varianten eines bestimmten ›movimento‹ vorgestellt. Auf die Präsentation alternativer »Bassunterlegungen« einer Vorhaltskette bzw. der kombinatorischen Möglichkeiten, die sich aus der Kontrapunktierung einer Vorhaltskette durch eine Ergänzungsstimme ergeben, verzichten die Herausgeber.[25]
Kleine Stolpersteine im Detail ließen sich leicht ausräumen: Zugunsten metrischer Neutralität erfolgt die Darstellung der meisten Modelle im homorhythmischen Satz ›Note gegen Note‹ (vgl. Beispiel 6). Synkopenketten hingegen als solche auch auszunotieren, würde es dem Lernenden erleichtern, das vertikale Griffmuster und die horizontal-kontrapunktische Konfiguration als Einheit zu begreifen. Weiterhin werden, wohl im Interesse einer systematisch einheitlichen Darstellung der Bassprogressionen, über quint- oder quartweise springenden Bässen springende Richtungsparallelen des Soprans in Kauf genommen.[26] Hier hätte man sich im Rahmen einer pädagogisch motivierten, überaus knappen Sammlung »typische[r] Gerüstsätze« (155) eine erklärende Anmerkung gewünscht.
Modellkomplex oder Harmonielehre? – Überlegungen zum Funktionsbegriff
Es dürfte deutlich geworden sein, dass die Herausgeber mit der Paisiello-Edition nicht allein die praktische Generalbass- und Improvisationslehre befördern möchten. Sie ist Teil eines größeren Diskurses, in dem es (mehr oder weniger explizit) auch um Fachinhalte und Curricula geht. Insbesondere manche Beiträge Ludwig Holtmeiers spiegeln recht deutlich die Vorstellung, die Partimento-basierte Lehre möge künftig den Ort der Harmonielehre herkömmlicher Provenienz einnehmen, mithin zu einer Art ›Leitdisziplin‹ des Theorieunterrichts werden. Vor diesem Hintergrund scheint es nicht unangemessen, die Grenzen einer Buchbesprechung ein wenig zu strapazieren und einen Seitenblick in Holtmeiers Grundsatzartikel »Zum Tonalitätsbegriff der Oktavregel« zu werfen.[27]
Wie wir gesehen haben, präsentieren die Herausgeber die Oktavregel im »Vademecum« zunächst »als Addition von Klauseln« (Beispiele 3 und 4). Varianten der entsprechenden Notenbeispiele finden sich auch in Holtmeiers Studie. In der »›Durchkadenzierung‹ der Skala mittels […] kontrapunktische[r] Kadenzmodelle – allen voran die [Cadenza] Doppia« erkennt er die Geburtsstunde der ›kadenziellen‹ Oktavregel. Im nächsten Schritt wird die Oktavregel dem ›Modelldiskurs‹ enthoben: Ihr zentrales Moment sei die »Lösung« des bassbezogenen Einzelklanges »aus dem tradierten Klauselzusammenhang«.[28] Sodann rettet Holtmeier in einer dialektischen Volte die Harmonielehre gewissermaßen vor sich selbst, indem er all das, was (grundtonbezogene) Harmonielehren gemeinhin zu leisten beanspruchen, der (bassbezogenen) Oktavregel zuweist: Unversehens ist aus der Oktavregel nicht nur eine »›Harmonielehre‹ im modernen Sinne«, sondern auch eine »Theorie harmonischer Funktionalität« geworden:[29]
Die Oktavregel kodifiziert das, was gemeinhin unter Dur-Moll-Tonalität, Kadenzharmonik bzw. ›moderner Tonalität‹ verstanden wird: Mit der Oktavregel wird der Generalbass zur »Harmonielehre« im modernen Sinne. Die Oktavregel löst den Generalbass vom traditionellen Denken in modellhaften (kontrapunktischen) Zusammenhängen ab, sie isoliert den einzelnen ›Klang‹ und führt zu einer bislang unbekannten Vertikalisierung des harmonischen Diskurses: Die Oktavregel ist eine Theorie harmonischer Funktionalität.
Um einen der Oktavregel immanenten Begriff ›harmonischer Funktionalität‹ behaupten zu können, müssten der Oktavregel unter anderem Kategorien zu entnehmen sein, die Aussagen über das kadenzielle ›Verhalten‹ bassbezogener Akkorde erlauben.[30] Holtmeier spricht von der »spezifische[n]« Gestalt der Oktavregel, innerhalb derer die imperfekten Sextakkorde als ›Bewegungsklänge‹, die »nach stufenweiser Fortschreitung« verlangten, melodisch auf den Grundton und die oktavteilende Quinte bezogen seien. Demnach gibt es zwei elementare Funktionen: »Ruheklang« (perfekt) und »Bewegungsklang« (imperfekt). Was bedeutet das beispielsweise für den Sextakkord über der 6. Bassstufe? Er kann, wenn man zunächst nur lineare Bassfortschreitungen in Betracht zieht, tenorisierend in die 5. Bassstufe fallen oder cantisierend in die 1. Bassstufe steigen. Die Skala als tonaler Bezugsrahmen stellt keine Kategorie zur Verfügung, die hinreichend differenziert wäre, diese alternativen ›Verhalten‹ als Ausprägungen einer kadenziellen Funktion zu interpretieren und zugleich vom Verhalten der übrigen Bewegungsklänge abzugrenzen. Allerdings lassen sich die Verhalten, in die 5. Bassstufe zu fallen oder in die 1. Bassstufe zu steigen, als zwei verschiedene Funktionen des Sextakkordes über der 6. Bassstufe verstehen. Demnach läuft jede über die Kategorien Ruhe- und Bewegungsklang hinausgehende Differenzierung auf einen kasuistischen bzw. modellbasierten Funktionsbegriff hinaus.
Satztechnische Spezifizierungen bedeuten zumeist ›Entscheidungen‹ für eines der möglichen Verhalten eines Bewegungsklangs[31], mithin für dessen Funktionalisierung zum ›Element‹ eines bestimmten Zusammenhangs bzw. Fortschreitungsmodells. So wird der Akkord über der 6. Bassstufe regelmäßig durch die Erhöhung der Sexte und die ›welsche Quart‹ (also die Anreicherung zum Terzquartakkord) zur Penultima der 5. Bassstufe bestimmt (bzw. der 2. Bassstufe analogisiert).[32] Aus entsprechenden Spezifizierungen resultiert auch die »zwingende Zuordnung des (dominantischen) Sekundakkordes zur absteigenden vierten Stufe«[33] und »ebenso die des dominantischen Quintsextakkordes zur aufsteigenden siebten Stufe«. In diesen Zuordnungen erkennt Holtmeier ein zentrales »Moment« der »Oktavregelharmonik« – nicht, ohne die Klänge als ›dominantisch‹ zu bezeichnen und damit die ihnen gemeinsame Funktion, kadenzielle Penultima zu sein, an eine harmonisch-grundtonbezogene Kategorie zu binden. Gerade aber die »zwingende« Differenzierung zwischen steigender und fallender Oktavregel zeigt an, dass die Intervallstruktur der charakteristischen Vierklänge keine ›Eigenschaft‹ der Bassstufe (geschweige denn der Skala), sondern ein Moment der konkreten, tonal gerichteten und kontrapunktisch determinierten Fortschreitung ist.[34] Offenbar repräsentiert die Bassskala kein übergeordnetes, regulierendes Prinzip, das über die paradigmatische Fügung linearer Kadenzmodelle bzw. Klauseln hinauswiese: Sie ist nicht das vermittelnde, sondern ein vermitteltes Moment.[35]
Nun wäre gegen einen kasuistischen und modellbasierten Funktionsbegriff nichts einzuwenden. Dieser unterschiede sich, insofern er Gestalt und Bedeutung als Einheit begreift, grundlegend von dem Funktionsbegriff Riemanns, demzufolge jede harmonische Funktion durch eine (potentiell unbegrenzte) Gruppe funktional äquivalenter Gestalten repräsentiert werden kann. Der Umstand, dass die zur Oktavregel verschmolzenen Modelle auch funktionsharmonisch interpretierbar sind, vermittelt nicht die kategoriale Differenz beider Funktionsbegriffe. Holtmeiers Rede von der Oktavregel als »›Harmonielehre‹ im modernen Sinne« und »Theorie harmonischer Funktionalität«[36] läuft Gefahr, diese Differenz zu überdecken, insofern sie nahelegt, die Oktavregel handle von denselben Fragen, bewege sich in demselben ›Geltungsbereich‹ und leiste mehr oder weniger das Gleiche wie jene etablierten Sichtweisen, die mit diesen Termini gemeinhin assoziiert werden: Es scheint, als wollte er den (post-)Riemannschen Begriff harmonischer Funktionalität als herrschendes Paradigma ablösen und zugleich dessen Validität erben.
Nur vor diesem Hintergrund lässt sich verstehen, warum Holtmeier so sehr daran gelegen ist, die Oktavregel vom kontrapunktischen ›Modelldenken‹ zu lösen. Der »entscheidende Unterschied zu den Sequenz- und Kadenzmodellen« liegt ihm zu Folge im »Materialcharakter« der Oktavregel. Denn während jene »als konkrete kompositorische Bausteine gleichsam unmittelbar übernommen [werden] und in der kompositorischen Praxis zur Anwendung gelangen« könnten, verlange die Oktavregel »immer nach rhythmischer Gestaltung.«[37] Mit dieser Entgegensetzung aber stellt Holtmeier das konstitutive Moment des Modellbegriffs in Frage: die Differenz zwischen dem hinsichtlich seiner Bestimmungsmerkmale ›ungesättigten‹ Modell, das »synchronisch wie diachronisch unzählige Realisationsformen« erfahren kann[38], und der Modellinstanz, die »die determinierenden Eigenschaften ihres Typus« erfüllt und »die Eigenschaften, ohne die ein konkretes Exemplar des Typus nicht existieren könnte«[39], ergänzt. Gerade ihre partielle (rhythmische und metrische) Unbestimmtheit kennzeichnet die Oktavregel als Modell (bzw. horizontalen Modellkomplex). Ein Modell, dass nur »unmittelbar übernommen« werden könnte, wäre kein Modell.[40]
Versteht man die Oktavregel hingegen auch in ihrer rhythmisch und metrisch neutralen Form als Modellkomplex, dann rückt der von Holtmeier (und den Herausgebern der Paisiello-Edition) unternommene Rekurs auf die Klausellehre erneut ins Zentrum der Überlegungen. Denn die konstitutiven Momente der Klauselprogression – Stimmführung und tonal gerichteter Sekundanschluss – sind in der »entrhythmisierte[n] ›Zweierbeziehung‹ von Akkorden«[41] bewahrt. Der einzelne Akkord wäre aus dieser Sicht ein aus standardisierten melodisch-kontrapunktischen Zusammenhängen geronnener (d.h. klanglich, nicht aber funktional verselbständigter) Intervallverband; Holtmeier selbst spricht in einem ähnlichen Sinne vom »polyphonic chord«.[42]
Gleichwohl erkennt Holtmeier das »eigentlich Revolutionäre [eigene Hervorhebung]« der Oktavregel in der »Emanzipation der Klänge« vom »Klauselzusammenhang«[43], und das heißt bei ihm: in der Emanzipation vom linearen und metrischen Zusammenhang der viergliedrigen Cadenza doppia.[44] Unberücksichtigt bleibt, dass neben der Doppia auch zwei- und dreigliedrige ›Clausulae harmoniae‹, die sich hinsichtlich der Intervallprogression in die Ultima, nicht aber hinsichtlich der metrischen Ordnung und der Dissonanzeneinstellung mit dem ersten Modul der Doppia überschneiden, Segmente der Oktavregel bilden können.[45] Was Holtmeier als »Emanzipation der Klänge« vom »Klauselzusammenhang« beschreibt, lässt sich als Reduktion verschiedener Klauselformen auf die ihnen gemeinsamen Bestimmungsmerkmale verstehen.[46] Durch den Wegfall weniger konkreter Bestimmungsmerkmale (metrische Position und Modus der Dissonanzeneinstellung) wird die Klauselfortschreitung frei für eine unbegrenzte Zahl neuer Bestimmungen. Die »dialektische Spannung zwischen alter Intervallprogression und ›neuer‹ Corellischer Kadenzharmonik, die als zentrales Moment der Oktavregel herausgearbeitet wurde«[47], wäre demnach durch den Modellbegriff vermittelt:[48] Die eigentliche Pointe der Oktavregel besteht nicht in der »Emanzipation der Klänge«, sondern in der Emanzipation der Klausel zum zentralen Strukturmodell eines ›funktionalen Intervallsatzes‹.[49]
Folgte man dieser Darstellung, dann wäre die ›kadenzielle‹ Oktavregel – um an Holtmeiers eingangs zur Diskussion gestelltes Diktum anzuknüpfen – eine zentrale »Kodifizierung«[50] tonaler, modellbasierter und (in diesem Sinne) funktionaler Klangfortschreitung. Dass sie keine »›Harmonielehre‹ im modernen Sinne«[51] ist, kann man (vor allem aus produktionsästhetischer Sicht) für einen Vorzug halten – und umso gelassener das analytische und hermeneutische Potential herkömmlicher funktions- und stufentheoretischer Ansätze anerkennen, höchst unterschiedliche Gestalten in Äquivalenzklassen zu bündeln sowie größere funktionale Flächen und übergeordnete harmonische Beziehungen zu erfassen.[52]
Resümee
Der erste Band der Publikationsreihe Praxis und Theorie des Partimentospiels bietet nicht allein eine gut gemachte und instruktive Quellenedition. Den Herausgebern gelingt es darüber hinaus, dafür zu sensibilisieren, dass die Partimento-Praxis, sofern man sie nicht allein als Methode der Musikerausbildung betrachtet, sondern auch ihre theoretischen Implikationen in den Blick nimmt, das Verständnis tonaler Musik grundsätzlich berührt. Von den beiden im Reihentitel genannten Aspekten – »Praxis und Theorie« – akzentuieren die Zugaben und Kommentare der Herausgeber besonders den Ersteren, doch kommen jeweils am konkreten Gegenstand zahlreiche Fragen in den Blick, die über die praktische Instruktion hinausweisen. Wer sich stärker für die ›theoretischen‹ Aspekte der Partimento-Tradition interessiert, möge den weiterführenden Hinweisen im Vorwort und den systematischen Implikationen des »Vademecums« nachgehen und gegebenenfalls einen Blick in die Grundsatzartikel Ludwig Holtmeiers (2007 und 2009) oder Robert O. Gjerdingens Music in the Galant Style (2007) werfen. Wer eine historische Didaktik mit progressivem Schwierigkeitsgrad und systematischem Aufbau sucht, wird es vielleicht vorziehen, auf den zweiten Band der Publikationsreihe, Händels Aufzeichnungen zur Kompositionslehre, zu warten oder auf die bereits vorliegende Edition David Ledbetters (1990) zurückzugreifen. Wer jedoch fundierte satztechnische Fertigkeiten und eine gewisse Wendigkeit im Generalbassspiel mitbringt, findet in der Paisiello-Edition nicht nur instruktive Partimenti, die zum Experimentieren mit unterschiedlichen Stilen und Satztypen einladen, sondern auch Kriterien, Anregungen und gute Muster für die eigene Realisierung.
Anmerkungen
Holtmeier 2003, Untertitel. | |
Menke 2010, Abschnitt 3. | |
Die folgenden Zitate finden sich annähernd gleichlautend auch in dem von Ludwig Holtmeier und Felix Diergarten verfassten MGG-Artikel »Partimento« (2008). Sie umreißen dort die drei »Bedeutungsinhalte« des Begriffs (Sp. 653). | |
Relativiert wird diese Pauschalisierung durch den Hinweis, man könne »Francesco Durante (1684–1755) und Leonardo Leo (1694–1744) als schulbildende Gründerväter der eigentlichen [eigene Hervorhebung] Partimento-Tradition« bezeichnen (Paisiello 2008, 10, sowie Holtmeier/Diergarten 2008, Sp. 653). Nimmt man hinzu, dass keine der Quellen, die eine voll ausgebildete ›kadenzharmonische‹ Fassung der Oktavregel – des »Herzstück[s] der neapolitanischen Musiktheorie« (Holtmeier/Diergarten 2008, Sp. 655) – präsentieren, vor 1700 datiert, kann von einer Partimento-Tradition im »eigentlichen« Sinne nicht deutlich vor 1700 die Rede sein. Ebenso bedarf die Rede von der »gesamte[n] italienischen Lehrmethode« der Differenzierung. So wurde beispielsweise im norditalienischen Akademiensystem (mit Bologna als Zentrum und Giovanni Battista [›Padre‹] Martini als wichtigstem Repräsentanten) noch bis ins zweite Drittel des 18. Jahrhundert schwerpunktmäßig Kontrapunkt in der Tradition Zarlinos gelehrt; auch scheint letzterer seine Bedeutung als theoretische Basis des bassbezogenen Paradigmas nie ganz verloren zu haben. | |
Vgl. Holtmeier 2005, 225f., sowie Holtmeier/Diergarten 2008, Sp. 255. | |
Diergarten 2010, 147. | |
Ebd. – Zu den »Besonderheiten des Anfangs der Waldstein-Sonate« zählt Diergarten auch die »›falsche‹ Platzierung der syncopatio auf unbetonter Zeit«. Dies lässt sich nur vor dem Hintergrund verstehen, dass Heinichen, auf dessen Ausführungen er sich bezieht, den Sekundakkord einzig als Syncopatio oder Transitus des Basses erörtert (Heinichen 1728, 160), die Möglichkeit, die über dem Bass durchgehende übermäßige Quart zum Sekundakkord zu ergänzen, jedoch unerwähnt lässt (ebd., 173). In Paisiellos Regole (2008, 71) hingegen finden wir diesen Fall, der, wie die Herausgeber selbst schreiben, ganz »der Praxis des ausgehenden 18. Jahrhunderts entspricht« (ebd., 72, Anm. 13), als selbstverständlich vorausgesetzt. | |
»Die Satzstruktur [der Partimenti] ist fast immer so konzipiert, dass der dreistimmige Kernsatz […] durch eine vierte Stimme klanglich ergänzt werden kann.« (Vorwort, 13) Ludwig Holtmeier (2007, 10) verweist in diesem Zusammenhang sehr treffend auf Georg Muffats Regulae Concentum Partiturae (1699) als »das musiktheoretische Dokument für den modernen (Corellischen) Triosonaten-Kompositionsstil« (»One could point to Muffat’s Regulae concentuum Partiturae [1699] as the theoretical document for the modern [Corellian] trio-sonata style of composition.«) Die dritte Stimme bildet dabei in der Regel die kontrapunktisch profilierte Ergänzungsstimme zu einem zweistimmigen Basismodell – etwa einem einfachen ›Parallelismus‹ oder einer Synkopenkette – oder aber eine ›Mixturstimme‹, die sich dem Bass oder einer Oberstimme in unvollkommenen Konsonanzen anlagert. | |
Vgl. wiederum Muffat 1699 sowie Johann David Heinichens Der General-Bass in der Composition (1728), hier insbesondere den historischen Exkurs (Kap. 2, 130ff., § 29f.) sowie die ausführlichen Anweisungen zur Ausführung des ›vollstimmigen Accompagnements‹ (ebd., 132–137, § 31–38, sowie Kap. 3, 202–235, § 53–79, 244f., § 88, und 253–255, § 94). | |
In diesem Zusammenhang sei auf die wenigen aus dem 18. Jahrhundert überlieferten Realisierungen von Partimenti verwiesen, etwa die überaus instruktiven Beispiele in der Improvisationslehre Johann Gottfried Vierlings (2008) und die in dieser Ausgabe der ZGMTH besprochene Perfidia-Sonate Francesco Durantes (Paraschivescu 2010). | |
Der in der italienischen Musiktheorie des 18. Jahrhunderts gebräuchliche Terminus ›Cadenza doppia‹ bezeichnet eine Synkopenklausel (›Cadenza composta‹), bei der die Antepenultima des Tenor-Diskant-Gerüsts ihrerseits durch eine ›Cadenza semplice‹ erreicht wird. In der Regel wird der Kadenzvorgang durch das Zusammentreffen der ›dominantischen‹ Strebetöne, also der 4. Melodiestufe (Ansatzebene der Doppia-Tenorklausel) und der 7. Melodiestufe (Ansatzebene der Doppia-Diskantklausel) initiiert. | |
Zu den grundlegenden Aspekten der historischen Klausellehre gehört, dass Alt- und Bassklausel im Rahmen des Klauseltausches Modifikationen erdulden müssen, weil es sich bei Ihnen um Ergänzungsstimmen handelt, die mit dem Tenor-Diskant-Gerüst eben gerade nicht im doppelten Kontrapunkt verwechselbar sind: »Zum andern / nimbt je zu Zeiten der Bass deß Tenoris, der Alt deß Discants seine Clausulam an sich / der Discant kan mit dem Bass in decimis herein gehen. Der Tenor aber kan in der letzten noten in der Quint, in penultima in der Terz oder Octav […] über dem Bass stehen.« (Herbst 1643, 63) Ludwig Holtmeier selbst bemerkt andernorts, dass sich »die unfigurierte Bassklausel der Doppia […] nicht über die Tenorklausel […] legen« lässt. Einzig im Rahmen standardisierter Figurationen könne »die 5. Skalenstufe zu einer ›Superjectio‹ der 4. Stufe« werden (Holtmeier 2009, 14, Anm. 30). | |
Allerdings steht – insofern hier ausdrücklich auf den kontrapunktischen Hintergrund der Oktavregel rekurriert wird – die lizenziöse Behandlung der 4. Melodiestufe (mithin des Ansatztons der Doppia-Tenorklausel) in den Takten 3 und 5 in einer gewissen Spannung zum normativen Anspruch der Darstellung. Entsprechendes gilt für die metrische Ordnung der Cadenza doppia in Takt 3. In Ludwig Holtmeiers Artikel »Zum Tonalitätsbegriff der Oktavregel« sind diese Darstellungsprobleme überzeugend gelöst (2009, 14, Beispiele 5a und b). – Vgl. für den gesamten Zusammenhang auch Gjerdingen 1997, Kap. 11, »Clausulae«, 139–176. | |
Vgl. Gjerdingen 2007, Kap. 3, »The Prinner«, 45–60, sowie Rohringer i.V., 246. | |
Noch Paisiello verlangt, Dissonanzen generell als Durchgänge oder Synkopendissonanzen bzw. Ligaturen einzuführen (Paisiello 2008, 68–70; vgl. Holtmeier 2009, 13, Anm. 26). Zwar wird der Quintsextakkord in diesem Zusammenhang nicht eigens angesprochen, doch legen die von Paisiello gegebenen Beispiele auch für den Quintsextakkord eine regelmäßige Vorbereitung der Quinte als Vorhaltsdissonanz bzw. Ligatur nahe. Vgl. dazu Holtmeier/Diergarten 2008: »Die Akkorddissonanz ist in der Partimento-Tradition gleichsam ein autonomes kontrapunktisches Element, das in den Akkordbegriff hineingetragen wird.« (Sp. 655). | |
Zu Emanuel Aloys Försters Begriff der ›besten Lage‹ vgl. Holtmeier i.V. | |
In den Quellen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts hingegen wird die Oktavregel regelmäßig mit jeweils minimierter Oberstimmenmelodik durch allen drei Lagen geführt (vgl. z.B. Fenaroli 1863, Libro 1, 13–18). Paisiellos Regole lassen sich keine Angaben zum Rahmenstimmensatz der Oktavregel entnehmen (2008, 65f.). | |
Soll die Oberstimme hingegen bruchlos verlaufen und in einer Lage beginnen und schließen, ist eine ungelenke Führung der Mittelstimmen unvermeidlich. Vgl. dazu Sanguinetti 2007, 59: »Die einzige problematische Verbindung ist jene zwischen der 5. und der 6. Bassstufe […].« (»The only problematic connection is between 5 and 6 […].«) | |
Zu den festen Griff- und Stimmführungsmustern über dem von der 5. zur 1. Bassstufe steigenden Tetrachord gehört, sofern auf der Oktavlage angesetzt wird, der Stimmtausch zwischen Bass und Tenor, verbunden mit der Verdoppelung des Basstones im Sextakkord über der 6. Bassstufe. | |
Durante 2003, 6, »Modulazione [= ›scala‹] del tono Cesolfaut [do]«; vgl. auch Gasparini 1708, 34. In eine ähnliche Richtung geht Riepels Vorschlag, satztechnische Probleme bei der vierstimmigen ›Aussetzung‹ der einfachen Oktavregel aus Grund- und Sextakkorden dadurch zu vermeiden, dass »die [steigende] Leiter [zwischen der 5. und der 6. Bassstufe] abgeteilet wird« (Riepel 1996, 579). | |
Jans 1997, 121. | |
Vgl. Froebe 2007 und Menke 2009. | |
Zu dieser Bezeichnungsweise vgl. Menke 2009, 97f. | |
Menke betont, die Klassifizierung zweigliedriger Melodiemodelle anhand des jeweils größeren Melodieschritts berücksichtige »nicht die metrische Gewichtung, auch nicht Synkopationen« (ebd.). Gleichwohl könnte es Missverständnisse verhindern helfen, eine Bezeichnungsweise ohne ungewollte Implikationen zu wählen und den kontinuierlichen »Zickzack« (Möllers 1989, 75) oder »Gegenschritt« (Froebe 2007, 15, Anm. 8) des Basses als solchen auch zu bezeichnen (›Terz-Sekund-Zickzack‹ bzw. ›Terz-Sekund-Gegenschritt‹). | |
Vgl. Menke 2009, 103f., Abschnitt 5: »[…] Aus der Syncopatio stammende dissonante Sequenzen«, hier insbes. Abb. 7, 104). | |
Georg Muffat, dessen Darstellung das »Vademecum« in vielem nahesteht, qualifiziert entsprechende Beispiele lapidar als »Schlecht« – was bei ihm nicht im Sinne von ›schlicht‹ zu verstehen ist (1699, 70 und 76, Seitenzahlen des Manuskripts). Eine gewisse Sensibilität in diesen Fragen auszubilden, scheint sinnvoll, ohne dass man deshalb gleich Statistiken über die (sich wandelnden) Gebräuche im 17. und 18. Jahrhundert oder gar eine Grundsatzdebatte um Richtungsparallelen führen müsste. | |
Holtmeier 2009, 14. Holtmeiers Grundsatzartikel, der im Folgenden als Bezugspunkt dient, überschneidet sich teilweise mit einem umfangreicheren englischsprachigen Beitrag (Holtmeier 2007). Einige offenkundig in Hinsicht auf die ›deutsche‹ Harmonielehre-Tradition vorgenommene Akzentuierungen finden sich nur in dem deutschsprachigen Artikel. | |
Holtmeier 2009, 15. | |
Ebd., 11. | |
Der Gedanke, eine Funktion könne einem musikalischen ›Element‹ gewissermaßen als ›Eigenschaft‹ innewohnen, ist, obwohl er als Arbeitshypothese in didaktischen Zusammenhängen bzw. aus einer produktionsästhetischen Perspektive gute Dienste leistet, in erkenntnistheoretischer Hinsicht problematisch. Zu dieser Frage, die hier nicht weiter verfolgt werden kann, vgl. Polth 2001. | |
Vgl. Jans 1997, 122. | |
Vgl. Holtmeier 2009, 18. Das Konzept der ›richtungsgebenden Dissonanz‹ lässt sich auch auf ›praedominantische‹ Akkorde übertragen, die gemeinhin als ›zufällige‹ Dissonanzen bzw. Vierklänge klassifiziert würden. So funktionalisieren der Quintsextakkord über der 6. Bassstufe (→ cantisierend 6-7-8) und der Sekundakkord über der 3. Bassstufe (→ tenorisierend 3-2-1) die jeweiligen Bassstufen zu Klauselantepenultimae. | |
Ebd., 13; das Folgezitat in Anm. 26. | |
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang eine Aussage des Riepelschen ›Discipulus‹: »Mir deucht, es sey diese harmonische Leiter [die Oktavregel mit Grund- und Sextakkorden] unserm Gehöre von Anbeginn der Welt eingepflanzet, nur die Sext-Quinten-Accorde nicht.« (Riepel 1996, 580; vgl. Holtmeier 2007, 14, der jedoch den hier kursivierten Zusatz weglässt). Insofern Riepel seinen Praeceptor im nächsten Satz erwidern lässt, die »Ohren in ganz Europa« seien an eben jene Quintsextakkorde »gewöhnt«, ist diese Aussage keineswegs Ausdruck einer konservativen Ästhetik. Vielmehr impliziert sie eine Unterscheidung zwischen der »Octavleiter« als einer gewissermaßen natürlichen Ordnung von »vollkommen[en]« und »Sexten-Accord[en]«, die sich beliebig (also auch sprungweise) verbinden lassen, und den konkreten, kontrapunktisch determinierten ›Modellen‹, als deren Summe die voll ausgebildete, kadenzielle Oktavregel sich verstehen lässt. Konsequenterweise thematisiert Riepel die Möglichkeit, Quintsextakkorde über der 4. und der 7. Bassstufe einzuführen, im Einzelnen anhand dreischrittiger, jeweils auf die 5. oder die 1. Melodiestufe zielender Bassmodelle (ebd., 581). | |
Vgl. Rohringer i.V., 246, Anm. 100. | |
Holtmeier 2009, 11. | |
2009, 15, Anm. 33. | |
Schwab-Felisch 2007, 297. | |
Ebd., 299. | |
Ebd., 297f., hier die Ausführungen zum Aspekt »Allgemeinheit«. | |
Holtmeier 2009, 16. | |
Holtmeier 2007, 33; vgl. auch Diergarten 2010, insbes. 138. Diergarten expliziert das »Konzept des polyphonen Akkords« ausgehend von Heinichens Erläuterung der Sekunde (als Synkopendissonanz oder Transitus), der darauf aufbauenden »Akkordtypen« und deren Auflösungsmöglichkeiten (ebd., 136–138). Mit Blick auf das »Zusammenwirken von Linie und Klang« im modellbasierten Intervallsatz (ebd., 147) möchte er »Bewegung in die […] Debatte« bringen, »ob […] Akkorde das Ergebnis oder die Voraussetzung von Linien sind« (ebd. 148). Allerdings bleibt die Frage – ›Ergebnis oder Voraussetzung‹ – auch jenseits ihrer »Vermittlung« (ebd. 141) durch den Begriff des ›polyphonen Akkords‹ virulent. Aus Sicht der schenkerianischen Schichtenlehre weist sie auf die Erfordernis einer funktionalen Verhältnisbestimmung, insofern (polyphone) Akkorde der linearen Auskomponierung von Akkorden (›Stufen‹) bzw. Akkordverbindungen (›Stufengängen‹) dienen. Vor diesem Hintergrund lässt sich die Oktavregel als Prototyp der linearen Auskomponierung sowohl eines Akkords (in Gestalt der ›stabilen‹ Bassstufen 1, 3 und 5) als auch des Stufengangs zwischen den ›Ruheklängen‹ über der 1. und 5., sekundär auch der 4. Bassstufe verstehen. | |
Ebd., 15. | |
Die viergliedrige Cadenza doppia lässt sich als aus zwei Klauseln zusammengesetzt denken, deren erste in die unbetonte Antepenultima der Synkopenklausel mündet (dem entsprechen die Bassstufengänge 4-3 und 7-8). Von daher, so Holtmeier, sei die 3. Bassstufe »innerhalb der Doppia-Tenorklausel eigentlich nur ein ›Durchgangsakkord‹ auf schwacher Zeit, Träger einer Vorbereitungskonsonanz für die folgende dissonierende Tenorklausel« (wobei genau genommen nicht die Tenor-, sondern die Diskantklausel dissoniert). Ihre Emanzipation »zum Klang eigenen Rechts« bzw. zu einem relativen »Ruheakkord« (2009, 16) gehe mit einer »weit reichenden Lockerung übergeordneter rhythmischer und linearer Zusammenhänge« einher (ebd. 15). | |
Die althergebrachten, von Johann Gottfried Walther (ausgehend von der Progression des Basses) als »Clausula Tenorizans«, »Clausula Cantizans« und »Clausula Altizans« (1708, 297f.) bezeichneten ›harmonischen Klauseln‹ schließen (in der Regel betont) auf der 1., 3. und (sekundär) 5. Bassstufe. Demnach können die 4. und die 7. Bassstufe nicht allein als Ansatzebenen der Cadenza doppia, sondern auch als lokale Klauselpenultimae fungieren, wobei die fallende 4. Bassstufe als »transitum per ellipsin« aufzufassen wäre (Heinichen 1728, 603f., vgl. auch Holtmeier 2009, 13, Anm. 26). | |
Umgekehrt repräsentieren die jeweiligen Klauseln Instanzen von Oktavregelsegmenten. Oliver Schwab-Felisch (2007, 299) spricht in diesem Sinne von »Abbild« und »Vorbild« als den »zwei Grundrelationen zwischen dem Modell und seinem Bezugsgegenstand« (2007, 299). Inwieweit die umkehrbare Vorbild-Abbild-Relation (synchron) mit strukturellen Schichten des Satzes und (diachron) mit entwicklungsgeschichtlichen Stadien der musikalischen ›Sprachentwicklung‹ korreliert, ist eine zentrale Frage, in der Denkweisen der historischen Musiktheorie, der Modelldiskurs und die schenkerianische Schichtenlehre einander berühren. | |
Holtmeier 2009, 19. | |
Mit der Rede von »Intervallprogression« und »Corellischer Kadenzharmonik« (ebd.) ruft Holtmeier die Denkfigur einer Dichotomie von Kontrapunkt (bzw. Intervallsatz) und Harmonik auf. Dies scheint verzichtbar, insofern hier mit ›Intervallprogression‹ und ›Harmonik‹ eigentlich nur zwei graduell verschiedene ›Dimensionen‹ (vgl. ebd.) des bassbezogenen Intervallsatzes gemeint sein können. | |
Damit wird die ›harmonische Klausel‹ zu einer »Voice-leading Matrix« (Renwick 1995, 81, für den gesamten Zusammenhang vgl. ebd., Kap. 3, »Invertible Counterpoint«, 79–108), die sich mittels verschiedener Transformationstechniken – Klauseltausch, Mixturenanlagerung bzw. Klangfüllung und kontrapunktische Fundierung – in der Oktavregel vervielfacht. Insofern melodische Einkadenzierung (bzw. Tonnachbarschaft) und intervallischer Spannungsverlauf funktionale ›Prinzipien‹ der Klauselbildung darstellen, sind bassbezogene Intervallstruktur und Bassfortschreitung nur Teilmomente der Funktionalität ›polyphoner Akkorde‹. Das Prinzip des Klauseltauschs ermöglicht es, funktionale Schnittmengen zwischen Klängen über verschiedenen Bassstufen zu bestimmen, ohne dass es eines Rekurses auf Akkordgrundtöne bedürfte (vgl. Holtmeier 2007, 34f., sowie »The function of chord tones«, ebd., 38ff.). Hier liegen Anknüpfungspunkte für eine kritische Dekonstruktion des herkömmlichen Begriffs harmonischer Funktionalität, denn der Gedanke, dass melodische Beziehungen als Tonnachbarschaften in Akkorden ›aufgehoben‹ und konstitutiv für deren Funktionalität seien, dürfte seit Carl Dahlhaus’ Untersuchungen (1968) fester Bestandteil einer ›aufgeklärten‹ Funktionstheorie sein. | |
Holtmeier 2009, 11. | |
Ebd. | |
Zum hermeneutischen Potential harmonischer Systeme des ausgehenden 19. Jahrhunderts vgl. Jeßulat 2007; zur Integration des Konzepts der ›Auskomponierung‹ in die funktionsharmonische Analyse vgl. Redmann 2009, 65–69. |
Literatur
Dahlhaus, Carl (1968), Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität, Kassel u.a.: Bärenreiter.
Diergarten, Felix (2010), »›Ancilla Secundae«. Akkord und Stimmführung in der Generalbass-Kompositionslehre«, in: Musik und ihre Theorien. Clemens Kühn zum 65. Geburtstag, hg. von Felix Diergarten, Ludwig Holtmeier, John Leigh und Edith Metzner, Dresden: Sandstein, 132–148.
Durante, Francesco (2003), Bassi e Fughe, Ms. Neapel o.J., Neudruck Padua: Armelin Musica.
Fenaroli, Fedele (1863), Partimenti, ossia basso numerato, Florenz, Reprint Bologna: Forni 1967 (= BMB IV/61).
Förster, Emanuel Alois (1818), Emanuel Alois Förster’s Practische Beyspiele als Fortsetzung zu seiner Anleitung des Generalbasses, erste Abtheilung, Wien: Artaria.
Froebe, Folker (2007), »Satzmodelle des ›Contrapunto alla mente‹ und ihre Bedeutung für den Stilwandel um 1600«, ZGMTH 4/1–2, 13–56. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/244.aspx
Gasparini, Francesco (1708), L’Armonico Prattico al Cimbalo, Venedig, Reprint New York: Broude Brothers 1967.
Gjerdingen, Robert O. (2007), Music in the Galant Style, Oxford: Oxford University Press 2007.
Heinichen, Johann David (1728), Der Generalbaß in der Composition, Dresden, Reprint Hildesheim u.a.: Olms 1994.
Herbst, Johann Andreas (1643), Musica poetica, sive Compendium melopoëticum […], Nürnberg, Mikrofiche Leiden: IDC.
Holtmeier, Ludwig (2003) »Von der Musiktheorie zum Tonsatz. Zur Geschichte eines geschichtslosen Faches«, ZGMTH 1/1, 11–34. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/481.aspx
––– (2005), »Gedanken zur praktischen Harmonielehre im 19. Jahrhundert«, in: Musiktheorie, (= Handbuch der systematischen Musikwissenschaft 2), hg. von Helga de la Motte-Haber und Oliver Schwab-Felisch, Laaber: Laaber.
––– (2007): »Heinichen, Rameau and the Italian Thoroughbass Tradition: Concepts of Tonality and Chord in the Rule of the Octave«, Journal of Music Theory 51/1, 5–49.
––– (2009), »Zum Tonalitätsbegriff der Oktavregel«, in: Systeme der Musiktheorie, hg. von Clemens Kühn und John Leigh, Dresden: Sandstein, 7–19.
––– (i.V.), »Emanuel Aloys Förster und das Wiener Partimento. Zum Prinzip der besten Lage«, in: Im Schatten des Kunstwerks. Komponisten als Theoretiker in Wien vom 17. Jahrhundert bis Anfang des 19. Jahrhunderts, hg. von Dieter Torkewitz, Wien: Universität für Musik und Darstellende Kunst.
Holtmeier, Ludwig / Felix Diergarten (2008), »Partimento«, in: Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. Aufl., hg. von Ludwig Finscher, Supplement, Kassel u.a.: Bärenreiter, 653–659.
Jans, Markus (2007), »Towards a History of the Origin and Development of the Rule of the Octave«, in: Towards Tonality. Aspects of Baroque Music Theory (= Collected Writings of the Orpheus Institute 6), Leuven: Leuven University Press, 119–143.
Jeßulat, Ariane (2007), »Harmonische Systeme des ausgehenden 19. Jahrhunderts und ihre Anwendung auf die Musik Richard Wagners«, ZGMTH 4/3, 261–273. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/260.aspx
Ledbetter, David (1990), Continuo Playing According to Handel: His Figured Bass Exercises, Oxford/New York: Oxford University Press (= Early music series 12).
Menke, Johannes (2009), »Historisch-systematische Überlegungen zur Sequenz seit 1600«, in: Passagen. Theorien des Übergangs in Musik und anderen Kunstformen, hg. von Christian Utz und Martin Zenck (= musik.theorien der gegenwart 3), 89–113.
––– (2010), »Brauchen wir einen Kanon in der Musiktheorie?«, ZGMTH 7/1. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/507.aspx
Möllers, Christian (1989), »Analyse durch Improvisation. Chaconnebässe der Barockzeit als Improvisationsmodelle«, Üben und Musizieren 6, 73–86.
Muffat, Georg (1699), Regulae concentuum partiturae, Ms., hg. von Hellmut Federhofer als: An Essay on Thoroughbass (= Musicological Studies and Documents 4), Dallas: American Institut of Musicology 1961. http://www.bassus.cmusge.ch
Paraschivescu, Nicoleta (2010), »Francesco Durantes Perfidia-Sonate. Ein Schlüssel zum Verständnis der Partimento-Praxis«, ZGMTH 7/2.
Polth, Michael (2001), »Ist die Funktionstheorie eine Theorie der Funktionalität?«, Musiktheorie 16/4, 319–324.
Redmann, Bernd (2009), »Funktionstheorie«, in: Systeme der Musiktheorie, hg. von Clemens Kühn und John Leigh, Dresden: Sandstein, 56–69.
Renwick, William (1995), Analyzing Fugue: A Schenkerian Approach, New York: Pendragon Press.
––– (2001), The Langloz Manuscript: Fugal Improvisation through Figured Bass, Oxford/New York: Oxford University Press.
Riepel, Joseph (1996), »Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst«, Kap. 6 »Vom Contrapunkt«, Ms. o.J., in: Joseph Riepel, Sämtliche Schriften zur Musiktheorie, Wien u.a.
Rohringer, Stefan (i.V.), »Von der Oktavzugmusik zur Terzzugmusik: Die Salzburger Notenbuchtradition und die Geschichte der Ursatz-Tonalität«, Kolloquium: Funktionale Kunstanalyse. Bildende Kunst. Musik. Literatur. 22.–24. November 2007, Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, hg. von Bernhard und Bruno Haas, Hildesheim u.a.: Olms, 203–260.
Sanguinetti, Giorgio (2007), »The Realization of Partimenti. An Introduction«, Journal of Music Theory 51/1, 51–83.
Schwab-Felisch, Oliver (2007), »Umriss eines allgemeinen Begriffs des musikalischen Satzmodells«, ZGMTH 4/3, 291–304. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/262.aspx
Vierling, Johann Gottfried (2008), »Versuch einer Anleitung zum Präludieren für Ungeübtere mit Beispielen erläutert«, Neudruck der Ausgabe Leipzig 1794, ZGMTH 5/2–3, 375–394. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/313.aspx
Walther, Johann Gottfried (1708), Praecepta der Musicalischen Composition, Ms. Weimar, Neudruck hg. von Peter Benary, Leipzig 1955 (= Jenaer Beiträge zur Musikforschung 2).
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.