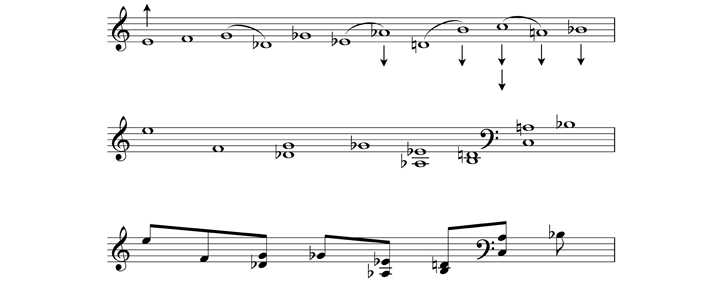Hörbarkeit der Musik des 20. Jahrhunderts
Dargestellt am Beispiel der Dodekaphonie
Hubert Moßburger
Die Frage, bis zu welchem Grad die einzelnen Elemente in der Musik hörbar sein sollen, erscheint besonders in bezug auf die Musik des 20. Jahrhunderts brisant. Unter der klassizistischen Voraussetzung, alles an der Musik müsse restlos hörbar sein, wurde das Kriterium der Hörbarkeit oft gegen scheinbar nur erdachte musikalische Strukturen des 20. Jahrhunderts gewendet. Geschichte und Analyse des Hörbarkeitskriteriums zeigen jedoch, daß der Anteil des akustisch Unhörbaren, wie z. B. mathematische Strukturen oder virtuelle Konstruktionen, schon immer integrierender Bestandteil von Musik war. So steht beispielweise in der Dodekaphonie die Reihe als strukturbildende Determinante ebenso im wahrnehmungsästhetischen Hintergrund wie die funktionale Harmonik in tonaler Musik, welche sich dem Hörer eher in ihren Konsequenzen mitteilt. In beiden Fällen kann jedoch der Hörer über die rein sinnliche Erfahrung hinaus zu einer geistigen Durchdringung des musikalischen Materials fortschreiten. Um ein angemessenes Hören zu gewährleisten, müssen insbesondere bei Neuer Musik verschiedene Grade von Hörbarkeit berücksichtigt werden. An den ersten Takten der Gigue aus Schönbergs Suite für Klavier op. 25 werden zwei entgegengesetzte Hörweisen demonstriert: In den Takten 1–4 kann – nach einer hier erstmals vorgestellten Methode – die Reihe und ihre musikalische Ausformung Schritt für Schritt hörend nachvollzogen werden; die Takte 5–9 laden zu einem »Gruppenhören« ein, wie es von Stockhausen an seinem Klavierstück I demonstriert wurde. Wird das Kriterium der Hörbarkeit als ästhetisches Werturteil benutzt, ist zu bedenken, daß Genauigkeit (Ton-für-Ton-Hören) und intendierte Ungenauigkeit (Gruppenhören) zwei extreme, jedoch gleichwertige Positionen des Hörens darstellen, die unendliche Zwischenstufen erlauben.
Das Problem der Hörbarkeit bzw. der Nicht-Hörbarkeit von Musik ist so alt wie das Nachdenken über Musik selbst: der seit der Antike bis ins Mittelalter andauernde Streit über die Frage, ob Sphärenmusik akustisch zu vernehmen sei oder nicht; die im Spätmittelalter erfolgte Übersteigerung der Ars nova durch eine weitgehende Verfeinerung der rhythmischen Notation in der Ars subtilior; die mathematische Schönheit der Proportionskanons des 15. Jahrhunderts, die als solche nur auf dem Papier wahrzunehmen ist; die Zahlensymbolik Johann Sebastian Bachs; das nur Erahnbare romantischer Polyphonie, beispielsweise in Form der notierten, jedoch nicht mitzuspielenden »inneren Stimme« der Humoreske op. 20 von Robert Schumann, und schließlich die undurchhörbaren komplexen Strukturen der Musik des 20. Jahrhunderts. Auf Phasen der musikalischen Komplizierung, welche den Anteil des Hörens verringerten, folgten in der Musikgeschichte immer wieder solche der Vereinfachung zugunsten einer alles umfassenden Hörbarkeit. Für das 20. Jahrhundert wären zwei zu nennen: der im zweiten Dezennium in der Schönbergschule vorherrschenden freien Atonalität stellte sich der Neoklassizismus der 20er und 30er Jahre entgegen, und auf das Fortschrittsdenken des ›Materialstand-Komponierens‹ reagierte die Bewegung der sog. ›Neuen Einfachheit‹ um 1975. An dem Wechselspiel von Komplizierung und Vereinfachung der musikalischen Sprache kann die Geltung dessen, was und wieviel an der Musik jeweils hörbar sein soll, abgelesen werden. Das Kriterium der Hörbarkeit unterliegt also wechselnden historischen Akzentuierungen, ebenso wie die Hörweisen von Musik selbst geschichtlichen Veränderungen unterworfen sind.
Die aus der Polemik des Klassizismus gegen die barocke und manieristische Kunst stammende Vorstellung, Musik müsse, um als solche überhaupt gelten zu können, restlos und ausschließlich hörend realisiert und verstanden werden, erscheint bis heute in den Köpfen nicht nur von Laien und musikalischen Analphabeten unausrottbar verwurzelt. Dabei führt vor allem der Hinweis auf überschüssige, nicht hörbare Intentionen moderner Komponisten zur ablehnenden Haltung. Offensichtlich genügt es nicht, darauf aufmerksam zu machen, daß das Kriterium der Hörbarkeit »kein Naturgesetz der Ästhetik, sondern ein Postulat von geschichtlich begrenzter Reichweite ist« (Dahlhaus 1970, 63). Denn schon ein Jahr später versuchte der berüchtigte Federhofer-Wellek-Test empirisch nachzuweisen, daß die Änderungsempfindlichkeit, die sich im Hörvergleich des Originalsatzes mit einer Version veränderter Tonhöhen zeigt, bei atonaler Musik viel geringer sei als bei tonaler Musik, »was zugleich die Zwölftontechnik illusorisch« mache (Federhofer/Wellek 1971, 273). Abgesehen von dem verqueren Vergleich und seiner abstrusen Folgerung, »der entscheidende Schritt zur heutigen Zufallsmusik [sei] von der Dodekaphonie vollzogen worden« (ebd., 276), zeigt der heftig umstrittene Test, daß das mißverstandene Kriterium der Hörbarkeit hartnäckig zur Diskreditierung und Polemik gegen Neue Musik mißbraucht wurde und wird.
Um dem entgegenzuwirken oder vorzubeugen, sollte der Begriff der Hörbarkeit zunächst einer differenzierten Analyse unterzogen und dann genau definiert werden, was er eigentlich bedeutet und worauf er zielt. Hörbarkeit umfaßt zweierlei: Zum einen hat sie eine rein akustisch-physikalische Bedeutung. Die Entscheidung darüber, ob etwas gehört wird oder nicht, liegt zunächst entweder jenseits oder diesseits der Hörschwelle dynamisch wahrnehmbarer Schallwellen. Das Jenseits der Hörschwelle umfaßt das akustisch Nichtklingende, das jedoch entweder (z. B. einen Notentext oder eine musikalische Graphik) lesend oder frei assoziierend (z. B. bei komponierten Leerstellen) imaginiert werden kann. Diesseits der Hörschwelle meint das aus dem musikalischen Kontext konkret Heraushörbare. Zwischen beiden Hörebenen existieren jedoch auch Zwischenwerte wie beispielsweise unhörbare Strukturen oder virtuelle Konstruktionen. Unhörbare Strukturen sind Erscheinungen, deren Existenz zwar nicht als solche wahrgenommen wird, ihre Abwesenheit jedoch empfindlich bemerkt würde (man denke nur an Oktavverdopplungen im Orchestersatz oder an latent wirkende musikalische Ordnungssysteme). Aus »virtuellen Konstruktionen« (de la Motte-Haber 1994, 189) erschließt sich dagegen oftmals ein von der tatsächlich notierten Struktur abweichendes akustisches Ergebnis. In seinen Atmosphères benutzt Ligeti beispielsweise das psychologisch wirksame Gestaltgesetz der Nähe, um die in kurzer zeitlicher Abfolge notierten Stimmen im Ohr zur Quasi-Simultaneität verschmelzen zu lassen. Das Ohr fungiert dabei gleichsam als »Mischpult« (ebd. 182).
Zum anderen schließt Hörbarkeit neben der akustischen auch eine mentale Bedeutungsebene ein, die auf erkennendes Verstehen zielt. Gemäß der Goetheschen Maxime, »man hört doch nur, was man versteht«, unterscheidet sich das erkennende Hören vom bloßen Rezipieren durch einen kreativen Akt. Verstehen bedeutet aber nicht nur die Aktivierung bereits vorhandener »mentaler Repräsentationen« (Gruhn 2000, 196), bei denen ›etwas als etwas‹ erkannt wird, sondern es schließt auch die Möglichkeit des Hinzulernens ein. »Wir hören«, kognitionspsychologisch gesprochen, »mit erlernten, daher wandelbaren Kategorien« (de la Motte-Haber 1985, 83). Das Hörbare ist also nicht der Musik wie selbstverständlich inbegriffen, es muß vielmehr erst aktiviert werden. Im Verstehen treffen wahrnehmendes Subjekt und Werkintention des Komponisten zusammen, vorausgesetzt der Hörer bewegt sich auf das Werk zu und versucht, seine Hörstruktur der Werkstruktur anzupassen.
Akustische und mentale Hörebene wirken im angemessenen Hören ineinander. Angemessenes Hören heißt, sowohl die physiologischen und psychologischen Funktionsweisen des Gehörs zu berücksichtigen, als auch geeignete Wahrnehmungskriterien für das zu hörende Werk zu finden. Versucht man beispielsweise, eine der 56 Stimmen des Tonhöhenkanons aus Ligetis Atmosphères herauszuhören, mißversteht man diese Musik und leitet womöglich daraus ästhetische Fehlurteile ab. Angemessenes Hören würde demgegenüber bedeuten, sich dem mikropolyphonen, d. h. innerlich bewegten Klangstrom hinzugeben und dessen wechselnde Atmosphären zu erleben. Der Begriff der Hörbarkeit impliziert also einen Komplex verschiedener, ineinandergreifender Bedeutungsebenen, die vom Unhörbaren, jedoch Imaginierten über Virtuelles und spezifisch Faßbares bis hin zu erkennenden Verstehensprozessen reichen.
Im folgenden werden die Probleme der Hörbarkeit am Beispiel der Dodekaphonie konkretisiert und einige didaktische Überlegungen zur Gehörbildung angestellt. Die Frage, welche Bedeutung die Reihe (als sog. Grundgestalt) für das Hören dodekaphoner Musik hat, ist bislang in keiner Schrift zur Hörerziehung differenziert behandelt worden. Entweder werden Zwölftonreihen als Übungsobjekte für einen gesteigerten Schwierigkeitsgrad im Intervallhören benutzt oder aber ihre Verwendung als Melodiediktat kurzerhand abgelehnt. Zwei Aspekte sind es, die für die Erörterung dodekaphoner Hörrelevanz eine entscheidende Rolle spielen: zum einen das Verhältnis von Technik und Ausdruck und zum anderen das Kriterium der Genauigkeit, die Frage also, ob ein Ton-für-Ton-Erkennen sinnvoll ist.
Technik und Ausdruck
Kein Komponist der Zweiten Wiener Schule versäumt es, auf den Vorrang der Ästhetik, des Expressiven seiner Musik vor dem System und der Technik hinzuweisen. Arnold Schönberg hat stets betont, daß es bei der Rezeption von Musik darauf ankomme, »was es ist« und nicht »wie es gemacht ist«; seine Werke seien »Zwölfton-Kompositionen, nicht Zwölfton-Kompositionen«. Technik wird in den Hintergrund gerückt oder gar vor der Öffentlichkeit verborgen. Beim Anhören seiner Musik sollten nach Schönberg »die Theorien […], die Zwölftonmethode« vergessen werden, letztere sei »eine reine Familienangelegenheit«. Dem Verdecken der Reihentechnik entspricht die kompositorische Grundregel, daß das Reihenende nicht mit der musikalischen Phrasierung bzw. Zäsurierung zusammenfallen sollte, damit der musikalische Fortgang nicht mit der Mechanik der Reihe identifiziert werden kann.
Die Gründe für die Bemühungen, die Technik in den Hintergrund zu rücken, sind apologetischer Natur. Schönberg und seine Anhänger waren zu ihrer Zeit massiv dem Vorwurf des kalten Konstruktivismus ausgesetzt, vor dem sie sich durch die Akzentuierung des Musikalisch-Expressiven schützen wollten. Aus den apologetischen Gründen kann jedoch nicht die Irrelevanz der Reihe für das Hören gefolgert werden. Heute wissen wir um den musikalischen Kunstwert der Meisterwerke jener Zeit und können uns vorurteilsloser wieder dem strukturellen Hören zuwenden, und zwar solchem Hören, das dem ästhetischen Zugang nicht entgegensteht, sondern ihn stützt und fördert.
Die Frage, ob und inwiefern eine im Hintergrund wirkende Kompositionstechnik wie die Reihenkomposition für das Hören überhaupt zugänglich gemacht werden soll, ist prinzipiell nicht anders zu beantworten als in bezug auf tonale Musik: Versteht man unter Hörerziehung die Steigerung der Wahrnehmungsfähigkeit, dann gehört dazu auch die Hebung latenter musikalischer Strukturen und Ordnungen ins hörend-verstehende Bewußtsein. Die Reihe, die kein Thema, sondern vorgeformtes Tonmaterial ist, das als latente Ordnungskraft wirkt, kann in Analogie zur Harmonik tonaler Musik betrachtet werden. Funktionsharmonik als weitgehend determiniertes, im musikalischen Hintergrund wirkendes System teilt sich dem Hörer zunächst nur in ihren Konsequenzen mit. Der bloße Eindruck von Stimmigkeit, die gefühlte Struktur wird in dem Moment ins Bewußtsein gehoben, wenn man seine Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand richtet, was über das rein Sinnliche hinaus intellektuelle Anstrengung fordert. Für die Gehörbildungspraxis bedeutet dies, daß eine Reihe ebensowenig wie die Harmonik aus einem komplexen Satz herausgehört werden muß; vielmehr sollte dies behutsam erfolgen: Wie die Reduktion tonaler Musik auf ein rein harmonisches Akkordsubstrat, dessen musikalisch-reale Ausformung schrittweise erarbeitet werden kann, fungiert die Reihe als musikalische Essenz, die erst durch andere Parameter wie Rhythmus oder Oktavierung zu musikalischem Ausdruck gelangt. Aufgrund ihrer Analogie zur ebenfalls präformierten tonalen Harmonik kann die Reihe vor allem bei mehrstimmiger Ausarbeitung vor der eigentlichen Hörarbeit bekanntgegeben werden, da in beiden Fällen der Ausgangspunkt der wissende Hörer ist. Das Technische ist also in dodekaphoner Musik nicht mehr und nicht weniger als in tonaler Musik ein Moment des Hörbaren.
Genauigkeit
Hörbarkeit wird häufig fälschlicherweise mit Genauigkeit gleichgesetzt. Die Forderung, jede Note eines Werks müsse gehört werden können, gilt jedoch nicht uneingeschränkt für alle Musik. Genauigkeit kann sogar, wie oben am Beispiel der Atmosphères von Ligeti angedeutet wurde, inadäquat sein. Zu differenzieren ist daher in verschiedene Grade von Hörbarkeit. Für die dodekaphone Musik sind zwei entgegengesetzte Tendenzen zu beobachten, die unterschiedliche Hörweisen erfordern: Atomisierung und Gruppierung.
Voraussetzung für eine genaue Hörbarkeit der Reihentechnik in einem Werk sind die Transparenz des Satzes, die enge Bindung an das Reglement der Zwölftontechnik, die Verwendung von nur einer oder allenfalls zwei unterschiedlichen Reihengestalten gleichzeitig und die annähernde Deckungsgleichheit von Reihen- und Kompositionsstruktur. Sind eine oder mehrere Bedingungen nicht gegeben, so kippt die Atomisierung in Gruppierung der Parameter um. Der dann adäquate Hörbarkeitsgrad der ›Ungenauigkeit‹ darf jedoch nicht mit Hörvergröberung verwechselt werden. Denn zum einen treten in komplexen Satzgebilden die einzelnen Parameter in eine dichtere Wechselbeziehung zueinander, die eine Trennung sinnlos erscheinen läßt, dagegen aber die Wahrnehmung auf das Ganze richtet. Zum anderen wird hier die klassische Parameterhierarchie vom Primat der Tonhöhe zugunsten der sonst peripheren Eigenschaften wie Intensität, Klangfarbe und Artikulation verschoben. Der melodische Nachvollzug der Reihe verliert seinen Sinn, wird sogar unmöglich gemacht.
Die Parameterverschiebung wird einerseits in dem von Schönberg geprägten Begriff der »Klangfarbenmelodie(en)« (Schönberg 1986, 504) evident. Andererseits hat Karlheinz Stockhausen in der von ihm so benannten Gruppenkomposition eine Möglichkeit gefunden, die punktuelle Atomisierung und Vereinzelung von Tönen in ein strukturiertes Ganzes zu integrieren. Durch die Gruppe, die Stockhausen als »eine bestimmte Anzahl von Tönen« definiert, »die durch verwandte Proportionen zu einer übergeordneten Erlebnisqualität verbunden sind« (Stockhausen 1963, 63ff.), entsteht ein ›Gesamthörbild‹, das nicht ›das einzelne Intervall‹, sondern hörrelevantere Momente wie Bewegungsformen, Dichten, Geschwindigkeitsgrade, Klangformen, Lagenverteilung, Lautstärke und Dauer erleben läßt. Die gegenüber dem Punktualismus in den Vordergrund rückende sinnliche Wahrnehmung der Gruppenkomposition zeigt sich auch darin, daß Stockhausen seinen Text von 1955 als »Anleitung zum Hören« verfaßt, wie es im Untertitel heißt. Stockhausen zeigt nicht nur an seinem Klavierstück I »dem Hörer einen der vielen möglichen Wege, wie man sich heutige Musik erhören kann«, sondern er demonstriert die Adäquatheit des Gruppenhörens auch an Anton Weberns Variationen für Klavier op. 27. In der Tat ist diese Hörmethode auf einen Großteil der Neuen Musik anwendbar. Als Methode schafft das Gruppenhören dort, wo Genauigkeit in Form präziser Reproduktion inadäquat ist, eine gleichwertige Alternative von Hörbarkeit.
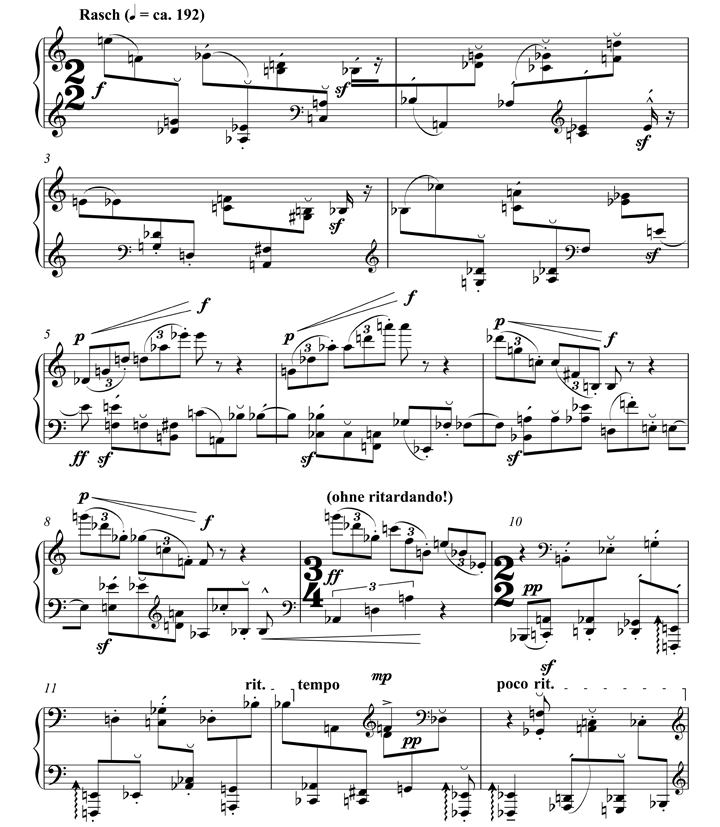
Am Beginn der Gigue aus der Suite für Klavier op. 25 von Arnold Schönberg kann die Hörrelevanz der Reihe in unterschiedlichen Hörbarkeitsgraden nachvollzogen werden (Bsp. 1). Der erste Höreindruck des Chaotisch-Toccatenhaften weicht nach Bekanntgabe der zugrundeliegenden Reihe einer deutlichen, ja geradezu schematischen Ordnung. Denn die ersten vier Takte erfüllen sämtliche Voraussetzungen für einen sinnvollen Nachvollzug der Reihe: Es wird jeweils nur eine Reihenform simultan und sukzessiv verwendet, der Satz ist durchsichtig, und es gibt keine Reihenbrechung oder Permutation von Tönen. Das hörfälligste Merkmal ist jedoch die durch die Tonrepetition und das abgerissene Sforzato deutlich markierte Reihenabgrenzung, die durch den Taktstrich auch visuell bezeichnet wird. Schönberg verletzt dabei die Regel der Überlappung von Reihenende und komponiertem Phrasenbeginn zugunsten einer geradezu ostentativen Hörbarkeit.

In fünf Schritten sei am ersten Takt angedeutet, wie die musikalische Ausformung der Reihe hörend erarbeitet werden kann (Bsp. 2). Zunächst wird die Reihe entweder als Ton-für-Ton-Diktat oder in bereits ausnotierter Form bekanntgegeben. Dann sind die übereinandergeschichteten Reihentöne zu kennzeichnen (hier durch Bögen). In einem weiteren Schritt werden die Oktavlagen durch Pfeile markiert und anschließend das bisher Erarbeitete notiert. Danach erfolgt die Rhythmisierung der Reihe, die – in erstaunlicher Abweichung von der vorgegebenen Taktart – ein an Bartók erinnerndes 8/8-Metrum in der ungewöhnlichen Aufteilung 3+2+2+1 artikuliert. Schließlich ist das musikalische Ergebnis in sinnvoller, spielpraktischer Partituranordnung zu notieren. Bei langsameren Stücken kann die Reihe während des Vorspiels des Originals nachvollzogen werden, und zwar zunächst singend (die Zweiklänge entweder in doppeltem Tempo oder auf zwei Personen verteilt), dann innerlich hörend. Dabei wird die Dialektik von reihenmäßiger Bindung und musikalisch gestalteter Freiheit unmittelbar einsichtig. Und vielleicht ist die Reihe unter wahrnehmungsästhetischem Gesichtspunkt jener »inneren Stimme« ähnlich, die Robert Schumann im polyphon-verschlungenen Satz seiner Humoreske op. 20 nur visuell andeutete.
In den Takten 5–9 ist mit Ausnahme der deutlich artikulierten Trennung der Reihenabläufe keine der Voraussetzungen erfüllt, um ein sinnvolles Reihenhören zu ermöglichen. Der sich verdichtende, die Reihentechnik sehr frei anwendende Abschnitt erfordert einen anderen Grad von Hörbarkeit als die vorangegangenen Takte: Seine Komplexität lenkt das Hören vom Detail auf das Ganze. Die klar voneinander abgegrenzten, in Rhythmik, Dynamik und Satzart identischen Takte lassen ein Gruppenhören angemessen erscheinen, wie es von Stockhausen an seinem Klavierstück I und an den Webern-Variationen exemplifiziert wurde. Die fünf Gruppen unterscheiden sich hörbar vor allem in ihrer tendenziellen Bewegungsrichtung und in ihrer Lage. Die Gliederung des Gruppenverbandes in 2+3 Takte ergibt sich durch die zweimalige Auseinanderbewegung der beiden Hände in T. 5 und 6 einerseits und durch das Zusammenlaufen der Takte 7–9 andererseits. Der neunte Takt führt als auskomponiertes Ritardando der linken Hand zu einem Abschnitt, der an den Anfang erinnert. Trotz derselben, an sich transparenten Setzweise klingt dieser Teil aufgrund seiner extrem tiefen Lage im Pianissimo wie ein entferntes, dumpf-grübelndes Echo des Beginns. Selbst in diesem wieder streng reihentechnisch konzipierten Teil übertönt die sinnliche Wirkung die Konstruktion.
Ungeachtet ihrer wahrnehmungsästhetisch effektvollen Außenseite, die im übrigen auch ohne jegliches erkennendes Verstehen wirksam ist, bleibt die Reihe weiterhin für den wissenden Hörer spürbar. Und zwar nicht Ton für Ton, sondern in der Physiognomie ihrer erstmaligen musikalischen Ausgestaltung, die sich für das Folgende auswirkt: in der Motivik der entwickelnden Variation, in der sukzessiven wie simultanen Intervallstruktur und im Bewegungsgestus. Die Reihe wird also in solchen komplexen Teilen nicht hörirrelevant, sondern sie erscheint in einem mittleren Hörbarkeitsgrad zwischen bewußtem, präzisierendem Erkennen und bloß gefühlter Struktur.
Folgende Schlüsse lassen sich aus dem Gesagten ziehen: Erstens bedeutet angemessenes Hören, zwischen verschiedenen Graden von Hörbarkeit zu differenzieren und diese adäquat anzuwenden. Ziel der Hörerziehung ist es demnach, den Hörer nicht nur in unterschiedlich abgestuften Aufgabenstellungen an das Werk heranzuführen, sondern ihm die Fähigkeit zu vermitteln, eigenständig den Grad der Hörbarkeit zu bestimmen, um dabei ein angemessenes Hören selbst zu finden. Zweitens bringen die Bemühungen um Hörbarkeit Neuer Musik unschätzbare Vorteile mit sich: Gegenüber dem Hör-automatismus und der Selbstverständlichkeit tonaler Musik ist der Hörer der Musik des 20. Jahrhunderts zu erhöhter Aufmerksamkeit angehalten; das nicht leicht Durchhörbare Neuer Musik schützt vor Abnutzung und Ausbeutung; die Erfahrungen an Neuer Musik lassen Alte Musik neu erleben; schließlich birgt das Hören Neuer Musik eine Chance auf Erneuerung des Menschen selbst. Aus alten Gewohnheiten ausbrechen, sich selbst relativieren, verändern, das Andere, Fremde verstehen, akzeptieren oder gar lieben lernen, dazu kann die Beschäftigung mit Neuer Musik anregen. Ungeachtet aller pessimistischen Prognosen in bezug auf die Anerkennung Neuer Musik: Der Traum vom ›Neuen Menschen‹, wie er aus dem Geist des Expressionismus hervorging und als Freiheitsidee in die frühe Atonalität eindrang, darf nicht ausgeträumt sein.
Literatur
Adorno, Theodor W.: Gesammelte Schriften, Frankfurt 1970, Bd. 15, 189–248.
Besseler, Heinrich: Das musikalische Hören der Neuzeit, Berlin 1959.
Borris, Siegfried (Hg.): Der Wandel des musikalischen Hörens, Berlin 1962 (=Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt, Bd. 3).
Dahlhaus, Carl: Analyse und Werturteil, Mainz 1970 (=Musikpädagogik. Forschung und Lehre, Bd. 8).
Dömling, Wolfgang: »Die kranken Ohren Beethovens oder gibt es eine Geschichte des musikalischen Hörens?«, in: Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft, Bd. 1, 1974, 181–194.
Eimert, Herbert: Lehrbuch der Zwölftontechnik, Wiesbaden 1952.
Federhofer, Helmut und Albert Wellek: »Tonale und dodekaphonische Musik im experimentellen Vergleich«, in: Die Musikforschung 24 (1971), 260–276.
Gratzer, Wolfgang (Hg.): Perspektiven einer Geschichte abendländischen Musikhörens, Laaber 1997 (= Schriften zur musikalischen Hermeneutik, Bd. 7).
Gruhn, Wilfried: »Hören und Verstehen«, in: Kompendium der Musikpädagogik, hg. von Siegmund Helms, Reinhold Schneider und Rudolf Weber, 2Kassel 2000, 196–220.
Kaiser, Ulrich: Gehörbildung: Satzlehre, Improvisation, Höranalyse. Ein Lehrgang mit historischen Beispielen, Kassel 1998 (=Bärenreiter Studienbücher Musik 10).
Karkoschka, Erhard: »Eine Hörpartitur elektronischer Musik«, Melos 38 (1971), 468–475.
la Motte-Haber, Helga de: Handbuch der Musikpsychologie, Laaber 1985.
Dies.: »Der implizite Hörer«, in: Musikalische Hermeneutik im Entwurf, hg. von Gernot Gruber und Siegfried Mauser, Laaber 1994, 179–190.
Lissa, Zofia: »Zur historischen Veränderlichkeit der musikalischen Apperzeption«, in: Festschrift Heinrich Besseler, Leipzig 1961, S. 475–488.
Mosch, Ulrich: »Wahrnehmungsweisen serieller Musik«, in: Musiktheorie 12 (1997), 61–70.
Schönberg, Arnold: »Schulung des Ohrs durch Komponieren«, in: Stil und Gedanke, hg. von Ivan Vojtech, Frankfurt 1992.
Ders.: Harmonielehre, Wien 1986.
Stein, Erwin (Hg.): Arnold Schönberg, Ausgewählte Briefe, Mainz 1958.
Stockhausen, Karlheinz: »Gruppenkomposition: Klavierstück I (Anleitung zum Hören), Dezember 1955«, in: Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik, Bd. 1, Köln 1963, 63–74.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.