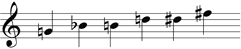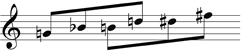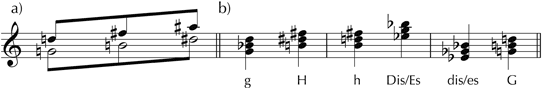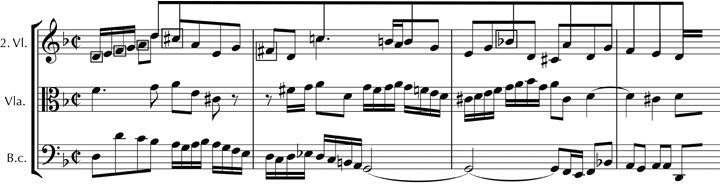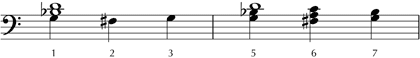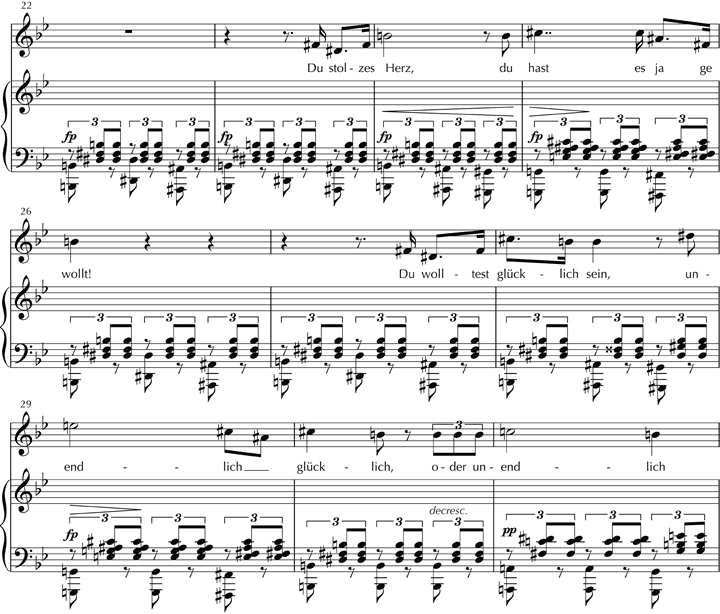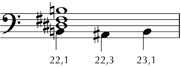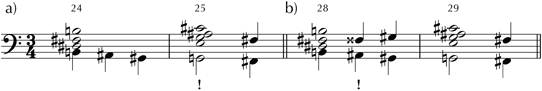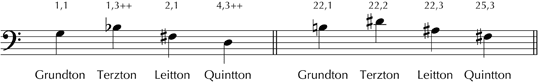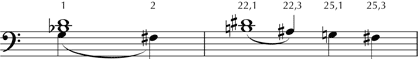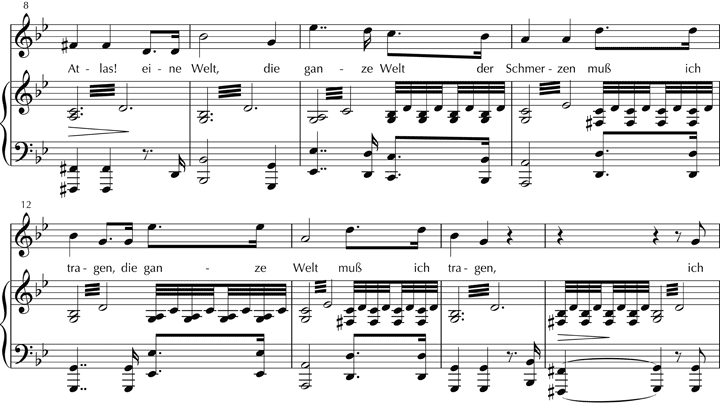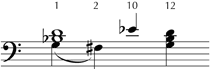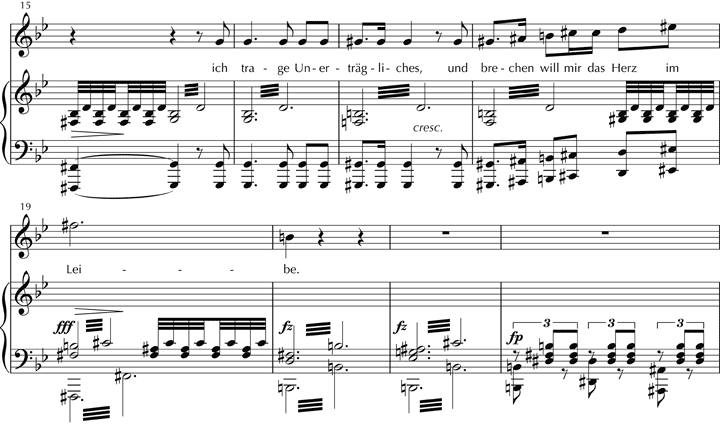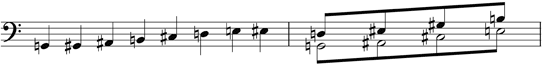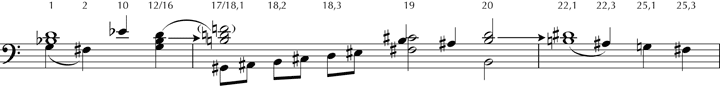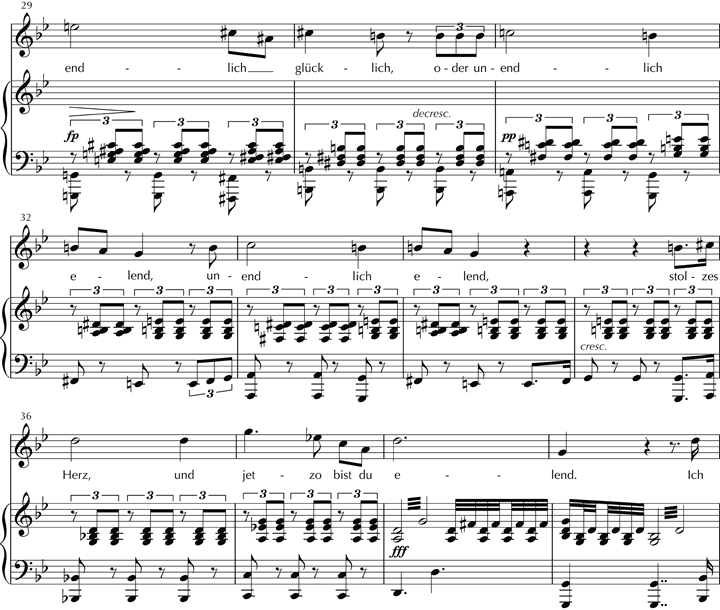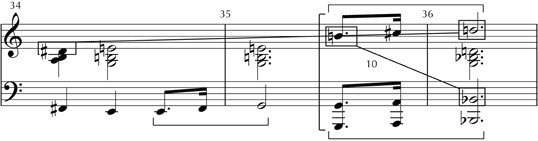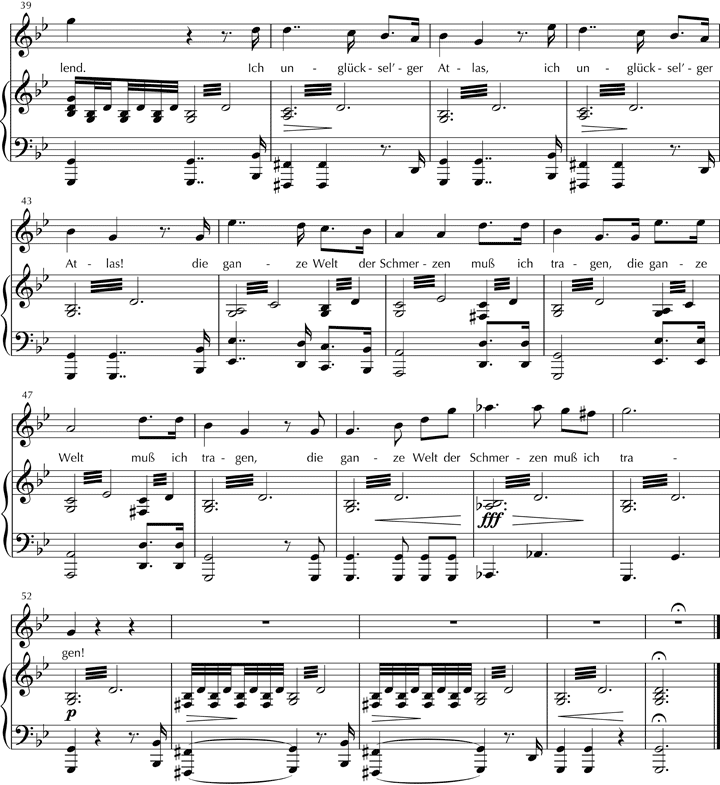›Tonfelder‹ und traditionelle Tonalität
Beobachtungen zu Schuberts Lied Der Atlas
Markus Sotirianos
Anhand von Schuberts Lied Der Atlas wird gezeigt, dass ein ›Tonfeld‹ (im Sinne der Theorie Albert Simons) nicht nur den übergeordneten formalen Ablauf eines Stückes organisieren, sondern auch in zahlreichen Details des Tonsatzes zu finden sein kann. Eben diese Präsenz auf mehreren Ebenen, die unabhängig von der Einbettung des gesamten Liedes in eine traditionelle Tonart besteht, darf als Beleg dafür gelten, dass der gesamte Tonsatz an der Darstellung des Tonfeldes beteiligt ist.
Ein hintergründiges ›Konstrukt‹ bei Schubert?
Die ›Theorie der Tonfelder‹ des ungarischen Dirigenten und Musiktheoretikers Albert Simon[1] geht davon aus, dass der musikalische Zusammenhang vor allem in Kompositionen etwa zwischen 1850 und 1950 (frühere Ausnahmeerscheinungen wie die Kompositionen Franz Schuberts inbegriffen) durch die Bildung von ›Tonfeldern‹ konstituiert wird: Töne schließen sich dadurch zusammen, dass sie zu einem ›Tonfeld‹ gehören, und Töne, die zu einem ›Tonfeld‹ gehören, erzeugen durch ihr Zusammenwirken bestimmte Klangcharaktere.
Beispiel 1: ›Konstrukt Ib‹ in Skalenform
›Konstrukt Ib‹ besteht – als Skala dargestellt – aus sechs Tönen in der alternierenden Intervallfolge Kleinterz-Halbtonschritt (Beispiel 1). Es bildet laut Michael Polth den ›Hintergrund‹ von Schuberts Lied Der Atlas aus dem Schwanengesang.[2] Artikuliert werde das ›Tonfeld‹ durch die Tonikadreiklänge der beiden Rahmenteile (g-Moll) und der Tonika des Mittelteils (H-Dur), deren sechs Töne sich zu eben diesem ›Konstrukt Ib‹ zusammenschließen: »In Schuberts Lied Der Atlas wird man das Tonartenverhältnis g-Moll – H-Dur zwischen den äußeren Abschnitten und dem Mittelteil wegen des Kontrastes als Konstrukt deuten […].«[3]
Beispiel 2: ›Konstrukt Ib‹, geteilt in die Dreiklänge g-Moll und H-Dur
Diese Behauptung ist problematisch und die intendierte Beziehung alles andere als selbstverständlich. Formal betrachtet, können die Töne der Tonika-Dreiklänge zweifelsfrei ein ›Konstrukt‹ bilden. Wenn aber mit dem Ausdruck ›Konstrukt‹ gemeint ist, dass die beteiligten Klänge sich zu einer übergeordneten Einheit zusammenschließen, dann muss gefragt werden, wie dieser Zusammenschluss möglich sein soll. Einwenden ließe sich vor allem, dass die beiden Dreiklänge an keiner Stelle des Liedes aufeinander folgen. Nicht einmal die Tonarten g-Moll und H-Dur prallen unmittelbar aufeinander, sondern sind durch Übergänge voneinander getrennt. Da diese Übergänge modulieren und so die beiden tonalen Ebenen miteinander vermitteln, kann von einem direkten ›Kontrast‹ keine Rede sein. Die Verbindung der beiden Dreiklänge zu einem ›Tonfeld‹ wäre dennoch gegeben, wenn es gelingt, sie über eine größere Entfernung hinweg aufeinander zu beziehen. Aber gerade dies bereitet besondere Schwierigkeiten: Schuberts Lied steht in der traditionellen Tonart g-Moll (auch wenn einzelne Akkordprogressionen sowie die Tonartenrelation zwischen den Rahmenteilen und dem Mittelteil für eine Komposition aus dem Jahr 1828 ungewöhnlich sind), die ihrerseits bekannte harmonische Beziehungen hervorbringt. Diese tragen zur Ausbildung eines ›Tonfeldes‹ zunächst nichts bei, sondern scheinen ihr eher noch entgegen zu stehen. Wie also soll man sich ein Wirken von ›Tonfeldern‹ vorstellen, das sich von den aus einer ›traditionellen‹ Tonart hervorgehenden Beziehungen zu lösen vermag?
Polth nennt als Argument für den Zusammenhang der beiden Dreiklänge lapidar deren kontrastierende Wirkung bzw. den Charakterunterschied, der Mittelteil und Rahmenteile in eine Beziehung zueinander setze. Dies provoziert Fragen: Wie soll eine Kontrastwirkung entstehen, wenn die als kontrastierend verstandenen Akkorde bzw. harmonischen Ebenen zueinander vermittelt erscheinen? Und stünde nicht gerade die behauptete Kontrastwirkung dem Zusammenschluss der Akkorde zu einem ›Tonfeld‹ entgegen? Schließlich bliebe – selbst wenn man Polths Annahmen folgt – immer noch die Frage, welchen Mehrwert die Interpretation des Liedes mit Hilfe der Tonfeldtheorie gegenüber traditionellen Deutungen bietet.
Wechselwirkung zwischen Klang und Technik
Die folgende Analyse soll die vorgebrachten Einwände entkräften und zeigen, dass die Behauptung, dem Schubertschen Lied liege ein ›hintergründiges‹ ›Konstrukt Ib‹ zugrunde, plausibel ist. Die Plausibilität ergibt sich aber erst mit Blick auf zahlreiche Details im Notentext, in denen sich die Beteiligung des gesamten Tonsatzes an der Darstellung des ›Konstrukts‹ zeigt. Mit anderen Worten: Das ›Konstrukt Ib‹ spiegelt sich zwar am auffälligsten in den Tonika-Dreiklängen der Formteile wider, hinterlässt aber gleichsam seine Spuren in der gesamten Komposition. Überdies wird die Analyse zeigen, wie es möglich ist, dass diese Details des Tonsatzes signifikante Merkmale eines ›Konstrukts‹ darstellen, obwohl sie gleichzeitig auch Funktionen in den traditionellen Tonarten g-Moll und H-Dur erfüllen (diese Mehrdeutigkeit kann nur von einer ›Tonfeld‹-Analyse, aber nicht von einer traditionellen Analyse in den Blick genommen werden).
Wie jedes andere ›Tonfeld‹ ist auch ein ›Konstrukt‹ einerseits durch technische Eigenschaften gekennzeichnet. Andererseits entspricht diesen technischen Eigenschaften eine Vielzahl an Klangwirkungen, über die sich nicht anders als metaphorisch sprechen lässt. Beide Aspekte bedingen sich wechselseitig: Klangwirkungen setzen technische Eigenschaften voraus, Technik wird um der Klangwirkungen willen in Anspruch genommen. Die Zugehörigkeit der Töne zu bestimmten ›Tonfeldern‹ wird am Zusammentreffen technischer Eigenschaften mit einer spezifischen Klangwirkung erkannt. Stellt sich eine solche Klangwirkung nicht ein, wird auch die Annahme eines ›Tonfeldes‹ problematisch, selbst wenn die entsprechenden technischen Eigenschaften erkennbar sind. Umgekehrt jedoch kann es sinnvoll sein, ein ›Tonfeld‹ auch dann anzunehmen, wenn sich allein eine bestimmte Klangwirkung einstellt, aber nicht alle Töne erscheinen.
Zu den technischen Eigenschaften eines Tonfeldes gehören die Möglichkeiten seiner Artikulation durch diverse Intervall- und Akkordkonstellationen.[4] Ein ›Konstrukt‹ kann unter anderem in zwei übermäßige Dreiklänge (Beispiel 3a), auf dreierlei Weisen in einen Dur- und einen Moll-Dreiklang (Beispiel 3b) und in drei Halbtonschritte geteilt werden. Von den vier möglichen ›Konstrukten‹ ergänzen sich jeweils Ia und Ib sowie IIa und IIb zu einem Zwölftonfeld.
Beispiel 3: a) ›Konstrukt Ib‹ als Folge von drei Quinten bzw. zwei übermäßigen Dreiklängen, b) komplementäre Teilungen
Die Klangwirkung eines ›Konstrukts‹ hat Richard Cohn in einem Artikel anschaulich beschrieben.[5] Cohn untersucht Akkordfolgen, die dem entsprechen, was hier ›komplementäre Teilung‹ des ›Konstrukts‹ heißt und die bei ihm als ›hexatonic pole‹ bezeichnet werden. Cohn zeigt, in welchen semantischen Kontexten die Akkordverbindung von der Mitte des 19. Jahrhunderts an verwendet und in welcher Weise sie musiktheoretisch reflektiert wurde. Hinsichtlich der Semantik ist von Interesse, dass die Akkordverbindung, sofern sie in textgebundenen Kompositionen – wie Opern – Eingang gefunden hat, vielfach in Kontexten auftaucht, die sich als ›unheimlich‹ (»uncanny«) umschreiben lassen.[6] Cohn weist darauf hin, dass Adolf Bernhard Marx die Akkordfolge als mögliche harmonische Verbindung noch 1852 ausschloss.[7] Sie habe, so Cohn, um 1850 den Vorstellungen geregelten Zusammenhangs widersprochen, weil Implikationen der Stimmführung und der Stufenrelation einander entgegen stehen: Legt der Bass bei einer Fortschreitung H-Dur - g-Moll einen Halbtonschritt h-ais bzw. h-b zurück, so sei es für einen Hörer unmöglich zu entscheiden, ob es sich um einen diatonischen oder chromatischen Halbtonschritt handelt. Anhand von Cohns Ausführungen wird weiterhin deutlich, dass eine Kontrastwirkung erst dadurch zustande kommen kann, dass sich die kontrastierenden Einzelmomente zugleich auf einer übergeordneten Ebene zu einer Einheit zusammenschließen: Ohne ›Verbindendes‹ kann es nichts ›Getrenntes‹ geben.
Die (kontrastierende) Wirkung, deren Zustandekommen die Annahme eines ›Tonfeldes‹ rechtfertigt, setzt zwar die Existenz der entsprechenden Töne voraus. Allerdings handelt es sich dabei nicht um ein hinreichendes Kriterium. Dies sei an einem kurzen Beispiel erläutert: In den Eröffnungstakten des ersten Satzes aus Bachs Konzert für zwei Violinen in d-Moll (BWV 1043) erscheinen zunächst die Tonika-Töne d-f-a, danach der Leitton cis und schließlich der Ton fis als Terz der Zwischendominante zu G-Dur in exponierter Weise. Dieser G-Dur-Akkord wird auf der nächsten schweren Zählzeit in einen Dv, also einen ganzverminderten Septakkord über cis, umgeformt. In der Violinstimme erklingt hier auffällig der Ton b.
Obwohl sämtliche Töne eines ›Konstrukts IIb‹ an prominenter Stelle vorhanden sind, würde man nicht von diesem ›Tonfeld‹ sprechen, weil der typische ›Konstrukt‹-Effekt ausbleibt. Dieser bleibt aus, weil die Töne cis, fis und b aus jeweils unabhängig von einander existierenden tonalen Gründen erscheinen und sich nicht miteinander zu einem Klang verbinden, der als Ganzes zur Tonika d-Moll kontrastiert. Diese Passage ließe sich aus einer schenkerianischen Perspektive effizienter als übergeordneter chromatisierter Oktavzug der latent mehrstimmigen Melodielinie erklären.
Beispiel 4: Johann Sebastian Bach, Violinkonzert d-Moll BWV 1043, Beginn: vermeintliche Konstrukt-Töne (eingekastelt) und chromatischer Oktavzug (Balken)
So bleibt zu untersuchen, an welchen Stellen in Schuberts Lied sich intervallische Spuren des ›Konstrukts‹ finden (und zwar unter den Bedingungen einer traditionellen diatonischen Tonart) und ob sich dort tatsächlich die für ein ›Konstrukt‹ charakteristischen Wirkungen einstellen. Weiterhin soll gezeigt werden, wie man diese ›Spuren‹ unter tonalen Bedingungen überhaupt erkennen bzw. die Bedingungen für ihre Wirkungen rekonstruieren kann.
Analogien durch Charakterähnlichkeit
Beispiel 5: Franz Schubert, Der Altas, T. 1–11
Der erste klangliche Attraktionspunkt des Liedes ist der übermäßige Dreiklang fis-b-d in Takt 2. Traditionell kann er – eingebettet zwischen zwei g-Moll-Akkorde – als die etwas ausgefallenere Version des Quintsextakkordes der V. Stufe betrachtet werden, als der er in Takt 6 tatsächlich erscheint (Beispiel 6). Andererseits ist die Wirkung des übermäßigen Dreiklangs für den ersten Liedteil deutlich prägender als diejenige des einfachen Dominantseptakkords, so dass – von dieser Perspektive aus betrachtet – der Quintsextakkord als die ›abgemilderte‹ Version des übermäßigen Dreiklangs wahrgenommen wird. Die signifikante Version des Anfangs – nicht aber die ›harmlose‹ danach – ist aus einem viertönigen Ausschnitt des ›Konstrukts Ib‹ gebildet. Die tiefe Lage, das Forte, die punktierten Rhythmen mit dem zusätzlichen Basston b, durch den ein verminderter Quartsprung entsteht, und das Tremolo der Begleitung tragen zusätzlich zum düsteren Eindruck des Anfangsteils bei. Innerhalb des hintergründigen ›Konstrukts‹ bildet die Dunkelheit des g-Moll-Akkordes die eine Hälfte der Kontrastkonstellation, die im weiteren Verlauf durch eine auffallend ›helle‹ Hälfte ergänzt wird.[8]
Beispiel 6: Franz Schubert, Der Atlas, Takte 1–3 und 5–7: Reduktion
Der Schlussteil des Liedes (ab T. 40) erscheint als Variante des Eröffnungsteils. Manche Details werden metrisch und melodisch leicht verändert, der Grundgestus und vor allem die Tonart g-Moll jedoch bleiben erhalten. Auf diesen Formteil wird an späterer Stelle eingegangen. Hier sei vorausschauend angemerkt, dass die Verlagerung des tonalen Zentrums von g-Moll nach H-Dur bis zum Wiedereintritt von g-Moll in der letzten Strophe ›rückgängig‹ gemacht werden muss. Betrachten wir den H-Dur-Teil ab Takt 22:
Beispiel 7: Franz Schubert, Der Atlas, Eröffnung des H-Dur-Abschnitts
Zu Beginn beschreibt die Bassstimme – wenn man den Ton dis auf der zweiten Zählzeit vorläufig als Ton einer Mittelstimme ignoriert – die Bewegung h-ais-h. Triolisch nachschlagend erklingt in der rechten Hand allein ein repetierter H-Dur-Dreiklang. Die Kombination der Außenstimmen hinterlässt einen Eindruck der Ungewissheit: Mit dem traditionellen Begriff der Wechselnote würde der auffällige Klang des Tons ais nicht ausreichend erklärt. Um – wiederum im traditionellen Sinne – als substantieller Basston aufgefasst zu werden, müsste er harmonisiert werden. In dieser klanglichen Hinsicht ist der Beginn des Mittelteils ähnlich unorthodox wie derjenige des Anfangs. Diese Gemeinsamkeit erlaubt es, die beiden Anfänge und damit die Darstellung der Tonika g-Moll und der Tonika H-Dur aufeinander zu beziehen. Erneut bilden die beteiligten Töne zu Beginn des Mittelteils (die Töne des H-Dur-Dreiklangs sowie der Leitton ais) wie diejenigen des Liedanfangs einen viertönigen Ausschnitt des ›Konstrukts Ib‹:
Beispiel 8: Franz Schubert, Der Atlas, Eröffnung des H-Dur-Abschnitts: Reduktion
In den Takten 24 und 25 bilden die lokale Tonika H-Dur und die lokale Dominante Fis-Dur den harmonischen Rahmen der Phrase. Vermittelt werden die beiden Klänge durch die fallende Basslinie h-ais-gis-fis, die als absteigendes Tetrachord eine traditionelle Progression darstellt. Außer den leitereigenen Tönen erscheint allerdings der Ton g (zwischen den Tönen gis und fis). Traditionell ließe sich der Einschub entweder als lokale Chromatisierung des diatonischen Modells interpretieren, die das Ende des Tetrachords in eine Art ›phrygische Wendung‹ verwandelt, oder als Vorhaltsbildung. Allerdings fällt die klangliche Prominenz dieses Tones g auf: Er steht metrisch auf Zählzeit eins, wird im Gegensatz zu den anderen Tönen der Linie zweimal angeschlagen und stützt die erste harmonische Bewegung innerhalb des H-Dur-Teils. Er ist sogar so auffällig, dass der Auflösungsklang Fis-Dur, obwohl er das eigentliche Ziel der fallenden Linie darstellt, klanglich in dessen Schatten zu stehen scheint. Auch hier kollidieren die ›traditionelle‹ und die ›moderne‹ Auffassung vom ›logisch Ersten‹ miteinander: Traditionell gesehen bildet das Tetrachord das fundierende Prinzip und der Ton g die Abweichung, aus der Perspektive der Tonfelder jedoch bildet der Ton g das primär Gegebene, das Tetrachord das Nachgeordnete. Das Tetrachord wird demnach eingerichtet, damit der Ton g in einem H-Dur-Kontext erscheinen und so auf den durch das ›Konstrukt‹ gegebenen g-Moll-Akkord verweisen kann.
Beispiel 9: Franz Schubert, Der Atlas, a) Weiterführung der H-Dur-Passage und b) Variante in der Wiederholung: Reduktionen
Die Takte 28 und 29 bilden eine Variante der Takte 24 und 25: Die Bassführung ist identisch, allerdings erklingt in Takt 28 (dort in der rechten Hand auf der dritten Zählzeit) über dem Basston gis ein gis-Moll-Dreiklang. Zwischen erster und dritter Zählzeit vermittelt ein Durchgangston fisis, der seinerseits kurzzeitig einen übermäßigen Dreiklang in der rechten Hand über dem Basston ais entstehen lässt (dis-fisis[bzw. g]-h). Obwohl das viertönige Klanggebilde satztechnisch als Koinzidenz aus Stimmführungsvorgängen erklärbar ist, wirkt der vorüberhuschende übermäßige Klang wie eine kurze Rückblende zum dominierenden übermäßigen Klang des Anfangsteils. Es überrascht kaum, dass die vier Töne erneut Bestandteile des ›Konstrukts Ib‹ sind.
Beispiel 10: Franz Schubert, Der Atlas, g-Moll- und H-Dur-Teil: analoge Bassbewegungen
Zusammenfassend fördert der Vergleich der g-Moll- mit der H-Dur-Passage folgende Analogien zu Tage:
In beiden Passagen gibt es analoge Bewegungen der Bassstimme: im ersten Abschnitt g-b-fis-d, im zweiten Abschnitt h-dis-ais-fis. Die Töne b und dis werden als Töne aus der Mittelstimme zusätzlich zur analogen Motivbildung herangezogen (Beispiel 10). Alle diese Töne sind am ›Konstrukt‹ beteiligt.
Die Leittöne fis bzw. ais werden in beiden Fällen insofern unorthodox harmonisiert, als sie gleichzeitig mit der jeweiligen Tonika erklingen.
Der Halbtonschritt g-fis spielt in beiden Passagen eine herausragende Rolle, obwohl die harmonischen und melodischen Verhältnisse jeweils andere sind.
Die übermäßigen Dreiklänge in Takt 2 und Takt 28 ergänzen sich zu einem ›Konstrukt Ib‹. Sie lassen sich aufeinander beziehen, weil sie in ihrer Strophe jeweils auf ähnliche Weise die herrschende Tonart klanglich ›dunkel‹ einfärben.
Das ›Konstrukt Ib‹ wirkt also über die Tonika-Dreiklänge hinaus in der konkreten Melodie- und Harmoniebildung, so dass vor diesem Hintergrund die Klangwirkungen der unterschiedlichen Stellen aufeinander bezogen werden können. Der aus dem Konstrukt hervorgehende charakteristische Klang erscheint unabhängig von der lokal herrschenden Tonart, jedoch – ihr gewissermaßen ›trotzend‹ – in sie eingebettet. Er tritt als isoliertes Phänomen immer wieder auf und kann sich auf diese Weise sogar gegen die Relationalität der Tonarten durchsetzen, d.h. Bezüge herstellen, die traditionell auf Grund der großen harmonischen Entfernung der Tonarten gar nicht möglich wären.
Versuch einer Schichtenanalyse
Wenn ›Konstrukt Ib‹ tatsächlich das Grundgerüst des Liedes bildet und sich darüber hinaus in weiteren Details nachweisen lässt, so muss es möglich sein, dies in einer an Heinrich Schenkers Theorie angelehnten Schichtenanalyse zu zeigen. Dieser Versuch soll im Folgenden unternommen werden. Dabei wird ›Konstrukt Ib‹ als ›Hintergrund‹ des Liedes angenommen. Auf der nächsten Schicht wird gezeigt, wie ›Konstrukt Ib‹ konkret artikuliert wird.
Aus den bisherigen Beobachtungen lässt sich schließen, dass einzelne Töne des ›Konstrukts Ib‹ selbst unterschiedliche Funktionen übernehmen können: Manche werden derart in Anspruch genommen, dass sie zur Ausbildung einer ›traditionellen Tonart‹ beitragen, andere sind für die Destabilisierung dieser vermeintlichen Tonarten verantwortlich.
Sowohl in den Rahmenteilen als auch im Mittelteil ist die Bewegung g-fis für einige Auffälligkeiten verantwortlich: Jeweils einer der beiden Töne ist an der Darstellung der herrschenden Tonart beteiligt, der andere destabilisiert diese oder wird klanglich besonders auffällig artikuliert. Somit wäre trotz der unterschiedlichen Inanspruchnahme diese Bewegung g-fis das verbindende Element beider Teile. Die restlichen vier Töne des ›Konstrukts‹ dienen nun vornehmlich der Ausbildung der Tonarten: Durch die Teilung in zwei große Terzen b-d und h-dis bilden sie im Verbund mit dem Ton g bzw. fis die beiden ›traditionellen Tonarten‹ g-Moll und H-Dur aus. Als Konsequenz ergibt sich etwas Verblüffendes: Auf dieser Ebene bestehen beide Teile nicht nur aus dem jeweils zu Grunde liegenden Dreiklang, wie Polth es angenommen hatte, sondern genau genommen zusätzlich aus einem vierten Ton des ›Konstrukts Ib‹, der für die jeweiligen Attraktionspunkte verantwortlich ist:
Beispiel 11: Franz Schubert, Der Atlas: Verteilung des ›Konstrukts Ib‹ auf den ›Hintergrund‹ (g-Moll-Rahmenteile und H-Dur-Mittelteil)
In Beispiel 11 symbolisieren die Notenwerte die Funktionen der Töne: Mit Viertelnoten wird die in beiden Teilen erscheinende Bewegung g-fis gekennzeichnet, während die ganzen Noten auf die großen Terzen verweisen, an denen die ›traditionellen Tonarten‹ festzumachen sind. Die Abstände sind so gewählt, dass man wichtige Strukturierungen erkennen kann: Im ersten Teil markiert die Bewegung g-fis den Beginn, im zweiten Teil das Ende. Daran zeigt sich Grundsätzliches für die weitere Ausführung der Teile: Im g-Moll-Teil sind der Tonika-Dreiklang sowie der übermäßige Dreiklang angelegt, im H-Dur-Teil definiert die große Terz h-dis die neue lokale Tonika, während die Bewegung g-fis am Ende die von h aus fallende Basslinie bereits erahnen lässt.
Um die ›traditionellen Grundtöne‹ g und h der beiden Teile in eine enge Beziehung zu setzen, wird die Bassstimme im H-Dur-Teil motivisch analog zum g-Moll-Teil gebildet. In Beispiel 12 ist der charakteristische, unorthodox harmonisierte Leitton jeweils in beiden Passagen durch einen Bogen mit dem Grundton verbunden. Da der Ton ais durch eine Analogiebildung (ein Verfahren aus dem ›Mittelgrund‹) entsteht, wird er mit einer nach oben gehalsten Viertelnote dargestellt (mit diesem Ton ais erscheint übrigens zum ersten Mal ein Ton des ›Konstrukts Ib‹ in enharmonisch verwechselter Bedeutung).
Beispiel 12: Franz Schubert, Der Atlas, Rahmenteile und Mittelteil: Erweiterung durch motivische Analogiebildung
In Beispiel 12 enthält der H-Dur-Mittelteil fünf Töne des hintergründigen ›Konstrukts Ib‹. Auch bei weitergehender Betrachtung der g-Moll-Rahmenteile lässt sich eine Erweiterung des ›Konstrukts Ib‹ um einen fünften Ton beobachten:
Beispiel 13: Franz Schubert, Der Atlas, ›Nachsatz‹ des g-Moll-Anfangsteils
In der noch nicht erwähnten Weiterführung des g-Moll-Teils ab Takt 10 eröffnet der Ton es innerhalb der Strophe eine Art Nachsatz, der von der Pendelharmonik der ersten neun Takte gestisch deutlich unterschieden ist. Die Melodieführung in Bass- und Singstimme führt nacheinander zwei VI-II-V-I-Bewegungen aus (Takte 10–12 und 12–14; in der ersten Taktgruppe zum Teil linear ausgefüllt). Diese könnte man traditionell als Ausschnitte einer Quintfallsequenz interpretieren. Aufhorchen lässt der emphatische Ton es, mit dem die Phrase (und zugleich eine neue Geste) beginnt. Strukturell ersetzt der Ton es erstmals den bis dahin durchgängig zu hörenden Quintton d des g-Moll-Dreiklangs. Diese Ersetzung kann aus schenkerianischer Perspektive als ›obere Nebennote‹ interpretiert werden, aus Simonscher Sicht jedoch erweitert der Ton den Mittelgrund auch des g-Moll-Teils auf fünf Töne des ›Konstrukts Ib‹. Das Erscheinen der Tonqualität es lässt sich demnach als Antizipation des Tons dis aus dem H-Dur-Teil auffassen, analog zu den Tönen b und ais. Anknüpfend an Beispiel 11 (Verteilung des ›Konstrukts Ib‹ auf den ›Hintergrund‹) zeigt Beispiel 14 den auf fünf Töne erweiterten ›Mittelgrund‹ des g-Moll-Teils (wobei die jeweils neuen fünften Töne der beiden Formteile – es und ais – in enharmonisch verwechselter Form bereits im Hintergrund vorkamen – allerdings jeder Ton im jeweils anderen Formteil).
Beispiel 14: Franz Schubert, Der Atlas, g-Moll-Teil: ›Mittelgrund‹ (zu lesen mit Beispiel 12, 2. Takt)
Zwischen den tonartlich stabilen Takten des ersten und mittleren Formteils vermittelt ein überleitender Teil (Takte 17–21).
Beispiel 15: Franz Schubert, Der Atlas, Überleitungspassage zwischen g-Moll- und H-Dur-Teil
Hier erweist sich die Annahme, dass die beiden großen Terzen b-d und h-dis den ›Hintergrund‹ der jeweiligen Teile bestimmen, als besonders tragfähig. Der Übergang lässt sich nämlich als Verschiebung der großen Terz b-d zur großen Terz h-dis interpretieren. Diese Verschiebung geschieht nicht in einem Zug, sondern wird in zwei sukzessive Teilbewegungen zerlegt: Die Teilbewegung b-h ereignet sich zu Beginn, die Bewegung d-dis am Ende der Überleitung (dargestellt durch jeweils eine Pfeillinie).
Beispiel 16: Franz Schubert, Der Atlas, Überleitungspassage: Reduktion
Zur ersten Verschiebung b-h: Der Schritt b-h findet innerhalb einer enharmonischen Modulation statt (über einen ganzverminderten Septakkord). Die Modulation ist nicht Selbstzweck, sondern dient dazu, eine Tonfeld-Operation in einen traditionell verständlichen Vorgang einzubetten. Der neue Grundton h tritt bereits in Takt 17 im Klavier ein. Satztechnisch wird er als Teil einer Sopranklausel behandelt, die sich über die gesamte Taktgruppe erstreckt und in Takt 20 endet (dort in einer Kadenz nach h-Moll). Die Darstellung als Sopranklausel ist eine weitere Möglichkeit, um eine Halbtonbewegung aus dem ›Konstrukt‹ in einen tonalen Zusammenhang zu stellen. An diesem Beispiel vollzieht sich am sichtbarsten der Funktionswandel der Tonqualität b/ais vom Terzton in g-Moll zum Leitton in h-Moll bzw. H-Dur.
Zur zweiten Verschiebung d-dis: Die zweite Verschiebung wird durch ›Aufhellung‹ von h-Moll (T. 20) zu H-Dur (T. 22) vollzogen. Auch hierfür gibt es ein traditionelles Vorbild: Der Gebrauch der ›Variant‹-Tonart ist ein gängiges Mittel der Kontrastbildung bzw. ›Umbeleuchtung‹. Heinrich Schenker spräche hier von einer ›Mischung‹. Die Begriffe ›Variante‹ oder ›Mischung‹ verfehlen jedoch die massive Wirkung, die dem H-Dur-Akkord im Anschluss an die h-Moll-Kadenz zu eigen ist.[9] Besser erklärt wäre der Effekt durch die Annahme, dass an dieser Stelle das hintergründige ›Konstrukt Ib‹ vervollständigt wird.
Der besondere Charakter des Variant-Dreiklangs, den man als morbid oder abgründig empfinden mag, lässt an Schuberts Lied Ihr Bild (ebenfalls aus dem Schwanengesang) denken, in dem auf eine Unisono-Eröffnung in b-Moll ein Akkordsatz in B-Dur folgt.[10] Auch hier erscheint der Variantklang B-Dur mit befremdlicher Schönheit. Bernhard Haas hat die im Unisono geführte Anfangspassage als Darstellung von fünf Tönen eines ›Konstrukts‹ analysiert. Der sechste, noch fehlende Ton erscheint als Basston des ersten (Dur-)Akkords.[11]
Details zu Übergängen und Reprise
Bislang konnten viele Details des Tonsatzes durch die Inanspruchnahme des ›Konstrukts‹ auf verschiedenen Schichten erklärt werden. Im Folgenden werden Beobachtungen beschrieben, die sich nicht unmittelbar auf das ›Konstrukt‹ beziehen lassen, aber wichtige Verfahren zur Bildung von Übergängen darstellen. Dabei geht es insbesondere um drei Passagen:
die ›enharmonische Modulation‹ von g-Moll nach h-Moll im Übergang vom Anfangs- zum Mittelteil,
den ›Rückweg‹ nach g-Moll im Übergang zum Schlussteil und
die Veränderungen innerhalb des Schlussteils im Vergleich zum Anfangsteil.
1. ›Funktionaler‹ Übergang in Takt 18: Innerhalb der Überleitung von g-Moll nach (zunächst) h-Moll bewegen sich Gesangsstimme und Bass in einer Halbton-Ganzton-Skala (Beispiel 15). Die Skala ist eine Darstellungsform des Tonfeldes ›Funktion‹[12] (eine andere Darstellungsform wäre eine Folge von Dur- und Molldreiklängen im Kleinterzzirkel).
Beispiel 17: Darstellungsformen des ›Tonfelds‹ ›Funktion‹ (hier ›Tonika‹)
Für ein Musikstück gibt es in Abhängigkeit von seinem ›Grundton‹ ein eigenes ›Tonika-Tonfeld‹. In Der Atlas ist der Ton g der ›Grundton‹ und folglich g-Moll ein Ausschnitt aus der ›Tonika‹. H-Dur bzw. h-moll bilden somit einen Ausschnitt aus der ›Dominante‹, da H-Dur in einer Kleinterzbeziehung zur ›traditionellen‹ Dominante D-Dur steht. Mit Hilfe der Tonfeld-Theorie lässt sich die Überleitung zu h-Moll bzw. H-Dur dahingehend interpretieren, dass die lokal wirksame Grundtonart von einem ›tonikalen‹ in ein ›dominantisches‹ ›Tonfeld‹ überführt wird. H-Dur fungiert demnach als die ›Dominant-Tonart‹ des Stückes, die ›äquivalent‹ zur ›eigentlichen‹ Dominant-Tonart D-Dur ist.[13]
Der Klang des ganzverminderten Septakkords wird in Takt 18 (ausgehend von g-Moll) zunächst als Dv von E-Dur (mit den Tönen gis-h-d-f) und später von Cis-Dur (mit den Tönen eis-gis-h-d) notiert. Die Tonarten G/g, E/e und Cis/cis gehören demselben ›tonikalen Tonfeld‹ an und sind ›äquivalent‹. Darüber hinaus sind die Töne gis-h-d-f einerseits ausschließlich die ›Quinttöne‹ des ›Tonika-Tonfeldes‹ und andererseits gleichzeitig die ›Grundtöne‹ des ›Dominant-Tonfeldes‹. Um nun das quinthöhere, ›dominantische Tonfeld‹ als lokale Tonika zu etablieren, wird dieser ganzverminderte Septakkord als ein ›prädominantischer‹ Klang[14] (in diesem Fall ein DDv) aufgefasst und entsprechend aufgelöst: über Fis-Dur mit Quartvorhalt nach h-Moll. Die ›enharmonische Modulation‹ ermöglicht also in ›funktionaler‹ Hinsicht den Wechsel aus der ›Tonika‹ in die ›Dominante‹, die vorherigen ›Quinttöne‹ werden zu ›Grundtönen‹.
Beispiel 18: Franz Schubert, Der Atlas, Überleitung: Reduktion
2. ›Funktionaler‹ Rückweg: Die Annahme, dass der Mittelteil die ›Dominante‹ des Stücks darstellt, wird durch die Analyse der Rückführungspassage nach g-Moll erhärtet.
Beispiel 19: Franz Schubert, Der Atlas, e-Moll-Passage und Rückführung nach g-Moll
Der Rückweg folgt zunächst einem traditionellen Muster: Das Ende der H-Dur-Fläche wird durch den Basston a dominantisiert (in der konkreten Darstellung wieder als ganzverminderter Septakkord) und in eine e-Moll-Passage überführt – ein Gang von der V. zur I. Stufe. Vermittelt wird dieser Gang erneut durch ein fallendes Tetrachord a-g-fis-e (T. 31f.).[15]
Während die ›Re-Dominantisierung‹ des H-Dur-Akkordes an traditionelle Rückleitungen erinnert, tut dies der Übergang von e-Moll nach g-Moll nicht. Das strukturelle Ziel dieses Übergangs bildet die Umkehr der Bewegungen b-h und d-dis. Diese Umkehr geschieht durch ›indirekte Chromatik‹: Die diatonisch aufsteigende Terzbewegung e-fis-g in der Bassstimme (Takte 34f.) führt in einen e-Moll-Sextakkord. Im Übergang zu Takt 36 wird diese Bewegung vom Ton g aus sequenziert (g-a-b), wobei die Singstimme in großen Dezimparallelen gekoppelt verläuft. Mit dem Erreichen von Takt 36 ›kippt‹ der Tonsatz überraschend nach g-Moll, da im Bass nun nicht der Ton h, sondern der Ton b erscheint. Durch die Parallelführung in großen Dezimen erscheint in der Singstimme der Ton d anstelle des zuvor in e-Moll präsenten Leittons dis. Der Wechsel von e-Moll zu g-Moll ist somit ein ›äquivalenter‹ Schritt.
Beispiel 20: Franz Schubert, Der Atlas, Übergang von e-Moll zu g-Moll: Reduktion
Der ›funktionale‹ Übergang von e-Moll nach g-Moll wirkt – ähnlich wie der Übergang von g-Moll nach h-Moll – weniger vertraut als derjenige von H-Dur nach e-Moll. Auffällig ist, dass sich die ›funktionalen‹ Übergänge genau dort ereignen, wo im Text des Gedichts die Schnittstellen zwischen ›Realität‹ und ›Erinnerung‹ liegen. Schubert vermittelt zwischen der H-Dur-Passage (›glücklich sein‹) und der e-Moll-Passage (›unendlich elend‹) traditionell, um anschließend die ›Realität‹ durch einen harten, nicht traditionellen Schnitt hervorbrechen zu lassen.
3. Schlussteil: Der auffälligste Takt im Schlussabschnitt ist Takt 50 am Ende der Strophe mit dem Spitzenton as. Nicht nur wegen des Spitzentons, sondern auch gestisch bildet Takt 50 den Höhepunkt des Liedes. Der Ton as gehört allerdings nicht zu ›Konstrukt Ib‹ und muss infolge dessen auf andere Weise erklärt werden.
Beispiel 21: Franz Schubert, Der Atlas, Schlussteil
Entgegen mancher traditionellen Deutungsgewohnheit wird die Funktion eines ›reprisen‹artigen Schlussteils von Simon[16] nicht als Wiederaufgreifen und Bestätigen der Grundtonart bestimmt; denn mit dem Ende des Mittelteils sind alle strukturell wesentlichen Ereignisse erklungen. Der Schlussteil dient vielmehr dazu, die ins Spiel gebrachten Elemente nach und nach zu »eliminieren«. »Die Elimination dient häufig zur Erzielung von Schlußwirkungen.«[17] In diese Deutung fügt sich die Beobachtung, dass die letzte Strophe deutlich ›glatter‹ und viel weniger ›schroff‹ erscheint als die erste: Neben der metrischen Vertauschung von schwerem und leichtem Takt (in Takt 40 beginnt die Singstimme über einer dominantischen Harmonie im Gegensatz zur Anfangspassage, wo die Melodie bei ihrem Eintritt tonikal gestützt wird) wird der Singstimme – zum ersten Mal im g-Moll-Teil überhaupt – eine eigene Melodielinie verliehen. Auch haben die metrisch sperrigen Takte 9 und 17 keine Entsprechung im Schlussteil. Den vermeintlichen Höhepunkt bildet nun eine Verbindung auf engstem Raum des Tons g mit seinen umgebenden Halbtönen, die jeweils für ein ›Tonfeld‹ stehen: g-fis für das ›Konstrukt‹ und g-as für die ›Funktion‹. Sie haben in beiden Überleitungspassagen – weg von g-Moll und zurück zu g-Moll – eine wichtige Rolle gespielt. Die Bewegung g-as ersetzt überdies die Bewegung g-gis, mit der die Überleitung im Übergang von Takt 16 zu Takt 17 begann. Am Ende des Liedes findet auch der Ton as seinen Weg zurück zu seinem Ausgangston g. Diese Passage stellt somit von ihrem Verlauf und ihrer Zuspitzung her einen Höhepunkt, strukturell aber einen Abbau dar, was sich auch daran zeigt, dass das Lied unmittelbar danach endet (ohne traditionelle Schlusswendung, lediglich mit einem Oktavsprung in der Singstimme).
Fazit und Ausblick
Die Analyse hat gezeigt, dass die Annahme Michael Polths, das ›Konstrukt Ib‹ bilde im Lied Der Atlas den ›Hintergrund‹ des Ganzen, plausibel ist. Herausgearbeitet wurde die Bedeutung des ›Konstrukts‹ für die Tonartendisposition, für die Gestaltung der Eckpunkte der Überleitung und für die Details der Motiv- und Melodiebildung. Dabei wurde erkennbar, wie sich das Wirken des ›Konstrukts‹ an den entsprechenden Stellen des Liedes in auffälligen Klangcharakteren manifestiert, die unabhängig von den herrschenden lokalen Tonarten hervortreten. Mittelgründig wurde das Verhältnis zwischen den Tonarten g-Moll/e-Moll und h-Moll/H-Dur auch durch ›Funktionen‹ bestimmt.
Bislang noch nicht angesprochen wurde der für dieses Lied charakteristische Kontrast zwischen Verharren und Bewegung. Sämtliche Taktgruppen, die eine Tonart festhalten, sind auffällig statisch angelegt. In den ›modulierenden‹ Passagen hingegen scheinen sich die Vorgänge (vor allem der tonalen Destabilisierung) zu überschlagen. Diese vermeintliche Unausgewogenheit lässt sich als zusätzlicher Hinweis verstehen, dass nicht mehr – im Schenkerschen Sinne – die Darstellung einer einzigen Tonart, sondern die Gegenüberstellung unterschiedlicher (flächig auskomponierter) Tonika-Bereiche das leitende tonale Prinzip des Liedes darstellt.[18]
Es wird eine Aufgabe des zukünftigen musiktheoretischen Diskurses sein, die Vielfalt der Erscheinungen von ›Tonfeldern‹ zu erschließen und auf geeignete Begriffe zu bringen. Die Beobachtungen zu Schuberts Der Atlas sind hierzu ein erster Anfang.
Anmerkungen
Vgl. Haas 2004. | |
Polth 2006, 176. | |
Ebd. | |
Vgl. hierzu den Beitrag von Michael Polth in dieser Ausgabe. | |
Cohn 2004. | |
Cohn versucht in seinem Beitrag, die Freudsche Auffassung des ›Unheimlichen‹ für die Untersuchung der Akkordverbindung fruchtbar zu machen. | |
Ebd., 308. | |
Hier soll nicht der Versuch unternommen werden, den Kompositionsprozess zu rekonstruieren, sondern zu beschreiben, mit welcher Deutlichkeit Schubert die jeweiligen Teile mit eigenen Charakteren versieht, die dann miteinander in Wechselwirkung treten können. | |
Dieses bestimmte H-Dur klingt grell und besitzt durch die Triolenrhythmik im Vergleich zum Teil zuvor einen schwankenden Charakter. Es scheint kein reales, sondern ein morbides Dur zu sein. | |
Vgl. Haas 2004, 70ff. | |
Eine Subtilität stellt bei Haas die Beobachtung bzw. Interpretation dar, nach der der Ton des als einer der fünf hintergründigen Konstrukt-Töne im ersten Teil des Liedes noch fehlt. Er erscheint erst vor Beginn des Schlussabschnitts. Streng genommen ergänzt der Basston d erst dort das ›Konstrukt IIb‹ als ›sechster‹ Ton (2004, 71). | |
Die Eigenschaften dieses Tonfeldes werden in anderen Artikeln dieses Bandes sowie bei Haas 2004 und Polth 2006 ausführlich erklärt. | |
Ein ähnliches Verfahren findet sich im ersten Satz aus Beethovens ›Waldstein-Sonate‹ in C-Dur. Der Seitensatz der Exposition steht dann in E-Dur und damit ebenfalls in einer Kleinterzbeziehung zur eigentlichen Dominante G-Dur. | |
Cadwallader/Gagné 2007, 47. | |
e-Moll bietet eine weitere Möglichkeit, die Töne g und fis in einen tonalen Zusammenhang einzubetten (auch hier ist der Akkord mit dem Basston fis als Terz-Quart-Akkord der auffälligste Klang). | |
Vgl. Haas 2004, 70–81 (Analyse von Ihr Bild). | |
Haas 2004, 35. | |
Dass mit dem beschriebenen Verfahren die Hierarchie der Tonarten noch nicht aufgehoben wird, erkennt man daran, dass das Lied nach dem H-Dur-Teil den Weg zurück zu g-Moll findet. |
Literatur
Haas, Bernhard (2004), Die neue Tonalität von Schubert bis Webern. Hören und Analysieren nach Albert Simon, Wilhelmshaven: Noetzel.
Polth, Michael (2006), »Tonalität der Tonfelder – Anmerkungen zu Bernhard Haas (2004), Die neue Tonalität von Schubert bis Webern. Hören und Analysieren nach Albert Simon, Wilhelmshaven: Noetzel«, ZGMTH 3/1, 167–178.
Cohn, Richard (2004), »Uncanny Resemblances: Tonal Signification in the Freudian Age«, Journal of the American Musicological Society 57/2, 285–323.
Cadwallader, Allen / David Gagné (2007), Analysis of Tonal Music – A Schenkerian Approach, New York: Oxford University Press.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.