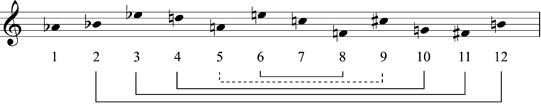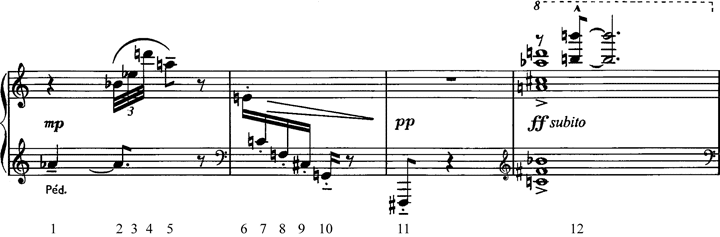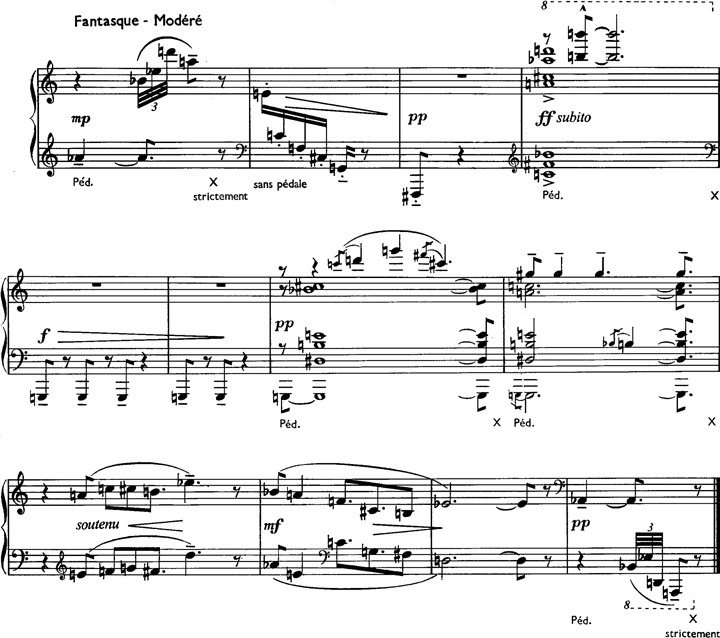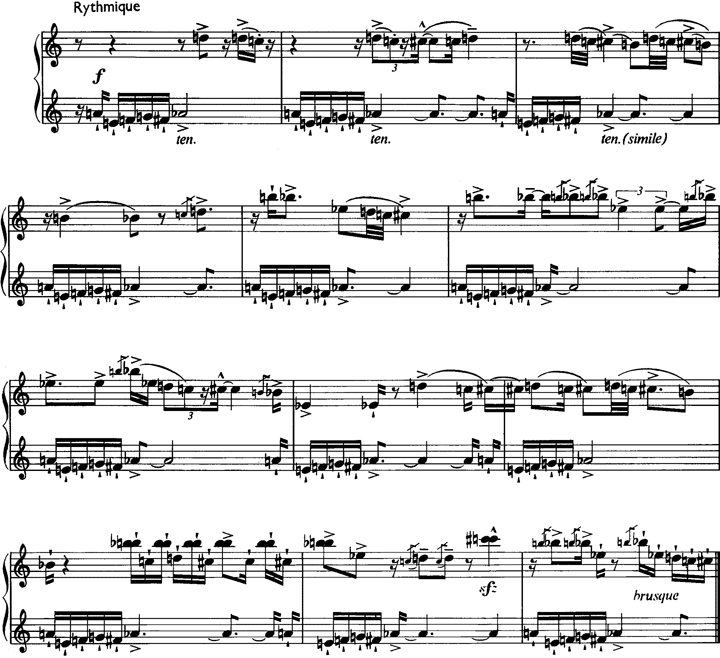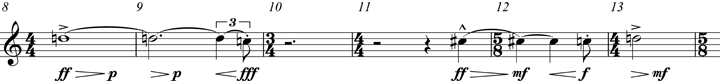Zum Begriff der Wucherung bei Pierre Boulez am Beispiel der douze notations (1945) und der notations pour orchestre (1978)
Andreas Zeißig
Boulez hat einige der Notations für Klavier in eine labyrinthische Textur für großes Orchester überführt. Ausgehend von Analysen einzelner der Klavierstücke wird zunächst der kompositorische Weg zu den hinsichtlich Umfang und Komplexität deutlich erweiterten Orchesterfassungen nachgezeichnet. Im zweiten Teil wird gefragt, welche Bedeutung in diesem Zusammenhang dem Begriff der ›Wucherung‹ zukommt, mit dem Boulez kompositorisches Schaffen in Analogie zu Wachstumsphänomenen der Natur setzt. Gezeigt werden soll, inwieweit Boulez’ (musik-)ästhetische Überlegungen sein kompositorisches Handeln bestimmen bzw. reflektieren.
Wenige Komponisten haben ihre Überlegungen zu den eigenen kompositorischen Verfahren so ausführlich mitgeteilt wie Pierre Boulez. Seine Aussagen über die Bedeutung der Analyse sind ambivalent. Zwar betont er, es gelte Zugang zum Denken des Komponisten zu finden:
Ich habe […] immer wieder meinen Schülern gesagt […]: es ist viel wichtiger, nur drei Takte zu sehen, wirklich zu sehen – nicht nur, wie das gebaut ist, sondern wie das konzipiert ist, weil man nur so einen direkten Zugang zum Denken des Komponisten findet.[1]
Gleichwohl sieht er in der Analyse kein Mittel, dem Moment der Erfindung oder dem ›Inneren‹ des Werkes nahe zu kommen:
Wir wissen, dass das Netz von verbalen oder stillschweigend vorausgesetzten Erklärungen, das Intuition und Werk aneinander bindet, unerlässlich und bedeutungslos zugleich ist: unerlässlich, weil es unsere einzige – vorgreifende oder nachträgliche – Methode der Beschreibung bildet, bedeutungslos, weil der innere Wert des vollendeten Werkes jenseits dieser Beschreibung liegt.[2]
Die Diskurse und analytischen Erkenntnisse, die unser Bild eines Komponisten prägen, sagen wenig Verlässliches über die Erfahrungen und das Wissen des Komponisten, die in seine Kompositionen eingeflossen sind. Auf der Suche nach der ›Konzeption‹ des Komponisten, gelangt der Analytiker zwangsläufig zu einer eigenen Konzeption, in der sich seine Zeit und sein Erfahrungsstand spiegeln. Entscheidend ist für Boulez daher die ›subjektive‹ Gültigkeit einer produktiven, schöpferischen Analyse:
Die produktive Analyse ist wahrscheinlich die falsche Analyse, die im Werk nicht eine allgemeine, sondern eine besondere, vorläufige Wahrheit findet und ihre eigene Imagination der Imagination des analysierten Komponisten aufpfropft.[3]
Gesichter eines zentralen Konzepts
Eine besondere Situation entsteht, wenn ein älteres Gesicht im Spiegel ein junges erblickt. Eine derart rätselhafte Doppelgesichtigkeit prägt das Verhältnis zwischen den zwölf Notations für Klavier von 1945[4] und deren 1978 begonnener, bislang unabgeschlossener Umarbeitung zu zwölf Stücken für Orchester. Der Titel Notations wurde nicht, wie etwa der Titel Stücke bei Webern, Schönberg oder Berg, gewählt, um eine traditionelle Satzbezeichnung zu vermeiden[5], er verweist auf einen kreativen Prozess. Notations sind weniger bloße ›Notizen‹ eines Gedankens als vielmehr wohlgeformte und präzise formulierte Aphorismen, deren Inhalt sich weiter ausbreiten lässt. Ein Vorbild dafür erkennt Boulez in Wagners Verfahren der Themenausweitung:
[Wagner] hat […] schon im Rheingold Themen erfunden, die erst in der Götterdämmerung wirklich ausgearbeitet worden sind. Jahre später! Solche Motive sind für eine ›Wucherung‹ – ›prolifération‹ – geeignet. Und das war für die Bearbeitung meiner Notations sehr interessant.[6]
Im Gegensatz zu Wagner beabsichtigte Boulez aber anfänglich keine derartige Ausweitung. Die Idee dazu entstand erst, nachdem ihm das lange (und inzwischen wieder) verschollene Manuskript als Kopie vorlag und er die Ideen »noch frisch und lebendig« vorfand.[7]
Auffällig ist zunächst, dass sämtliche 12 Stücke jeweils 12 (unregelmäßig gefüllte) Takte umfassen und immer alle 12 Töne der chromatischen Skala verwenden. Diese Beschränkungen zwingen zur Ausformulierung der Idee auf engstem Raum.
Der Orchesterfassung sind die Klavierstücke im Druckbild vorangestellt. Diese Synopse dient nicht allein der Erinnerung an die über dreißig Jahre trennende Ausführung beider Versionen oder dem bloßen Verweis auf die Klavierstücke als Material der Orchesterstücke: »Notations besteht aus 12 Stücken« wird im Klappentext der Orchesterfassung 1978 lapidar verzeichnet. Sind damit die Klavierstücke gemeint? Oder die Orchesterstücke inklusive derjenigen, die noch nicht vorliegen?[8] Die Zusammenschau von Titel, Klappentext und graphischer Darstellung beider Zyklen in der Partitur verweist auf den kreativen Prozess, der die Klavier- und Orchesterstücke zusammenbindet und regt zu einer vernetzenden Lesart an.[9] Denn warum spricht Boulez nicht von 24, 16 oder sogar nur von vier Stücken? (Nur die vier bis 1978 abgeschlossenen Orchesterstücke liegen im Druck vor.) Allein dadurch, dass die Orchesterstücke sich auf die Klavierstücke als Material berufen, bilden sie mit jenen noch keine zyklische Einheit. Boulez legt vielmehr nahe, es handle sich z.B. bei dem Klavierstück I und dem Orchesterstück I um unterschiedliche Ausführungen ein und desselben Gedankens, in dessen Neuformulierung sich das kompositorische Potential des späteren Boulez realisiere.
Zur Reihenstruktur der Notations für Klavier[10]
Auf die Unregelmäßigkeit der den Notations zugrunde liegenden Zwölftonreihe wurde verschiedentlich hingewiesen.[11] Misch betont, die häufigen Quart- und Quintbezüge würden durch Halbtonschritte von tonal-harmonischen Assoziationen befreit.[12] Sie finden sich zwischen den chromatischen Blöcken der Töne 1, 2, 5 und 3, 4, 6 sowie zwischen den Tönen 7, 9, 12 und 8, 10, 11. Eine Teilung in zwei Reihenhälften macht deutlich, dass zwei dreitönige chromatische Ausschnitte des chromatischen Totals vertauscht sind: Das symmetrische Prinzip der Reihenbildung wird durch diese Asymmetrie verschleiert. Überdies bilden die Töne 8–12 die retrograde Inversion zu 2–6, wobei 4–6 und 8–10 nicht exakt symmetrisch sind: Die Töne 5 bzw. 9 weichen um einen Halbton voneinander ab, was durch den Ganztonschritt 4/6 und 8/10 ausgeglichen wird. Insofern bildet der siebte Ton die interne Achse einer teils exakten, teils getrübten Symmetrie, die im Gesamtgefüge asymmetrisch positioniert ist:
Beispiel 1: Pierre Boulez, Notations, Zwölftonreihe
Diese Zwölftonreihe wird zu Beginn von Notation I vorgestellt und bildet das Material aller 12 Stücke:
Beispiel 2: Pierre Boulez, Notation I für Klavier, T. 1–4
Aber nicht nur die Einheitlichkeit des Reihenmaterials und der Taktzahl gewährleistet den zyklischen Zusammenhang der 12 Stücke. Die Klavierfassung scheint eine feste Reihenfolge zu erfordern, insofern fast allen Stücken eine Reihenpermutation zugrunde liegt, die mit einem Ton beginnt, dessen numerische Position in der Reihe der Nummer des jeweiligen Stückes entspricht. Die in Notation I vorgestellte Reihe wird in der zweiten Notation wieder aufgegriffen, aber um einen Ton verschoben: b-es-d-a-e-c-f-cis-g-fis-h-as (T. 4–6). Dasselbe Prinzip wiederholt sich in Notation III; hier beginnt die Reihe mit es, während as und b am Ende angeschlossen werden: es-d-a-e-c-f-cis-g-fis-h-as-b (T. 1–3). Die Reihenfolge der Orchesterstücke hingegen soll »in Bezug auf Kontrast des Tempos und des Charakters ausgewählt werden«[13] und kann daher von der Reihenfolge der Klavierstücke abweichen. Auch können die »einzelnen Teile […] unabhängig voneinander aufgeführt werden.«[14] Das zyklische, eher einer formal-spielerischen Erprobung von Techniken geschuldete Prinzip der Klavierfassung, scheint in den Orchesterstücken zugunsten der (charakterlichen) Ausdrucksprinzipien aufgegeben worden zu sein. Die Klavierfassung arbeitet die jeweiligen Eigenschaften der permutierten Reihen klar heraus, lässt aber eine durchgehend geplante Kontrastwirkung zwischen den Stücken nicht erkennen. Notation IV verlegt den vierten Anfangston d an den Beginn des oberen Systems. Ihm voraus geht eine sich taktweise wiederholende, sechstönige Ostinato-Figur, die sich aus e–a im unteren und b–es im oberen System zum chromatischen Total schließt. Die permutierte Reihe zeigt eine an der Grundreihe orientierte Neuordnung:
P0 | as | b | es | d | a | e | c | f | cis | g | fis | h | as | b | es | d | a | e | c | f | cis | g | fis | h |
|
|
neue Reihe | a | e |
| f |
| g | fis |
| as |
|
| d |
|
| c |
| cis |
|
| h | b | es | ||||
Tabelle 1: Pierre Boulez, Notation IV für Klavier, Reihenpermutation
Hier zeigen sich drei Zusammenhang bildende Aspekte: 1.) Die permutierte Grundreihe stiftet den Anfangston im oberen System. 2.) Die Grundreihe hingegen bildet den Ausgangspunkt für eine 3.) – gemessen an der bisherigen Methode – irregulär gebildeten neuen Reihe.[15] In Notation V erscheint die permutierte Grundreihe wieder vollständig, nunmehr aber im Krebs. Dieser beginnt in Takt 1 auf d in der Oberstimme, das a als fünfter und bestimmender Reihenton fällt ans Ende in Takt 6. Notation VI bringt die Reihe in Fortsetzung dieser Logik mit dem sechsten Ton auf e in Takt 1. In Notation VII wird eine ähnliche Reihentechnik wie in der vierten Notation angewandt. Beide Hälften der Grundreihe werden in größerer Unabhängigkeit verarbeitet. Die Töne 7–12 – kenntlich gemacht durch die Repetition im unteren System und die Vierundsechzigstel im oberen System – werden in Takt 2 durch die Töne 1–2 (as-b) und in Takt 4 durch die Töne 3–6 (es-d-a-e) zur vollständigen Zwölftonreihe ergänzt. Auffällig ist, dass auf die Herausarbeitung des siebten Tons c hier verzichtet wird. In Notation VIII bildet das f als achter Reihenton in Takt 3 den untersten Ton eines Akkordaufbaus, der – ergänzt um die Töne 9–12 – genau dem Prinzip der Reihenpermutation folgt. Auch hier wird mit einer Zerlegung der Grundreihe in zwei Reihenhälften gearbeitet, wobei das Material der zweiten Hälfte nur in den Vorschlags- und Haltetönen der beiden unteren Systeme erscheint, während das Material der ersten Hälfte nochmals geteilt wird in die zweitönige rhythmische Figur im oberen System und die in den unteren Systemen hinzutretenden Akkorde in den Takten 7, 8, 11 und 12. In Notation IX bringen die Takte 1–3 zunächst zwei Mal das gesamte Reihenmaterial in starker, irregulärer Permutation. Der erste Reihendurchgang endet in Takt 2 mit D-Fis-cis im unteren System, der zweite in Takt 3 mit cis2 im oberen System. Die zentrale Rolle von cis als neuntem Reihenton wird noch offensichtlicher, da nun auf cis von Takt 3–7 ein doppelter Reihendurchlauf folgt, der auf Permutationen nahezu verzichtet und in Takt 7 wieder auf cis endet. Der proportionale Bezug zur Grundreihe wird kenntlich durch die Verwendung des melodischen Phrasenschlusses in Takt 6 und 11 auf gis1 (as1). In Notation X wird die permutierte Grundreihe zum letzten Mal vollständig aufgenommen (mit g in T. 1). Nur die letzten vier Töne erhalten eine neue Ordnung: g fis h as b es d a / f e cis c. Notation XI bringt die stärkste Auflösung der Grundreihe. Sie beginnt mit einer Reihe von elf Tönen in den Takten 1–2; das ausgesparte e wird am Ende von Takt 2 nachgereicht. Zusammenhängende Partikel der Grundreihe bleiben deutlich erkennbar: 5-1-2-11-12-3-4-9-8-7-10-6. Eine Betonung des elften Reihentons fis aber bleibt aus. Notation XII schließlich greift noch einmal die Teilung der Reihe auf, nunmehr in Gestalt sechstöniger Akkorde, meist einhergehend mit der Vertauschung jeweils eines Tones der beiden Hexameter. Die beiden Hexameter werden der Reihenfolge ihres Auftretens in den Akkorden nach mehrfach vertauscht. In Takt 3 und dem ersten Akkord in Takt 4 sowie dem letzten Akkord in Takt 9 und dem ersten in Takt 10 erscheint die Reihe stark permutiert. Takt 12 verwendet den ersten Hexameter und einen dreitönigen Zusatz a-b-h, der auch in den Notations II und IX jeweils am Anfang und Ende genutzt wurde. Wie der erste Reihenton as das erste Stück eröffnete, so beschließt der zwölfte Reihenton h das zwölfte Stück und mit ihm den gesamten Zyklus.
Offenkundig zielt Boulez auf die Ausschöpfung vieler Möglichkeiten auf engstem Raum. Auffälligste Merkmale der Reihenverwendung sind der wandernde Anfangston bei Konstanz der Grundreihe, die Nutzung mehr oder weniger verschleierter Hexameter und das Fehlen thematischen Reihendenkens sowie einer strengen Bindung der Reihentöne hinsichtlich Anzahl und Folge. Eine schematisch-einheitliche Verarbeitung der Reihe wird bewusst vermieden. So werden im Falle der Reihenpermutation insbesondere der Stücke 1–3 zunächst Spuren von Regelhaftigkeit ausgestreut (Rotationsprinzip), die sich daran anschließenden Erwartungen dann aber – vielleicht nicht ohne Absicht – enttäuscht. Anhand der Notations I und IV soll eine nähere Untersuchung weiterer Parameter folgen, bevor ein Vergleich mit den Notations für Orchester angeschlossen wird.
Notation I für Klavier
Beispiel 3: Pierre Boulez, Notation I für Klavier
Die ersten beiden Takte von Notation I für Klavier sind sowohl durch Kontraste voneinander geschieden als auch durch gemeinsame Elemente aneinander gebunden. Der erste Takt beginnt mit einem Halteton auf as1 und einer aufsteigenden Zweiunddreißigstelbewegung mit abschließendem Achtel. Der Aufstiegsbewegung antwortet in Takt 2 eine Abstiegsbewegung von fünf Sechzehnteln in tieferer Lage. Während die Aufstiegsbewegung legato mit Pedal erklingt, erfolgt die Abstiegsbewegung ohne Pedal im staccato. Darüber hinaus bleibt das mezzopiano in Takt 1 konstant, während es in Takt 2 zum pianissimo diminuiert wird. Diesen Kontrasten stehen einige Gemeinsamkeiten beider Takte gegenüber. Takt 2 weist dieselbe Tonmenge auf wie Takt 1, enthält wie dieser keine Tonrepetitionen und übernimmt zunächst das eröffnende mezzopiano. Das Fis1 in Takt 3 wird als fortgesetzte Abwärtsbewegung an Takt 2 gebunden, erscheint aber durch die vorangehende Pause isoliert. Die Vertikalisierung der Zwölfton-Grundreihe in Takt 4 übernimmt nicht deren Intervallverhältnisse. Sie geschieht außerdem vor der vollständigen Entfaltung des Materials. Der zwölfte Ton h4 wird oktaviert nachgeschlagen. Insofern er die Reihe vervollständigt, bleibt er an Vorhergehendes gebunden. Zugleich aber drängt er durch seine exponierte Stellung nach der Hauptzählzeit vorwärts. Bereits in Takt 1 wurden Elemente geschichtet, nämlich der Halteton auf as1, die Zweiunddreißigstel-Triole und das Achtel. Nach den fünf Repetitionstönen in den Takten 5–6 wird dieses Verfahren in den Takten 7–8 fortgesetzt. Dabei bildet sich der Halteton G1 in den Takten 7–8 aus den sich in Anzahl und Dauer verkürzenden Repetitionstönen der Takte 5 und 6: Takt 5 bringt dreimal G1 in Achteln, Takt 6 zweimal; in Takt 7 erscheint G1 einmal als vorschlagendes Achtel vor dem Akkord, und in Takt 8 wird dieser Vorschlag nochmals diminuiert, quasi halbiert. Dieser Verkürzung entspricht umgekehrt die sukzessive Erweiterung des repetierenden gis2 in Takt 8 von einem Achtel zu einem punktierten Viertel. Zudem korreliert das G1 ab Takt 5 hinsichtlich Lage, Dauer und Anschlagsart mit dem Fis1 aus Takt 3. Das vorschlagende Achtel in Takt 7 wiederum lässt sich als umgekehrte Bewegung zum nachschlagenden h4 in Takt 4 lesen und bildet durch seine tiefe Lage zu diesem einen Kontrast. Ebenso kontrastieren die Akkorde in den Takten 4 und 7 durch fortissimo und pianissimo. In Takt 7 schichten sich über den Halteton G1 die harmonische Entfaltung des auf c transponierten Reihenmaterials und eine melodische Bewegung, die an Takt 1 in rhythmischer Veränderung erinnert. In dieser Legato-Bewegung wird der Zusammenhang der beiden Vorschläge durch die Nähe der Töne d3 und cis3 verstärkt. In Takt 8 findet sich ein weiterer Vorschlag b-h mit Rückbezug auf Takt 7. Das repetierende gis2 in Takt 8 setzt die auf c transponierte Reihe aus Takt 7 mit dem sechsten Ton fort. Hieran anknüpfend repräsentieren e1 und a1 in Takt 9 einerseits die Reihentöne 7 und 8, während sie andererseits modulierend der hier mit den Reihentönen 5 und 6 einsetzenden Grundreihe auf as angehören. Die melodische Figur in Takt 9 bereitet crescendierend ihr Echo in Takt 10 vor. Die Tonfolge cis2-h1-es2 in der Oberstimme von Takt 9 wird in Takt 10 um eine Oktave transponiert wiederholt, ebenso die Tonfolge g1-fis1-d2 aus der Unterstimme von Takt 9. Die in Takt 9 ausgesparten Töne as und b werden in Takt 10 nachgereicht und bilden zugleich den Ausgangspunkt einer weiteren Entfaltung aller 12 Töne. Takt 12 wiederholt die rhythmische Figur und das Tonmaterial aus Takt 1, greift aber durch die Transposition der letzten beiden Töne in die Unteroktave die Bewegungsrichtung aus Takt 2 auf. Kann der ›fanfarenartige‹ Takt 1 als Eröffnungsformel beschrieben werden, so wird in Takt 12 durch Tonhöhenumstellung aus dem gleichen Material die Wirkung einer Schlussformel erreicht. Dadurch entsteht ein Rahmen, der Geschlossenheit vermittelt.
Notation IV für Klavier
Beispiel 4: Pierre Boulez, Notation IV für Klavier
In Notation IV sind beide ›Stimmen‹ konsequent jeweils einem der zwei Notensysteme zugeteilt, wobei in der Unterstimme sechs Töne einer Zwölftonreihe taktweise je einmal wiederholt werden, während die Oberstimme die übrigen sechs Töne sukzessive einführt. Auf diese Weise sind erstmalig mit dem es2 in Takt 5 alle zwölf Töne der Skala in Erscheinung getreten. Auffällig ist die lückenlose Chromatik der sechstönigen Reihenhälften. Die Statik der Unterstimme wird durch rhythmische Verschiebungen aufgebrochen. Der Einsatz additiver Werte folgt dabei einem festen Muster, das die Unterstimme in drei Abschnitte gliedert: In Takt 5 bildet das f1 der Unterstimme eine rhythmische Achse, von der aus die Komposition ›rückwärts‹ läuft. Dies wird am besten sichtbar an den rhythmischen Werten der Haltenoten auf as1 (T. 5 = T. 4 = 7 Sechzehntel, T. 6 = T. 3 = 11 Sechzehntel, T. 7 = T. 2 = 10 Sechzehntel, T. 8 = T. 1 = 8 Sechzehntel). Mit Takt 8 wird der Anfang des Stücks erreicht, und es beginnt von vorn (T. 9 = T. 1, T. 10 = T. 2 etc.). Die ›valeurs ajoutées‹ lösen den Rhythmus vom Metrum. Nach Abschluss des Reihenaufbaus in Takt 5 werden in Takt 6 die Töne 10–12 (h2-b2-es2) in ›gestauchter‹ Form repetiert, bis in der Mitte von Takt 7 der siebte Reihenton (d2) spannungslösend aus der melodischen Schleife herausführt. Hier tritt die aus der Grundreihe gewonnene Zwölftonreihe zum einzigen Mal sukzessive in Erscheinung:
a | e | f | g | fis | as | d | c | cis | h | b | es |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tabelle 2: Pierre Boulez, Notation IV für Klavier, Reihenpermutation, T. 7
In den Takten 8–9 bildet die Repetition der Reihentöne 7–9 eine weitere melodische Schleife, die mit Eintritt des h1 am Ende von Takt 9 verlassen wird. In den Takten 10–11 nun werden die im gesamten Stück sich einander kontrastierend gegenüberstehenden Dreitongruppen verzahnt, um gleich darauf zu ›zerplatzen‹. Takt 12 bringt zu den sechs Tönen der Unterstimme noch einmal vollständig die Töne der Oberstimme, so dass beide Reihenhälften einander als Frage und Antwort zu ergänzen scheinen. Diese Wirkung wird verstärkt durch Entsprechungen hinsichtlich Tondauern und Anschlagsart. Dabei erscheinen die Töne es2-d2-c2-cis2 im oberen System als transponierte Umkehrung der Töne e1-f1-g1-fis1 des unteren Systems. Außerdem korrelieren die charakteristischen Quartsprünge b2-es2 (Oberstimme) und a1-e1 (Unterstimme).
Notation I für Orchester
Die Notwendigkeit, die Notations für Orchester gegenüber ihrer knappen Vorlage zu erweitern, erläutert Boulez wie folgt:
[…] Für einen großen Orchesterapparat waren diese Stücke viel zu kurz. Es gibt ja mehr oder weniger ein Verhältnis zwischen der Länge eines Stückes und der Größe eines Apparats. Also musste ich diese Ideen bearbeiten, als rohes Material. […] Einerseits gab es da eine große Distanz zu den Ideen, die weit zurücklagen, gleichzeitig aber waren diese Ideen für mich voller Möglichkeiten, die ich 1945 überhaupt nicht gesehen hatte. Es waren Jugendstücke, gesehen durch den Spiegel von heute.[16]
Mit einer Erweiterung von 12 Takten auf 56 Takte und einer in der Partitur angegebenen Spieldauer von 2'20'' gegenüber etwa 0'50'' der Klaviervorlage ist das Orchesterstück immer noch recht kurz.
In den fünf[17] bisher vorliegenden Orchesterteilen der Notations bleibt die Vorlage in Bezug auf Tonfolge und rhythmische Gesten erhalten. Notation I für Orchester erfährt zwei Erweiterungen, die zu einer Dreiteiligkeit führen. Sie betreffen die Takte 1–9 und 40–56, deren formaler Aufbau Parallelen aufweist. (Der Verlauf der Takte 9–40 entspricht exakt jenem der Takte 1–11 der Vorlage.) Drei variierende Anläufe in den Takten 1, 4 und 7 führen schließlich zum Eintritt des Mittelteils in Takt 9. Deutlich zeigt sich das Variationsprinzip im wechselnden Einsatz der Trompeten auf es2 (T. 1–3 mit as in Vc. I+VI), das dem Halteton as1 aus Takt 1 der Vorlage entspricht. Die drei Anläufe setzen sich aus den vier Elementen der Takte 1–2 der Vorlage zusammen: E1 = Halteton, E2 = Triole, E3 = Halteton (Achtel), E4 = Staccato-Figur. Dabei kommt es sukzessive zu einer vertikalen Verdichtung und einer horizontalen Erweiterung; die Elemente werden miteinander ›tropiert‹, (z.B. Vl. II: T. 3 Gruppe 1–4, T. 6 Gruppe 1–6, T. 8 Gruppe 1–8, ebenso Vl. I: T. 8 sukzessive alle Gruppen).
Wo die Vorlage in der Orchesterbearbeitung erkennbar bleiben soll, sind markante Rhythmen und Tonfolgen herausgearbeitet. So wird der Beginn des Mittelteils (T. 9) durch die Fanfare in den Flöten markiert. Ebenso macht die absteigende Staccato-Figur in den Takten 11–12 den Bezug zu den Takten 2–3 der Vorlage deutlich. Das fortissimo subito in Takt 4 der Vorlage wird in den Takten 13–14 vollständig umgestaltet. Hier wie in allen analogen Situationen von Notation I erhält der Eintritt eines Akkordes einen dynamisch anschwellenden Vorlauf. Dazu werden bereits etablierte Elemente genutzt: in Takt 13 die Staccato-Figur aus Takt 2, in Takt 14 die Triolen-Figur aus Takt 1. Die Umwandlung rhythmischer Ereignisse in Gesten zeigt sich in Takt 17–21 besonders deutlich. Jedem einzelnen der fünf Schläge auf G1 aus den Takten 5–6 der Vorlage entspricht hier ein ganzer Takt mit dynamisch ausdifferenzierter, durch Zweiunddreißigstel in den Kontrabässen weich gezeichneter Fläche. Hinzu tritt die Überlagerung dreier weiterer Elemente. In der Violine I, Gruppe 1–4, wird die Staccato-Figur aus Takt 2 nochmals aufgegriffen und über fünf Takte zu einer absteigenden Linie cis3-a2-b1-fis1-c1 in langen Trillern zerdehnt. Ihre Tonfolge entspricht dem Akkord aus Takt 4 der Vorlage, der sich, horizontal aufgefächert, bis zum c1 in Takt 21 zusammenzieht. Den Trillern sind wiederum die Triolen-Figuren aus Takt 1 angefügt. Die Takte 17–22 vereinen also den Fortgang der Takte 5–6 der Vorlage mit der Aufschichtung von tropierten Elementen aus den Takten 1–4. Die Faktur der Takte 13–22 zeigt insgesamt das Anschwellen zur höchsten Akkorddichte und das Abschwellen bis zum vollständigen Verstummen auf der Achtelpause in Takt 22, eine ebenso ausdifferenzierte wie großflächig Zusammenhang stiftende Geste. Hier wird sichtbar, dass die aus der Vorlage übernommenen musikalischen Ereignisse nicht nur wie dort das Folgegeschehen beeinflussen, sondern nach ihrer Einführung als tropierende Elemente weiter verfügbar bleiben.
Der erste Teil (T. 1–9) und der letzte Teil (T. 40–56) verarbeiten gleichermaßen die Takte 1–2 und 12 der Vorlage. Die fanfarenhafte Eröffnungsformel in Takt 1 der Vorlage wurde allein durch Oktavtransposition zur Schlussformel in Takt 12. Takt 2 hingegen ist als kontrastierende Antwort zu Takt 1 von jenem schwer zu trennen. Es stellt sich daher die Frage, ob das Aufgreifen von Takt 1 in Takt 12 der Vorlage nicht ebenfalls eine Verarbeitung von Takt 2 einbeziehen müsste. Diesem Problem begegnet die Orchesterfassung, indem sie im dreifach variirten Beginn (T. 1–9) und im dreifach variierten Schluss (T. 40–56) gleichermaßen T. 1–2 und 12 der Vorlage verarbeitet. Dabei werden im Schlussteil die Elemente aus den Takten 1 (Halteton, Triolen, Halteton) und Takt 2 (Staccato-Figur) vertauscht, so dass er gewissermaßen ›rückläufig‹ gebildet erscheint. Die Takte 40, 44, 48 und 52 bringen die Staccato-Figur vor den Triolen, die ihren schlussbildenden Charakter hier ganz verlieren. Die Staccati werden, unter Verwendung nahezu des gesamten Orchesterapparats, als Gesten des Ersterbens eingesetzt. In Takt 40 erscheint die Staccato-Figur in Sechzehnteln verbunden mit einem Diminuendo von f zu mp, in Takt 44 in Achtel-Triolen, diminuiert von mp zu p, in Takt 48 in Sechzehnteln, diminuiert von mf zu pp und in den Takten 52–53 im Rahmen eines auskomponierten Ritardandos in Sechzehnteln, Achtel-Triolen und Achteln die ganze dynamische Palette von ff bis pp durchlaufend. Dazwischen wirken die Triolen wie ein Verharren, Atemholen. Das Aufeinandertreffen von Anfang und Ende wird hier selbstreflektorisch zum Ereignis und Thema. Die Orchesterfassung mündet nicht in ein definitives Ende wie es die Schlussformel der Vorlage durch die Pedalanweisung »strictement« nahe legt. Die absteigende Bewegung wird in Takt 54 durch Haltetöne im pp aufgefangen, und die erwartete Triolen-Figur erscheint in Takt 55 ins pp diminuiert, ohne Sturz, stattdessen ergänzt durch aufsteigende Figuren, die Haltetöne bleiben im ppp stehen, das As am Ende entspricht dem Anfang.
Notation IV für Orchester
Notation IV für Orchester weitet die 12taktige Vorlage auf 76 Takte aus. Der in der Partitur angegebene Spieldauer von 1'25'' steht jene der Klavierfassung von etwa 0'30'' gegenüber. Das zweischichtige Satzprinzip der Vorlage bleibt jedoch durchgehend erhalten. Die Nummerierung der Partitur folgt den Taktzahlen der Vorlage.
Ein wichtiges Mittel der Erweiterung wird bereits in den Takten 1–2 der Orchesterfassung exemplarisch vorgeführt. Ausgangspunkt ist der erste Hexameter aus Takt 1 der Vorlage (unteres System). Die Tonfolge a-e-f-g-fis-as wird durch sukzessive Einsätze im Achtelabstand wiederholt, zugleich stiftet jeder Ton das Transpositionsintervall weiterer Hexameter, die ebenfalls durch sukzessive Einsätze im Achtelabstand wiederholt werden. Diese liefern keine weiteren Transpositionsintervalle:
Beispiel 5: Pierre Boulez, Notation IV für Klavier, T. 1 (unteres System)
| T. 1 |
|
|
|
|
| T. 2 |
|
|
|
|
Oboe 1, Xyl., Cel., Vc. 1+2 |
| a | e | f | g | fis | as |
|
|
|
|
Vibr., Hrf. 2, Vc. III+IV, |
|
| a | e | f | g | fis | as |
|
|
|
Almgl., Vla. I |
|
|
| a | e | f | g | fis | as |
|
|
Hrf. 1+3, Vc. V |
|
|
|
| a | e | f | g | fis | as |
|
Röhrengl., Vl. 2, I+II+VII |
|
|
|
|
| a | e | f | g | fis |
|
Kl. 1, Mar., Klav., Vla. IV |
|
|
|
|
|
| a | e | f | g | as |
Kl. 3, Vc. III+IV |
|
| e | h | c | d | cis | es |
|
|
|
Vla. III |
|
|
| e | h | c | d | cis | es |
|
|
Vc. VI |
|
|
|
| e | h | c | d | cis | es |
|
|
|
|
|
|
| etc. |
|
|
|
|
|
Oboe 3, Basskl. Vla. II |
|
|
| f | c | des | es | d | e |
|
|
Vc. V |
|
|
|
| f | c | des | es | d | e |
|
|
|
|
|
|
| etc. |
|
|
|
|
|
Tabelle 3: Pierre Boulez, Notations IV für Orchester, T. 1–2, Vertikalisierung und horizontale Verschiebung der Einsätze (Nachhall)
Es entsteht mit der horizontalen Ausweitung eine Vertikalisierung, die auf dem ersten Achtel von Takt 2 zum gleichzeitigen Einsatz der sechs Transpositionsintervalle führt (Viola IV–VII). Daraus ergibt sich eine Zunahme vertikaler Dichte bis zum chromatischen Total auf dem ersten Achtel von Takt 2, anschließend eine Abnahme auf die sechs Haltetöne der transponierten Hexameter in Takt 3. In fast allen Stimmen bleibt der sechste Ton als Halteton stehen. Dieser Halteton wird zum Mittel, die versetzten Gruppen im Akkord wieder zusammenzufügen. Er folgt rhythmisch-proportional nicht der Vorlage und ermöglicht dadurch eine freiere Erweiterung der Oberstimme in der Orchesterfassung.
Innerhalb des Klangfelds werden die auf a beginnenden, nicht transponierten Hexameter, wie die Tabelle zeigt, durch Schlagwerk (Xylophon, Celesta, Vibraphon, Almglocken, Röhrenglocken, Marimba) herausgearbeitet. Die auf e, f etc. beginnenden Hexameter erhalten insgesamt tiefere und weichere Register. Im weiteren Verlauf wird die raum-zeitliche Ordnung zunehmend verunklart durch ständig variierende, rhythmische Motive, harmonische Verzweigungen und wechselnde Register. Jede Stimme ist unterschiedlich gestaltet, d.h. die oft nicht mehr zu leistende Wahrnehmung einzelner, musikalischer Ereignisse wird in ein globales Hören der Gesamtgestalt überführt. Boulez begründet solche Überfülle aus der Absicht heraus, »die Aufnahmefähigkeit des Hörers«[18] zu übersteigen:
In einer sehr komplexen Passage […] sind die Überlagerungen manchmal so dicht, dass sie sich gegenseitig aufheben und letzten Endes ein Globaleindruck entsteht. Dieser Gegensatz zwischen der vollen Wahrnehmung und dem Aufnehmen in Bausch und Bogen, bei dem keine Einzelheit mehr erfasst werden kann, ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt.[19]
Wie die Vorlage geht auch die Erweiterung von dem Gedanken aus, bestimmte motivisch-thematische Gesten (insbesondere der oberen Schicht) in ihrer Signalwirkung nicht zu verletzen. Wie das Beispiel zeigt, zerlegt Boulez bestimmte Gesten in kleinste Partikel, deren rhythmisch-figurativen Charakter er mehr oder weniger erhält (c2 in T. 8 und 12 der Orchesterfassung), bestimmte melodische Elemente hingegen stark augmentiert:[20]
Beispiel 6: Pierre Boulez, Notation IV für Klavier, T. 2
Beispiel 7: Pierre Boulez, Notations IV für Orchester, Oboe 1, T. 8–13
In der Analyse der Notations I und IV für Orchester konnten insbesondere vier Verfahren der Wucherung herausgearbeitet werden:
eine besondere Form variierender Wiederholungen, die Boulez auch als »Tropustypen« bezeichnet[21],
horizontale Erweiterungen durch rhythmisch verschobene Schichtung (Nachhall),
vertikale Schichtung durch Transpositionen der Reihenintervalle,
Augmentation der zum Halteton hin tendierenden Melodiepartikel.
Innerhalb der ›Tropustypen‹ lassen sich zahlreiche weitere Verfahren zeigen, durch die alle Elemente in Beziehung treten können und die keiner einheitlich schematischen Regel folgen. Die »Möglichkeiten«, die Boulez in den frühen Notations sieht, liegen – unter der Voraussetzung multiplikativer Techniken – in einer äußerst aufwendigen Orchestrierung mit einem eigenen Part für jedes Instrument, die die Einfachheit des Kernmaterials durchscheinen lässt. Für den Hörer entsteht aus der Kombination aus einfachem Kernmaterial und entwickelter Textur gewissermaßen ein Labyrinth beschreitbarer Wege und kaum erschöpfbarer Perspektiven auf das musikalische Geschehen. Die komplexen Klangfarben werden nicht von der Klaviervorlage aus nachinstrumentiert, sondern – gemäß Boulez’ Angabe dem Vorbild Debussys folgend – unmittelbar vom Orchesterapparat her gedacht.
Wucherung als (poetologisches) Programm
Wucherung
Die Notations für Klavier und Orchester bilden hinsichtlich der Ausweitung der ursprünglichen Dimensionen einen Extremfall. Der Begriff ›Wucherung‹ beschreibt dabei nicht nur den Vorgang der Ausweitung, er provoziert auch ein ästhetisches Urteil. Das Deutsche Universalwörterbuch verzeichnet: »wuchern […]: 1. sich im Wachstum übermäßig stark ausbreiten, vermehren […]: das Unkraut wuchert; eine wuchernde Geschwulst; Ü hier wuchert die Prostitution. 2. mit etw. Wucher treiben […]: mit seinem Geld w.; Ü mit seinen Talenten w.«[22] So verstanden wird, wo Wucherungen auftreten, ein ›gesundes‹ System beschädigt oder vernichtet. Boulez’ Begriff der Wucherung ist frei von derartigen Konnotationen. Er dient der Bezeichnung eines regelhaften Wachstums, das von ›außen‹ begrenzt werden muss, weil die ihm zugrundeliegenden, regelgesteuerten Verfahren (wie zum Beispiel Variation, Transformation, Multiplikation) dem Wachstum keine Grenzen setzen:
Ich weiß, dass die Tendenz zur Wucherung gefährlich ist, weil sie zur immer gleichen Dichte führen kann, zu einer größten Dichte, einer höchsten Spannung oder einer äußersten Variierung in jedem Augenblick. Ich habe also in vielen Fällen reduzieren müssen, die Möglichkeiten beschneiden oder sie so in eine Abfolge bringen müssen, dass sie eine Entwicklung in der Zeit nahmen und nicht zu Überlagerungen führten, die zu kompakt gewesen wären.[23]
Auffällig an dieser Formulierung Boulez’ ist, dass er seine Tätigkeit auf die Ordnung und Reduktion beschränkt.[24] Es scheint einen bestimmten Grad an Erweiterung zu geben, den eine Idee verträgt. Der Komponist gestaltet die Form wie ein Landschaftsgestalter von außen, d.h. aufgrund von Kriterien, die außerhalb der Wachstumslogik liegen. Stilistische Überlegungen bestimmen etwa die ›Hüllkurve‹ als Grenze der Ausweitung. Die Idee bezieht sich bereits in ihrer ersten Erscheinung auf bestimmte Bedingungen, etwa in welchem Medium sie mit welchem Vokabular ausgeführt werden kann. Diese Bedingungen scheinen auch die Art, in der sich das Wachstum einer Idee vollzieht, zu bestimmen. Gleichwohl geht die Idee im Vokabular ihrer Verarbeitung nicht auf. Die der Idee innewohnende Wachstumsenergie drängt danach, die Grenzen ihrer ursprünglichen Bedingungen zu erweitern.
Der Begriff der Wucherung verweist nicht nur auf die Art des Wachstums und seine notwendige, äußere Begrenzung. Er impliziert zugleich Aussagen über die Gestaltbildung. So reflektiert Boulez den Begriff der Metamorphose, wie ihn z.B. Webern verwendet, ohne ihn in Anspruch zu nehmen. Vom Autorenteam Deleuze/Guattari schließlich wird Boulez’ Begriff der Wucherung mit dem Begriff des ›Rhizoms‹ in Verbindung gebracht.[25] Diesen Aspekten soll im Folgenden nachgegangen werden.
Über die ›Wucherung von Materialien‹ sagt Boulez: »Für mich ist eine musikalische Idee wie ein Samenkorn: man pflanzt es in eine bestimmte Erde und plötzlich vermehrt es sich wie ein Unkraut.«[26] Die Wucherung dieses »Unkrauts« setzt zuerst Wachstumsfähigkeit voraus. Die konkrete Gestaltbildung bleibt davon unberührt. Sie ist ohne die »bestimmte Erde« – das Medium und ein bestimmtes Vokabular – auch gar nicht denkbar. Dies legt den Gedanken nahe, nicht die Idee bringe die Form und ihre Sprache hervor, sondern sie werde durch eine Sprache zur Form gebracht. Damit entzöge sich aber das, was die Idee von einer Sprache oder Form unterscheidet, dem Blick. Träte die Idee als Form auf, wäre Boulez Metapher insofern unbefriedigend, da sie dann von vornherein in einer »bestimmten Erde« erschiene. Auch ist wenig befriedigend, der Idee nur eine Wachstumsenergie zuzusprechen, nicht aber eine Beteiligung an der Gestaltbildung. Denn ohne diese würde sich die Wucherung beliebig ausbreiten, gleichgültig, in welcher Sprache sie sich potenzierte, da diese zwar ein Vokabular stellt, in dem das Wachstum stattfindet, nicht aber Kriterien der Gestaltbildung selbst. Hier könnte angefügt werden, auch die Gestalt entstünde ›von Außen‹, als Ergebnis stilistischer Überlegungen. Dann würde aber – um in der Metapher zu bleiben – nicht nur die Grenze der Wucherung bestimmt werden, sondern die Pflanzenform selbst. Die Idee wäre dann eine nicht weiter hinterfragbare Wachstumsenergie, die in einer bestimmten Sprache unter bestimmten stilistischen Überlegungen zur Form käme. Es scheint aber eher, dass die Idee nicht nur durch die Sprache zur Form gebracht wird, sondern diese zugleich rückformt, also im Verhältnis einer formenden Formbarkeit steht.
Boulez betont seine Vorliebe für labyrinthische Formen, deren Details sich auch nach mehrfacher Betrachtung nicht restlos erschließen. Er folgt damit einer »romanhaften«[27] Poetologie. Während sich mit dem Kreislauf der Pflanzen-Metamorphose die Vorstellung einer Rückführbarkeit stark verzweigter Phänomene auf einen überschaubaren Ursprung verbindet, ist die Romanhandlung unumkehrbar: Die romanhaft entwickelte Wucherung kann nicht zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehren. Jeder Moment des Wachstumsprozesses nimmt eine einmalige Position in Raum und Zeit ein. Als Vorbild solcher Wucherungen nennt Boulez insbesondere die Werke von Johann Sebastian Bach und unter diesen insbesondere die Choralbearbeitungen.[28] Hier wird aus einer kleinsten Menge von Ideen (d.h. bei Boulez schon: Material, vom Cantus firmus ausgehend zur Gesamttextur) der gesamte Aufbau gestaltet. Ausweitung, Verzweigung, unumkehrbare Entwicklung vom Kern zur Peripherie: diese Konzeption der Entfaltung sieht Boulez bei Beethoven, Wagner und Berg ausgeprägt, weniger hingegen bei Webern, dessen Formen ihm zu »klar gefügt«[29] sind und dessen ästhetisches Programm sich im Spätwerk an der Metapher vom Pflanzenwachstum orientiert.
Metamorphose
Webern beruft sich auf Goethes Metamorphosenlehre: »›Die Wurzel ist eigentlich nichts anderes als der Stengel, der Stengel nichts anderes als das Blatt, das Blatt wiederum nichts anderes als die Blüte: Variationen desselben Gedankens.‹«[30] Dass Goethe die äußeren Phänomene in einem »Gedanken« wurzeln lässt, fordert dazu auf, die Metapher vom Pflanzenwachstum in die verschiedensten Gebiete der Kunst, Wissenschaft, Religion usw. zu übertragen. Für Boulez ist daran nicht die Bildung einer ersten Gestalt (bei Webern: der Reihe) problematisch, sondern die Rückführbarkeit aller Erscheinungen auf einen Ursprungsgedanken, der sich bloß selbst potenziert. Boulez’ Kritik des Metamorphose-Gedanken setzt voraus, beim Grundgedanken handle es sich um etwas statisch Gleichbleibendes. Es ist aber keineswegs zwingend, das Gleichbleibende des Gedankens in den verschiedenen Formen der Metamorphose als statische Größe zu verstehen. Es kann vielmehr alle Formen seiner möglichen Metamorphose umfassen und entzieht sich insofern der Darstellbarkeit. Grundgedanke und Grundreihe wären demnach nicht identisch. Vielmehr enthielte die Grundreihe den Grundgedanken ebenso wie er auch in allen Ableitungen zur Erscheinung käme. So schreibt Goethe über die Metamorphose:
Mit diesem Modell [der Urpflanze] und dem Schlüssel dazu [der Metamorphose] kann man alsdann noch Pflanzen ins Unendliche erfinden, die konsequent sein müssen: die, wenn sie auch nicht existieren, doch existieren könnten und nicht etwa malerische oder dichterische Schatten und Scheine sind, sondern eine innere Wahrheit und Notwendigkeit haben. Dasselbe Gesetz wird sich auch auf alles übrige Lebendige anwenden lassen.[31]
Jede Pflanze trüge demnach, in welcher Gestalt auch immer, die Urpflanze in sich. Diese bildet das allgemeine Gesetz einer unendlichen Menge möglicher Aktualisierungen. Die Problematik ist offenkundig: Goethe kann die Urpflanze selbst als Erscheinung nicht darstellen. Weberns Reihengestaltung lässt sich zwar auf die jeweilige Grundreihe zurückführen, ihr Grundgedanke aber entzieht sich ebenso der Darstellbarkeit wie die Urpflanze. Identität zwischen dem Grundgedanken und den Reihengestalten oder zwischen der Urpflanze und ihren verschiedenen Individualisierungen kann nur bestehen, wenn Grundgedanke und Urpflanze als transzendent wandelbar erfahren werden würden. (Diese Erfahrung würde einer allgemeinen Darstellung nicht bedürfen, die besonderen Darstellungen aber bedingen.) Der Grundgedanke ließe sich dann nicht erschöpfen. Erschöpfung gehörte einer stilistischen Beurteilung an, die der unendlichen Wandelbarkeit entgegen steht. So wird Boulez’ Urteil Weberns Intention nicht gerecht, sondern ist vielmehr eine Aussage über das eigene poetologische Programm. Die von Boulez angestrebte romanhafte Verzweigung befriedigt das Bedürfnis nach Unerschöpflichkeit nicht in der Transzendenz einfacher Formen, sondern in komplexen Verkettungen, Verweisen und Bezügen, die selbst unter der Voraussetzung eines permanenten Perspektivenwechsels nicht gänzlich erfasst werden können. Dies erinnert an ein Prinzip des Pflanzenwachstums, auf das sich Goethe nicht näher einlässt, »dass nämlich eine Pflanze die Kraft hat, sich durch bloße Fortsetzung völlig ähnlicher Teile ins Unendliche zu vermehren, wie ich denn ein Weidenreis abschneiden, dasselbe pflanzen, den nächsten Trieb wegschneiden und wieder pflanzen und so ins Unendliche fortfahren kann.«[32] Am Beispiel der Metamorphose wurde die potentiell unendliche Formenvielfalt von Goethe auf einen Grundgedanken bezogen, hier nun wird der Begriff der Unendlichkeit aus der unbegrenzten Wachstumsfähigkeit gewonnen, ohne den Kreislauf von Samen, Keim, Blatt, Frucht etc. aufgreifen zu müssen. Goethe scheint dieses Phänomen für nicht bedeutend genug gehalten zu haben, um es zum Gegenstand weiterer Untersuchung zu machen. Auch entsprach die Pflanzen-Metamorphose als Metapher eher dem teleologischen Geschichtsbild seiner Zeit. Boulez’ ›Wucherung‹ greift gerade den von Goethe nicht weiter verfolgten Gedanken einer unendlichen Vermehrungsfähigkeit und Wachstumskraft auf. Er mündet bei Boulez in die Möglichkeit einer unendlichen Vernetzung, dessen Vorbild er u.a. bei Mallarmé gefunden hat.[33]
Rhizom
1976, also nur zwei Jahre bevor Boulez die ersten vier Notations für Orchester vorstellt, erscheint der Essay Rhizom, in dem das Autorenteam Deleuze/Guattari das ›rhizomatische‹ Pflanzenwachstum als Metapher für das Formgeschehen zuvörderst in Literaturen etablieren möchte.[34] Die Autoren unterscheiden in diesem vielbeachteten Text drei Arten pflanzlicher Strukturbildung, die sie mit Arten von Büchern vergleichen.
Ein erster Buchtyp ist das Wurzelbuch. […] Das Gesetz des Buches ist dasjenige der Reflexion: das Eine, das zwei wird.[35] [Eine Reflexion, welche einer dichotomischen bzw. dialektischen Denkweise folgt.]
Die büschelige Wurzel oder das System der kleinen Wurzeln ist der zweite Buchtyp, den die Moderne gern für sich in Anspruch nimmt. Die Hauptwurzel ist verkümmert, ihr Ende abgestorben; und schon beginnt eine Vielheit von Nebenwurzeln wild zu wuchern. Hier erscheint die natürliche Realität als Verkümmerung der Hauptwurzel; gleichwohl besteht ihre Einheit als vergangene, zukünftige oder als mögliche fort. […] Die Wörter eines Joyce, denen man zu Recht ›Vielwurzeligkeit‹ nachsagt, brechen die lineare Einheit der Wörter, sogar der Sprache nur auf, um im gleichen Zuge eine zyklische Einheit des Satzes, des Textes oder des Wissens herzustellen. […] Die Welt hat ihre Hauptwurzel verloren, das Subjekt kann nicht einmal mehr Dichotomien bilden; es erreicht aber eine höhere Einheit der Ambivalenz und der Überdeterminierung in einer Dimension, die zu derjenigen des Objekts immer als Supplement hinzutritt.[36]
Als drittes nennen die Autoren nun das Rhizom, (welches sie nicht explizit als »Buchtyp« bezeichnen, sondern als »System«). Wenn es zu einem Buch führt, dann aus der Frage heraus: »Wie findet das Buch ein Außen, mit dem es sich im Heterogenen verketten, statt einer Welt, die es nur reproduzieren kann?«[37] Damit verweigert sich das Rhizom jenem Gedanken von Einheit, der in der »Moderne« als mystisches Postulat das Aphoristische oder die »Vielwurzeligkeit« zusammenbindet. Beim Rhizom zielt alles auf Heterogenität und Vielheit. Das Eine verhält sich zur Vielheit wie n - 1, es ist »Teil der Vielheit, wenn es von ihr abgezogen wird.«[38] Die Vielheit ist weder eine fortgeschrittene Zersplitterung der Einheit noch der periphere Ort einer Vernetzung, die von einem Zentrum ausgeht. »Der Baum und die Wurzel zeichnen ein trauriges Bild des Denkens, das unaufhörlich, ausgehend von einer höheren Einheit, einem Zentrum oder Segment, das Viele imitiert.«[39] Dem setzen die Autoren ein nicht hierarchisches System gegenüber: »Eine Transduktion intensiver Zustände löst die Topologie ab: ›Der Informationsfluss wird von einem Graphen geregelt, der sozusagen das Gegenteil des hierarchischen Graphen ist […]. Es gibt keinen Grund, dass dieser Graph ein Baum sein muss.‹ (Einen solchen Graphen nennen wir Karte).«[40] Rhizome konstruieren anstatt zu reproduzieren. Der Aufspaltung von Welt und Abbildung stehen Zustände unterschiedlicher Intensität gegenüber. Innerhalb dieses Systems wäre z.B. die Sekundärliteratur der Primärliteratur weder beigestellt noch untergeordnet, da der Begriff der Sekundärliteratur selbst keinen Sinn macht; der Primärtext ist nicht Abbild der Welt und der Sekundärtext Abbild der Wirklichkeitsauffassung, die der Primärtext impliziert, sie sind gleichermaßen n - 1, Teile von Vielheiten, hierarchielos.
Es fällt auf, dass der Begriff des Organischen hier gegen den eines Mechanischen oder Maschinellen getauscht wird. Es gibt nur ein Außen, eine Vielheit, eine Verkettung. Die Autoren übertragen diesen Gedanken auch auf die Musik:
Die Musik hört nicht auf, ihre Fluchtlinien ziehen zu lassen, gleichsam als ›Transformations-Vielheiten‹, und kehrt dabei sogar ihre eigenen Codes um, die sie abrifizieren und strukturieren; die musikalische Form ist so bis in ihre Brüche und Wucherungen hinein dem Unkraut vergleichbar, ein Rhizom.[41]
Die Einmischung der Begriffe ›Wucherung‹ und ›Unkraut‹ überrascht nicht: Die Autoren berufen sich auf das oben bereits verwendete Zitat von Pierre Boulez zur Wucherung der Ideen.[42] Allerdings stellt sich diese Inanspruchnahme als problematisch heraus, weil keineswegs klar ist, ob das, was hier als musikalische Wucherung bezeichnet wird, im Sinne der Autoren rhizomatisch ist oder dem von ihnen verworfenen Typus der ›Moderne‹, also einer vielperspektivischen Vernetzung entspricht, die von einem Zentrum ausgeht oder ein solches hinzufügt. Dass Boulez in seiner (oben zitierten) Metapher ›Idee‹ und ›Samenkorn‹ als Ausgangspunkt der ›Wucherung‹ in Analogie bringt, spricht gegen eine rhizomatische Deutung.[43] Auch wenn die Idee als Ausgangspunkt nicht absoluter Beginn ist, so zeigt sie sich doch in ihrer ersten Erscheinung als raum-zeitliche Setzung.[44]
Bei Boulez scheint die Wucherung nach einem Bauplan oder genetischen Code zu verlaufen, der nicht unmittelbar aus der Idee oder einer ersten Setzung des Materials hervorgeht. Sie organisiert sich selbst und entfaltet von innen her eine ihr eigene Wachstumsenergie. Die Begrenzung und Auswahl, das ›jäten‹, die Entscheidung zu einer bestimmten Form des Werkes hingegen geschieht offensichtlich von außen. (›Außen‹ meint hier alle Überlegungen und Erfahrungen, die dem Komponisten ein Repertoire von Entscheidungsmöglichkeiten geben.) Auf der anderen Seite eröffnen sich auch die Möglichkeiten der Wucherung erst durch den Blick von außen, durch die Forschung nach dem Inneren der Idee.[45] Das Verhältnis von Innen und Außen wird hier mehrfach umkehrbar: Jene wechselseitige Korrespondenz von Subjekt und Objekt, die bei Deleuze/Guattari gegen subjekt-objektfreie Verkettungen ausgetauscht wird, bleibt erhalten. Auch insofern ist die Wucherung bei Boulez mit dem Konzept des Rhizoms von Deleuze/Guattari nicht gleich zu setzen.
Im Gegensatz zum Goetheschen Metamorphose-Gedanken geht Boulez nicht von hierarchischen Stufen aus, sondern von einer Verfeinerung und Steigerung, die schließlich zu einer Übersättigung führt. Wie bei Goethe der Metamorphose-Gedanke das Geschichtsbild prägt, so bei Boulez der Gedanke von ›Wucherung und Übersättigung‹:
Im Gegensatz zu den klassisch orientierten Stilen haben die barock orientierten die Neigung, ein Schema solange beizubehalten, bis es den Beweis seiner Unbrauchbarkeit erbracht hat. Meiner Meinung nach beruht die Kontinuität der Geschichte gerade auf diesem übertriebenen Spannungsgrad, der jäh abfällt, bei einem Nullpunkt wieder beginnt, sich von neuem auflädt und steigert, bis es wieder zu einem Zusammenbruch kommt. Für mich nimmt die Geschichte keinen gradlinigen, sondern einen sinusförmigen Gang; sie verläuft über positive Punkte, fällt auf Null zurück, geht dann über negative Punkte, gelangt wieder zu Null usw. Ich habe ein sinusförmiges oder spiralförmiges Bild von der Geschichte […].[46]
Bei Boulez entfaltet sich die Idee in einem bestimmten Vokabular bzw. einen bestimmten Stil. Die Idee ist außerhalb der Form, in der sie erscheint, nicht fassbar. Insofern sie als Form erscheint, ist sie bereits einem bestimmten Vokabular eingepasst, das einer bestimmten Verbindlichkeit unterliegt. Das erklärt, warum Boulez Idee und Material gleichsetzen kann. Es gibt jedoch auch bei Boulez den Versuch, die Idee bis an den Ursprung ihrer Erscheinung zu verfolgen, einen Moment der Unentschiedenheit und des Übergangs in die Form:
Die Anfangs-Idee: Ist sie so real, wie ich sie beschrieben habe? Es scheint an der Ausgangsbasis der Komposition auch völlig virtuelle, in hypothetischem Zustand befindliche Ideen zu geben. Die Komposition hängt demnach von der Konfrontation dieser Hypothesen mit der Wirklichkeit des musikalischen Materials ab: Sie bestätigen und modifizieren sich in dieser Konfrontation. Das Gedächtnis spielt bei dieser Art von Anfangsidee eine weit geringere Rolle, weil die Idee hier beträchtlich konzeptueller ist und nicht durch die Bedingtheit einer bestehenden Sprache eingeengt wird. Tatsächlich ließen sich so abstrakte Anfangsideen nach einem beliebigen Code verwirklichen. Es handelt sich um Gesten im Reinzustand, um Gesten, die allenfalls auch in einer anderen Ausdrucksform sich bilden könnten. So kann der Komponist, wenn er ein Bild ›liest‹, wenn er über irgendein Phänomen nachdenkt, sich von dem berühmten ›Dämon der Analogie‹ erfasst fühlen.[47]
Die Ideen sind demnach für einen »beliebigen Code« offen, weil sie reinen Gesten entsprechen. Vom formalen Standpunkt aus, dass jede Idee oder jeder Inhalt eine Erscheinungsform haben muss, sind auch Gesten in irgendeiner Weise codiert. Insofern nimmt die ›reine« Geste bei Boulez die Funktion einer übergeordneten Sprache ein, auf die sich sehr unterschiedliche Sprachen und Codes beziehen können. Die ›reine‹ Geste ähnelt einer bestimmten Vorstellung von ›Licht‹ in der Romantik: Sie ist in viele Sprachen und Codes übertragbar, weil sie die Grenze von Sprache als Form und Verweisungsspiel in Frage stellt. Die ›reine‹ Geste wird bei Boulez aber von der entgegengesetzten Seite erreicht. Die Vorstellung eines ›Lichtes‹, das sich in Künsten und Wissenschaften wie im Prisma zu unterschiedlichen Farben bricht, umgeht das Form- und Sprachproblem durch Transzendierung. Die ›reine‹ Geste hingegen entspricht statt einer Transzendierung einer höheren Abstraktion, auf die die Codes sehr verschiedener Sprachen fixierbar sind. Damit bleibt aber ein Rest von konkreter Form und Sprache immer erhalten. Der ›Reinzustand‹ der Gesten beschreibt daher die Grenzen abstraktester Sprachformen, vielleicht auch eine gewisse Sehnsucht, diese Grenzen auf ›reine‹ Inhalte oder Ideen hin zu überschreiten.
Anmerkungen
Zit. nach Zuber 1995, 35. | |
Boulez 2000, 60. | |
Boulez 2000, 22–23. | |
UA 1945 durch Yvette Grimaud, 1985 publiziert. | |
Vgl. Hirsbrunner, 1986, 2, sowie ders. 1985, 33ff. | |
Zuber 1995, 35. | |
Ebd., 32. | |
1978 veröffentlicht Boulez vier Orchesterstücke auf Grundlage der ersten vier Klavierstücke. Das 1997 uraufgeführte Notations VII steht bislang nur als Leihmaterial zur Verfügung. Hirsbrunner (1986, 2) nennt 4 [also noch 3] weitere Stücke, die am 4. September 1985 auf den Internationalen Musikfestwochen Luzern uraufgeführt werden sollten, aber nicht rechtzeitig fertig wurden. | |
Ofenbauer sieht die Orchesterfassung nach Kriterien der »Dekonstruktion« gestaltet (1995, 56). | |
Umfassende Untersuchungen der Notations für Klavier bieten Hirsbrunner (1986, 2–20) und Nemecek (1998). | |
Hirsbrunner 1986, 3, und Misch 2004, 61. Misch zeigt eine vergleichende Analyse der Notations I–IV und arbeitet wesentliche Aspekte der ›musikalischen‹ Wucherung heraus. | |
Misch 2004, 61. | |
Boulez 1978, Klappentext. | |
Ebd., Hervorhebung vom Verfasser. Für die Orchesterstücke legt Boulez (aus Gründen der musikalischen Ökonomie eines großen Orchesterapparats) eine Menge von mind. vier Stücken fest. 1978 schlägt er die Reihenfolge I, IV, III, II vor, seit Hinzutreten von Notations VII (1997) die Reihenfolge I, VII, IV, III, II oder I, III, IV, VII, II. | |
Misch (2004, 64) weist darauf hin, dass der Anfangston as sowie es aufgrund seiner »Schlüsselfunktion« in den Klavierstücken erhalten bleibt. | |
Zuber 1995, 33. | |
Notation VII ist bislang nur als Leihmaterial zugänglich. | |
Boulez 1977, 57. | |
Ebd. | |
In seinem Aufsatz »Über das Dirigieren« unterscheidet Richard Wagner rhythmisch-figurative und zum Halteton hin tendierende Elemente (Melos), die er im Allegro und Adagio verwirklicht findet. Bei Beethoven sieht er diese Gegensätze in engster Beziehung: »[…] der gehaltene und der gebrochene Ton, der getragene Gesang und die bewegte Figuration stehen sich nicht mehr, formell auseinander gehalten, gegenüber; die voneinander abweichenden Mannigfaltigkeiten einer Folge von Variationen sind hier nicht mehr nur aneinander gereiht, sondern sie berühren sich unmittelbar und gehen unmerklich ineinander über.« (1956, 258–259) | |
Boulez beschreibt die ›Tropustypen‹ wie folgt: »Das Prinzip besteht darin, dass man bestimmte Elemente, sagen wir vom Typ A, in Parallele setzt zu Elementen vom Typ B, und sie durch diese B-Elemente beeinflusst, variiert und erweitert. So findet sich die Struktur des ursprünglichen kleinen Textes im erweiterten Text, in einer Variation, wieder. Dabei handelt es sich aber nicht um eine mechanische Variation, sondern um eine wirklich organische […].« (1977, 45) | |
Deutsches Universalwörterbuch 2007. | |
Boulez 1977, 15. | |
Hirsbrunner meint, »[d]as Wuchern (›prolifération‹) seiner [Boulez] Musik muss […] quasi ›von selbst‹ geschehen, der Komponist muss ihm gleichsam zuschauen können, er darf nicht eingreifen, was die Langsamkeit von Boulez’ Schaffen erklärt.« (1986, 14) | |
Deleuze/Guattari 1977. | |
Boulez 1977, 15. | |
Ebd., 18. | |
Ebd., 16–17. | |
Boulez 2000, 169. | |
Ebd. | |
Goethe 1991, 305. | |
Goethe 1891, 284. | |
Zunächst in Un coup de dés und Igitur, ab Ende 1957 auch durch Mallarmés Konzept des ›Offenen Buches‹ im Livre. Die Gefahr der zentrumslosen Vernetzung führt hin auf ein Alles, dem überlassend das Subjekt sich verliert, Nichts wird. Dieser Aspekt taucht bei Boulez kaum auf: »Was mich am meisten interessiert hat, war der Versuch, ein musikalisches, poetisches und formales Äquivalent zu seiner Dichtung zu finden. Ich habe sehr strenge Formen von ihm gewählt, weil ich ihnen eine Wucherung der Musik aufpfropfen wollte, die von einer ebenso strengen Form ausginge. Das gab mir die Möglichkeit, in die Musik Formen zu übernehmen, an die ich sonst nie gedacht hätte, und deren Ursprung literarische, von Mallarmé verwendete Formen waren.« (1977, 108; vgl. auch Boulez 1977, 56) | |
Deleuze/Guattari 1977, Klappentext. Fehlerhaft ist im Klappentext der deutschen Ausgabe die Zugabe einer veralteten Definition des Rhizoms als »Wurzelstock«. Es geht gerade darum, dass das Rhizom weder Wurzel noch Stengel ist, sondern eine Zwischenform, wie etwa beim Ingwer. Diese Form hat kein Zentrum. | |
Ebd., 8. | |
Ebd., 9–10. | |
Ebd., 38. | |
Ebd., 11, vgl. ebd., 13. | |
Ebd., 26. | |
Ebd., 28. | |
Ebd., 20. | |
Ebd., 44, Fußnote. Deleuze/Guattari zitieren nach: Pierre Boulez, Par volonté et par hasard (1975, 14). | |
Den ersten Satz dieser Metapher zitieren Deleuze/Guattari einfach nicht. Er passt auch schlecht zu ihrer Gegenüberstellung von Abendland = Samenpflanzung = Transzendenz, Orient = Knollenpflanzung = Immanenz und den entsprechenden Philosophien (vgl. Deleuze/Guattari 1977, 30 und 46). | |
Als »Rhizom« der Notations für Klavier betrachtet Ofenbauer (dem diese Arbeit ihre Anregung verdankt) die Notations für Orchester. In der multiplikativen Ableitung, die die Orchesterfassung der Vorlage gegenüber verwendet, sieht er ein rhizomatisches Verfahren (1995, 64). Rhizomatisch meint bei ihm: »[…] alles Produktive […] durch unsystematische Vernetzung« als Unterscheidung zum streng seriellen Verfahren (ebd., 63). Das »Einfließen von Willkür« ermöglicht wieder »kompositorische Freiheit und mit ihr Arbeit am Ausdruck […].« (Ebd., 61f.) | |
Vgl. Boulez 1977, 15. | |
Ebd., 23. | |
Boulez 2000, 95. |
Noten
Boulez, Pierre (1978), Notations für Orchester, London: Universal Edition.
––– (1985), 12 Notations für Klavier, Wien: Universal Edition.
Literatur
Boulez, Pierre (1977), Wille und Zufall, Gespräche mit Célestin Deliège und Hans Mayer, Stuttgart: Belser.
––– (2000), Leitlinien, Gedankengänge eines Komponisten, Kassel: Bärenreiter.
Deleuze, Gilles / Felix Guattari (1977), Rhizom, Berlin: Merve.
Goethe, Johann Wolfgang (1991), Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche [1787], Abt. 2, Bd. 3, Frankfurt a.M: Deutscher Klassiker Verlag.
––– (1790), »Metamorphose der Pflanzen. Zweiter Versuch. Einleitung«, in: ders., Naturwissenschafliche Schriften, Weimarer Ausgabe, Abt. 2, Bd. 6, Weimar: Hermann Böhlau 1891.
Hirsbrunner, Theo (1985), Pierre Boulez und sein Werk, Laaber: Laaber.
––– (1986), »Pierre Boulez: Notations (1945)«, Melos 1986/2, 2–20.
Misch, Imke (2004), »Musikalische Wucherungen. Zu Pierre Boulez’ Notations«, in: Kompositorische Stationen des 20. Jahrhunderts: Debussy, Webern, Messiaen, Boulez, Cage, Ligeti, Stockhausen, Höller, Bayle (= Schriften-Reihe Signale aus Köln 7), hg. von Christoph von Blumröder, Münster: LIT, 57–79.
Nemecek, Robert (1998), Untersuchungen zum frühen Klavierschaffen von Pierre Boulez, Kassel: Bosse.
Ofenbauer, Christian (1995), »Vom Faltenlegen. Versuch einer Lektüre von Pierre Boulez’ ›Notation(s) I(1)‹«, in: Pierre Boulez (= Musik-Konzepte 89/90), hg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, München: edition text + kritik, 55–75.
Wagner, Richard (1956), »Über das Dirigieren« [1869], in: ders. Die Hauptschriften, hg. von Ernst Bücken, Stuttgart: Alfred Kröner.
Zuber, Barbara (1995), »Komponieren – Analysieren – Dirigieren. Ein Gespräch mit Pierre Boulez«, Musik-Konzepte 89/90, München: Edition Text + Kritik, 29–47.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.