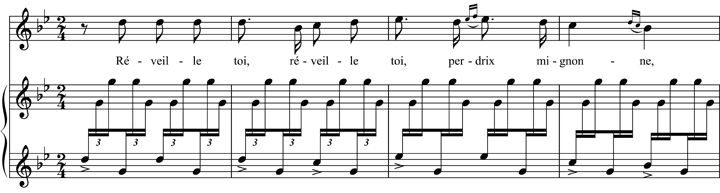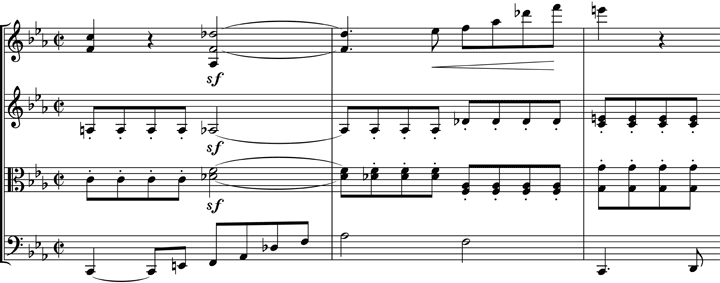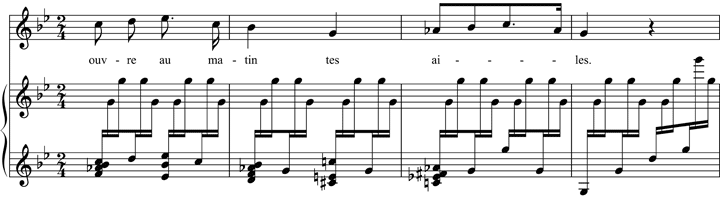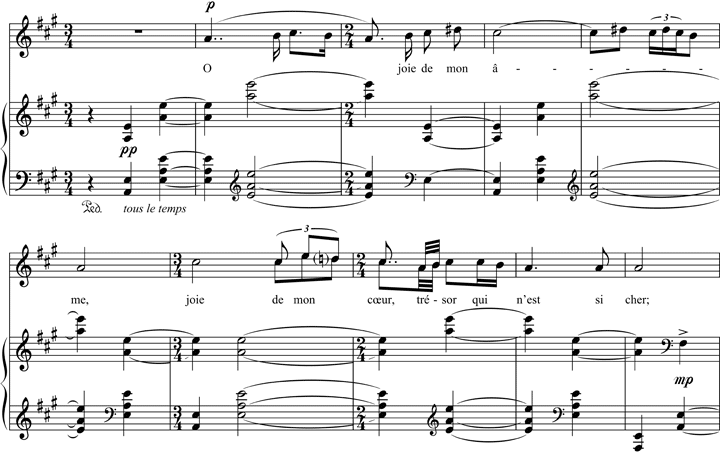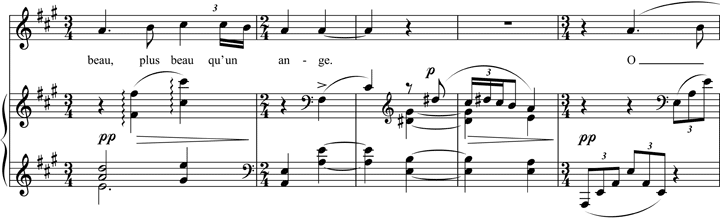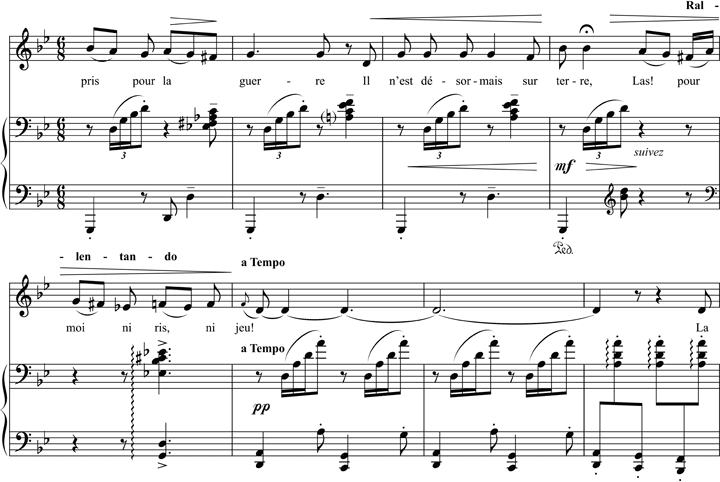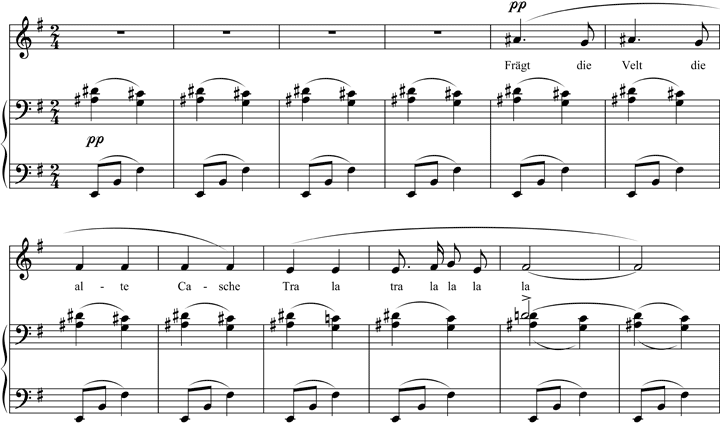Aneignung und Verfremdung II
Ravels Volksmusik-Adaptionen
Hartmut Fladt
An Ravels Volksliedadaptionen wird gezeigt, inwieweit Verfremdungsästhetik und Verfahrensweisen von ›Musik über Musik‹ Ravels kompositorisches Denken prägen. Der Beitrag arbeitet unter anderem mit den von Bartók entwickelten ethnomusikologischen und musiktheoretischen Kategorien des Umgangs mit Volksmusik und weist auf den nicht nur ästhetischen, sondern auch kulturpolitisch-politischen Hintergrund der Ravelschen Volksmusikbearbeitungen hin.
Titel und Zielrichtung dieses Beitrags stellen sich bewusst in die Reihe einiger meiner früheren Bartók-Publikationen[1], in denen – auf exemplarische wie individualisierend analytische Weise zugleich – Möglichkeiten der Umgehensweise mit vorgefundenem volksmusikalischem bzw. spezifisch bauernmusikalischem Material dargelegt wurden. Dabei ist Bartóks früher, noch nationalromantisch geprägter Versuch, sich intensiv auf die Bauernmusik einzulassen, durchaus von einem antizivilisatorischen und zugleich exotistischen Impuls getragen, von der Suche nach Authentizität, die als »reiner Quell« (diese Metapher durchzieht zahlreiche seiner Publikationen) auch fürs eigene Komponieren einen Wendepunkt, einen kraftvollen Neubeginn markieren sollte. Ravels Volksmusik-Adaptionen begannen in genau der gleichen Zeit wie die Sammeltätigkeit des sechs Jahre jüngeren Bartók: Die Cinq Mélodies populaires grècques (entnommen einer Liedersammlung von Hubert Pernot), deren Texte Ravels Freund Calvocoressi ins Französische übertrug, entstanden 1904–1906.[2] Immerhin hatte diese Arbeit nicht allein einen ästhetischen, sondern ebenso einen kulturpolitischen und explizit politischen Hintergrund, denn die Anregung zur Komposition kam vom Musikologen Pierre Aubry, der 1904 einen Vortrag über Volksmusik unterdrückter Völker hielt und dabei Griechen und Armenier in den Mittelpunkt stellte. Eine solche politische, explizit antinationalistische Komponente bekam Bartóks Volksmusik-Forschung, die erstmals in der Geschichte der Musikologie von Prinzipien wissenschaftlicher Exaktheit den musikalischen Phänomenen gegenüber und der Berücksichtigung sozialer, kultureller und politischer Umfelder getragen war, im Verlaufe seiner Sammel-Reisen und -Wanderungen noch vor 1908.
Der antizivilisatorisch-exotistische Impuls schwindet dann bei Bartók mehr und mehr, nicht allerdings so drastisch wie der nationalromantische. Es wäre falsch, bei Ravel exotistische Tendenzen schlicht zu leugnen, aber so einfach, wie es Arbie Orenstein darstellt[3], ist die Sache nicht:
Ineluctably attracted to exoticism, Ravel willingly harmonized folk melodies from many nations. He preferred having the melodies sung in their original language, and performed, if possible, with orchestral accompaniment. An interpreter would thus have to cope with some ten languages.
Verfremdungsästhetik und Verfahrensweisen von »Musik über Musik« sind die Grundlagen in Ravels Denken und Fühlen, die auch seinen Umgang mit dem vorgefundenen Material der Folklore prägen.[4] Es ist nur ein gradueller Unterschied, ob das »Vorgefundene« in der Tradition eines unverändert übernommenen ›cantus prius factus‹ steht oder Formeln und typologische Charakteristika beispielsweise von Walzern abruft (wie in den Valses nobles et sentimentales oder La Valse, partiell mit konkreten Vorlagen) oder Allusionen früherer Kompositionen ausprägt (wie im Falle des langsamen Satzes des G-Dur-Klavierkonzerts, der auf das Larghetto in Mozarts Klarinettenquintett zurückverweist). Dass Dandytum und die Tendenz zu Maske, Inszenierung und Selbstinszenierung – im Künstler-Kreise der ›Apaches‹ um Ravel selbstverständliche Attitüden – auch substantielle Auswirkungen auf Ravels kompositorische Konzeptionen hatte, wurde, bevor Volker Helbing es auch analytisch exakt bestimmte, von Vladimir Jankélévitch[5] in den Begriffen der ›Rollen‹, der ›Verkleidungen‹, des ›Spiels‹ und der ›Maske‹ durchaus bereits benannt und (allerdings sehr knapp) expliziert.
Ravels zweite Zusammenstellung von Volksmusik-Bearbeitungen ist ebenfalls durchaus nicht so unpolitisch und naiv, wie das oft dargestellt wird. Die 1910 entstandenen Chants populaires wurden im gleichen Jahr bei einem vom Haus des Liedes in Moskau veranstalteten Wettbewerb preisgekrönt. Diese (später von Orenstein noch um ein fünftes Lied ergänzte) Sammlung vereint je ein spanisches, französisches, italienisches, hebräisch-jiddisches und schottisches Lied. Die besondere Vorliebe von Debussy und Ravel für Mussorgskij und Borodin als Vertreter des ›Mächtigen Häufleins‹ ist ebenso offenkundig wie die besondere Vorliebe zahlreicher Russen für volksmusikalische Ausprägungen jeglicher Art (mitteleuropäisch, baltisch, slawisch, georgisch, armenisch, tatarisch, turkmenisch etc.) aus dem zaristischen Riesenstaat. Diese Narodniki aber, die ›Volkstümler‹, waren zugleich politische Opposition (wie naiv auch immer die Vorstellungen von einem agrarischen Sozialismus gewesen sein mögen), die für eine vollständige Emanzipation der noch bis vor kurzem leibeigenen Bauern im Rahmen eines Demokratisierungsprozesses eintraten. Russophilie – Narodniki – Exotismus – ein für viele Franzosen in dieser Zeit offensichtlich unwiderstehliches Gemisch, auch durch die politische Entente cordiale Frankreichs mit Russland und England begünstigt, die gegen die (auch kulturell, besonders im Musikbereich zu erfahrende) deutsch-österreichische Hegemonie gerichtet war.
Bemerkenswert dann auch noch Ravels Deux Mélodies Hébraiques vom Mai 1914, die in aramäischer – das feierliche (Toten-)Gebet Kaddish – und jiddischer – L’Énigme éternelle, Die alte Casche – Sprache die originalen Melodien in einer Weise darstellen, die an Verfahrensweisen Bartóks gemahnen, auf jeden Fall aber deutliche Spuren der Stravinskij-Rezeption tragen. Diese von der Sängerin Alvina Alvi angeregten, explizit zwei unterschiedliche Ausprägungen jüdischer Musikkultur repräsentierenden Gesänge (Kaddish die liturgische Hochkultur, Die alte Casche die sehr tiefsinnige, scheinnaive Volkskultur) setzen in einer Zeit der Post-Dreyfus-Divergenzen in Frankreich deutliche Zeichen.
›Aneignung‹ von volksmusikalischen Vorgaben hatte bei Bartók durch seine vielfache wissenschaftliche Annährung an den Gegenstand noch eine völlig andere Dimension als bei Ravel oder etwa Stravinskij, die aus vorliegenden Sammlungen – ohne Überprüfung von ›Authentizität‹ – attraktive Lieder auswählten und ihren spezifischen kompositorischen Verfahrensweisen anverwandelten. Kennzeichnend für Bartók ist, dass nicht nur ethnomusikologische Kriterien beim (analysegeprägten) Definieren und beim Klassifizieren der gesammelten Musik berücksichtigt sind, sondern dass spezifisch musiktheoretische und damit verknüpft Aspekte kompositorischen Materials und der Verfahrensweisen repräsentiert sind, sowohl in Publikationen und Vorträgen als auch in den kompositorischen Umsetzungen. Schon 1931 formulierte Bartók in einem Essay theoretisch das, was später Theodor W. Adorno in der Philosophie der neuen Musik[6] und Adorno und Hanns Eisler in Komposition für den Film[7] als »Auseinandertreten von Material und Verfahrensweisen« beschrieben haben. Das geschah auch in der Auseinandersetzung mit dem biologistischen Organismus-Modell Arnold Schönbergs, das, gestützt primär auf Goethes Urpflanzen-Lehre, postulierte, dass schon in der schöpferischen »Empfängnis« all das angelegt sein müsse, was sich dann im Werk aus diesem Keim heraus entfalte.[8] In diese Richtung geht auch die provozierend flüchtige Anmerkung in Theo Hirsbrunners Ravel-Monographie:
Neben den eher konventionellen Cinq Mélodies populaires grècques, deren Texte von Calvocoressi, einem der Apachen, ins Französische übertragen worden sind, und deren Melodien nicht von Ravel stammen – der Komponist lässt sich als Schöpfer eigener Werke gleichsam verleugnen –, neben diesen Gelegenheitswerken ohne große Prätentionen […].[9]
Dieser Ästhetik und ihren Werturteilen setzt nun Bartók entgegen:
Der verhängnisvolle Irrtum liegt darin, daß man dem Sujet, dem Thema eine viel zu große Wichtigkeit beimißt. […] Diese Leute vergessen, daß z.B. Shakespeare in keinem seiner Schauspiele die Fabel, das Thema selbst erfunden hat. Soll das vielleicht bedeuten, daß […] Shakespeares Hirn ausgedörrt war, daß er beim zweiten, dritten und zehnten Nachbarn um Themen für seine Stücke betteln mußte? Wollte also […] Shakespeare damit seine ›innere Unfähigkeit‹ verbergen? […] Aber auch hier [in der Musik], wie in der Literatur oder den bildenden Künsten, ist es ganz bedeutungslos, welchen Ursprungs das verarbeitete Thema ist, wichtig aber ist die Art, wie wir es verarbeiten: in diesem ›Wie‹ offenbaren sich das Können, die Gestaltungs- und Ausdruckskraft, die Persönlichkeit des Künstlers.[10]
Jetzt sollen exemplarisch einige der Volksmusik-Adaptionen Ravels aus den Sammlungen von 1904/06, 1910 und 1914 untersucht werden. In einem Vortrag für die Columbia University von 1941 hatte Béla Bartók drei unterschiedliche Verfahrensweisen der Bearbeitung von Volks- bzw. Bauernmusik unterschieden, die auch in dieser Ravel-Untersuchung nützlich sind:
»The used folk melody is the most important part of the work«; die »Inszenierung« des Komponisten entspreche einem »mounting of a jewel.«
»The importance of the used melodies and the added parts is almost equal.«
»The added composition-treatment attains the importance of an original work, and the used folk melody is only to be regarded as a kind of motto.«[11]
Bartók betonte, dass es in seinen Originalwerken, anders als etwa bei Stravinskij oder Kodály, keine originalen Volksmelodien (etwa als Zitate) gebe. Repräsentiert werden könne der »general spirit of the style«, und möglich seien auch »subconscious imitations of folk melodies or phrases.«
Obwohl im ersten der griechischen Lieder (Chanson de la mariée) die Melodie einen eindeutig phrygisch-authentischen Sechstonraum g1–es2 plus Verzierungsnote f2 ausprägt (der 2. Ton ist, wenn man der Sammlung trauen darf, immer als as definiert), schreibt Ravel ›äolisches‹ g-Moll vor und behandelt den 2. Ton – kontextabhängig – als variable Stufe, mit allerdings erdrückender Dominanz von as. Eine Grundidee Ravels ist die Allgegenwart des Liegetons g in jedem Takt des Liedes, virtuos variabel gehandhabt durch Register- und Figurationsdramaturgie und – selbstverständliches Prinzip bei Ravel wie bei Debussy – noch vertieft, indem dieses Klangband durch wechselnde harmonische und kontrapunktische Umgebungen in immer neuem Licht und neuer Farbe erscheint.
Beispiel 1: Maurice Ravel, Chanson de la mariée, T. 3–6
Die Final-Kadenzen in diesem Lied nun, in der Melodie immer als fa-mi-Klauseln formuliert, zeigen Ravels berühmten »Habanera-Akkord«[12]; er wird im griechisch-phrygischen Kontext der ersten Sammlung anders behandelt als im spanischen der zweiten: Die hier unmittelbar plagale Auflösung steht in der Tradition der sehr ungewöhnlichen Plagalauflösung des Neapolitaners, wie sie z.B. bei Brahms vorkommt, besonders eindringlich als Schlusskadenz des I. Satzes des 1. Streichquartetts c-Moll op. 51,1:
Beispiel 2: Johannes Brahms op. 51,1, I. Satz, T. 250–252
Ravel nun macht den Klang durch das hinzugefügte fis1 zum Zwitterakkord, ambivalent subdominantische wie dominantische Bestandteile in sich tragend, wobei aber der Fundamentschritt der ›cadence irrégulière‹ für deutliche Verhältnisse sorgt (zu beachten ist auch die Tradition der ›plagalen‹ Auflösungen des ganzverminderten Septakkordes mit der Quartfall-Bassklausel, unter anderem in Chorälen J.S. Bachs). Der permanente Liegeton g aber ist ein Verfremdungs-Element, das in seinem Stilisierungsgrad schon über Bartóks erste Kategorie (»mounting of a jewel«, s.o.) hinausgeht und dieser Aneignung eines Volksliedes zugleich die Individualität des Komponisten aufprägt.
Beispiel 3: Maurice Ravel, Chanson de la mariée, T. 15–18
Im Chanson des cueilleuses de lentisques (Lied der Mastix-Sammlerinnen) prägt die Melodie einen authentisch-lydischen Quintraum a1–e2 mit der charakteristischen Doppelstufe dis2/d2 aus. Dieses sehnsüchtig-getragene Liebeslied zeigt eine säkularisiert-erotisierte Religiosität und spricht vom kollektiv seufzenden Sehnen der Sammlerinnen nach einem sonnenumstrahlten blonden Engel. War Chanson de la mariée im festen tempo giusto formuliert, so inszeniert Ravel jetzt den parlando/rubato-Typus (Kategorien in allen ethnomusikologischen Sammlungen Bartóks und vielen seiner Essays) mit zahlreichen Taktwechseln, Dehnungen, Pausen, die zweifellos schon eine interpretierende Stilisierung der Lied-Vorlage durch den Komponisten sind. Indem der Klavierpart neun Takte lang nur tonikale Quint-Oktav-Klänge hat, kann die Singstimme das Besondere in der Herausstellung der lydischen Quart leisten – sie ist nicht etwa Durchgang zum Quintton, sondern zweimaliger Wendepunkt, bis im 6. Takt dann doch noch der zu erwartende Quintton erreicht wird und in der deszendenten Herbeiführung der Kadenz dann dis2 zu d2 wird.
Beispiel 4: Maurice Ravel, Chanson des cueilleuses de lentisques, T. 1–10
Sehr behutsam erweitert Ravel den Tonbestand der Klänge (vom Zentrum A-e aus) um Quinten aufwärts (fis-cis1) und abwärts (d1, das sich aber als Quarte aufwärts darstellt); das ›Aufwärts‹ der Quinten kulminiert im lydischen Doppelquintklang e-h-gis1-dis2, der als Dominante eingesetzt wird (Klangsignal für den Beginn der variierten 2. Strophe).
Beispiel 5: Chanson des cueilleuses de lentisques, T. 19–23
Mit einem solchen modalen Komponieren, das völlig unbelastet von historischer ›Korrektheit‹ neue diatonische (und polydiatonische) Potentiale von Zusammenhangbildung schafft, reiht sich Ravels Konzeption ein in zahlreiche vergleichbare Ansätze seiner Zeit, die – besonders bei Stravinskij und Bartók – noch erheblich radikalisiert wurden, was dann auf Ravel selbst wiederum zurückwirkte.
Chanson espagnole aus der Sammlung von 1910, die insgesamt viel traditioneller angelegt ist als die griechische und vielleicht auch deshalb preisgekrönt wurde, erfüllt zahlreiche Spanien-Klischees und hält sich mit verfremdenden Elementen auffällig zurück. Dazu zählt auch, wie bereits angemerkt, die Inszenierung des ›Habanera-Akkords‹:[13] Durch die Sopranklausel in der Melodie (in der das so charakteristisch dissonierende g ja immerhin präsent ist) und die authentische Bassklausel hat er, obwohl – ohne den Basston – identisch notiert, dominantische Funktion; seit Schubert kann der übermäßige Quintsextakkord, der regulär als Vertreter der Doppeldominante ›phrygisch‹ in die Dominante geführt wird, auch – eine Quinte tiefer – als dominantische Penultima mit mi-Klausel in die Tonika aufgelöst werden.
Beispiel 6: Maurice Ravel, Chanson espagnole, T. 11–18
Die Melodie repräsentiert insgesamt ›El Andalus‹ mit dem bis heute schwer entwirrbaren Bündel von iberischen, arabischen, jüdischen und ›zigeunerischen‹ Elementen. So zeigt der plagale mollare g-Modus im unteren Tetrachord sowohl die charakteristische übermäßige Sekund es-fis (die historisch offensichtlich in ihren unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen als gemeinsame Wurzel das antik-griechische chromatische Genos hat) als auch jene Flamenco-Anbindung, die zur typischen ›phrygischen‹ Kadenzbildung auf der Confinalis d und ihrer Oberterz-Verzierung führt. Und: an genau dieser Stelle in Takt 15f. wird der ›Habanera-Akkord‹ wieder Teil einer Plagalkadenz G-D (vgl. Notenbeispiel 6).
Das Lied beginnt mit einer auskomponierten, zunächst terzlos-›neutral‹ inszenierten V./v. Stufe, die halbtaktig mit ihrer eigenen VII pendelt, deren Fundament C taktweise als c-Moll7/11 (akkordisch als Terzschichtung aufgefasst) und dann C-Dur9 dargestellt ist, also, in Bezug auf das D-Subsystem, polymodal zwischen Phrygisch und Äolisch alterniert. Aufs vorgezeichnete g-Äolisch bezogen heißt das: Der v. Stufe ist sowohl die äolische iv wie die dorische IV beigeordnet. Der Melodiebeginn impliziert einen – in volksmusikalischen Modellen Spaniens durchaus häufig anzutreffenden – Moll-Dur-Parallelismus (d-g, f-b), der z.B. Segment des Folia-Modells sein könnte. Ravel allerdings bleibt beim Pendel-Prinzip und wechselt zwischen i und v7 b9 als Molldominante.
Die bisherigen Beispiele sind Bartóks ersten beiden Kategorien (›Dominanz der Melodie‹ und ›Vorgegebene Melodie und Verfahrensweise sind gleichberechtigt‹) zugehörig, nun kommt mit der jiddischen Alten Casche von 1914 die dritte Kategorie ins Spiel. Das ewige Rätsel, die alte Frage: Sie wird gefragt und kann zugleich nicht gefragt werden; die Antwort: Sie wird gegeben und es ist zugleich unmöglich, sie zu geben. Die Melodie (von der ich noch andere Überlieferungen kenne) hat die typische Klezmer-Skala von fis bis fis1 (mit unterer Nebennote e), die strukturell einen plagalen h-Modus mit dem charakteristischen unteren ›chromatischen‹ Tetrachord fis-g-ais-h ausprägt. Die Confinalis (hier also fis, mit dem das Lied auch endet) ist in zahlreichen Klezmer-Stücken so stark repräsentiert, dass sie von Beginn an als ›Grundton‹ in Erscheinung treten kann – das allerdings ist bei der Alten Casche nicht der Fall.
Gegen alle Traditionen im Umgang mit Klezmer-Musik stellt nun Ravel die Melodie in einen E-zentrierten Klangkontext. Die prägende Achtel-Achtel-Viertel-Doppelquint des Bass-Ostinatos (E-H-fis) bringt zwar die Finalis H und die Confinalis fis als die Strukturträger der Melodie, doch sie sind als Subsystem von E definiert. Die charakteristische übermäßige Sekund ais-g wirkt so als lydische Quart und Mollterz in einem zehnstufigen polymodal-chromatischen E-Modus, dessen Tonbestand aus äolischen (unterstrichen) und lydischen Tönen zusammengesetzt ist (gemeinsame Töne sind durch Großschreibung hervorgehoben): E-Fis-g-a-ais-H-c-cis-d-dis.[14] Auffällig und erklärungsbedürftig ist, dass gis als substantielle lydische Terz ausgespart bleibt; auch über Takt 20 und Takt 22 und das enharmonische Problem his = c wird später Auskunft gegeben. Dass ›polymodale Chromatik‹[15] z.B. bei Gleichzeitigkeit von E-Phrygisch und E-Lydisch ein komplettes zwölftöniges Feld ausprägt – dabei aber tonal bleibt –, ist bei Stravinskij und Bartók häufig nachweisbar; bei Bartók (so in der Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta, I. Satz) ist sogar ein lydisch-lokrisches dreizehnstufiges Feld konstatierbar.
Der Rätselcharakter von Ravels Verfremdungsmaßnahmen (auch der daraus resultierenden Klangtypen von Tritonus-Quart- bzw. kleine Sekund-Quint-Klängen etc.) bleibt auch dann bestehen, wenn der alternierende Klang auf der zweiten Zählzeit durch Dekolorierung des cis1 zu c1 zusammen mit der Singstimme einen C-Dur-Dreiklang ausprägt. Hier wird nicht einfach das Prinzip ›Nebentoneinstellung‹ realisiert: Der Klang kann, obwohl primär VI. Stufe in e, zugleich als neapolitanisch-phrygische II in h gehört werden (T. 9f.). Kadenzieller Zielklang ist der fragmentarische ›akustische‹ E-Klang in den Takten 11f. und 15f. mit Quinte, kleiner 7, großer 9 und #11.
Beispiel 7: Maurice Ravel, L’ Énigme éternelle, T. 1–12
Traditionsgesättigt ist der Modulationsprozess hin zum tonikal definierten H-Dur Takt 24, da ein ii-V-I-Gang deutlich ausgeprägt ist. Die in Takt 20 erreichte Dominante Fis7 hat, taktweise alternierend, die große (dis1) und kleine (d1) Sext; die c-Stufe aus dem polymodal-chromatischen Tonfeld wird nun als his definiert, weil sie – zusammen mit g und a auf der 2. Zählzeit von jeweils Takt 20 und 22 –Teil einer dreifach leittönigen Nebentoneinstellung zur 2. Zählzeit in Takt 21 und 23 ist.
Beispiel 8: Maurice Ravel, L’ Énigme éternelle, T. 19–31
Die tonikalisierte H-Stufe wird ihrerseits ›äolisiert‹: Unter dem Liegeton h1/h2 erklingt die Dreiklangsmixtur A-G als VII und VI, mündend in ein H-Moll-Dur mit Septime, das dann, wiederum traditionell, die Reprise in e herbeiführt. Das Lied endet mit einem neuntönigen Klang aus dem äolisch-lydischen Tonfeld, bei dem nur das zu Beginn des Liedes und der Reprise so auffällig inszenierte dis1 fehlt. Basis der letzten 8 Takte ist jeweils der ›akustische‹ #11-Klang, dem aber ausgerechnet der so klangentscheidende 5. Partialton gis – wie im gesamten Lied – entzogen ist und durch die trübe Mollterz ersetzt wird, mit der das Lied »perdendo« endet.
Ein musikalisches ›Heilsversprechen‹, das schon mit der extrem tiefen, geräuschhaften Mollterz im Amen von Kaddish in Frage gestellt war, unterbleibt endgültig. Dreyfus war nur eine Vor-Andeutung.
Anmerkungen
Fladt 1997; 1984. | |
Bartók selbst nannte in seinen Harvard Lectures (1943) Ravels Cinq Mélodies populaires grècques und Brahms’ Deutsche Volkslieder als meisterhafte Beispiele für die kreative Aneignung von Volksmusik (Bartók 1976, 375). | |
Orenstein 1990; vgl. insbesondere xii. | |
Vgl. dazu Helbing 2005, insbesondere Kap. 4 und 5. | |
Jankélévitch 1958, 97f. und 102. | |
Adorno 1958, 112ff. | |
Adorno / Eisler 1969, 114ff. | |
Schönberg 1976. | |
Ebd. | |
Bartók 1972. | |
Bartók 1976, 357f. | |
Vgl. Helbing 2005, 130ff. | |
Selbstverständlich könnte angemerkt werden, dass es sich mit dem Basston D ›eigentlich‹ gar nicht mehr um den ›Habanera-Akkord‹ handele; es sind dies aber lediglich verschiedene Inszenierungsweisen einer identischen Vorgabe, des klassisch-romantischen Übermäßigen Quintsextakkordes, wie sie in der Zeit um 1900 zum allgemeinen ›Stand des Materials‹ in Europa gehören. | |
Die abstrakte Möglichkeit, hier ein vollständiges oktatonisches Feld mit den erweiternden Tönen h und d anzunehmen, habe ich, besonders wegen der tonal fundierenden ostinaten Doppelquinte mit dem h als Substanzton, der Struktur der Melodie und der Bedeutung des Tones d als Bestandteil kadenzieller Zielklänge, verworfen. Immerhin haben die Takte 20 und 22 jeweils ausschließlich 7 Töne dieser Oktatonik: e-fis-g-a-ais-c-dis. | |
Vgl. Bartók 1976, 367. |
Literatur
Adorno, Theodor W. (1958), Philosophie der neuen Musik, Frankfurt a.M.: Europäische Verlagsanstalt.
Adorno, Theodor W. / Hanns Eisler (1969), Komposition für den Film, München: Rogner & Bernhard.
Bartók, Béla (1972), »Vom Einfluß der Bauernmusik auf die Musik unserer Zeit« [1931], in: ders., Weg und Werk, Schriften und Briefe, hg. von Bence Szabolcsi, Kassel/Basel/München: Bärenreiter/dtv.
Bartók, Béla (1976), Essays, hg. von Benjamin Suchoff, London: Faber and Faber.
Fladt, Hartmut (1997), »Aneignung und Verfremdung. A buidosó aus Béla Bartóks Ungarischen Volksliedern«, in: Chormusik und Analyse, 2. Teil, hg. von Heinrich Poos, Mainz: Schott, 215–222.
Fladt, Hartmut (1984), »›Das Volk ist nicht tümlich‹. Béla Bartók und die Volksmusik«, in: Hartmut Fladt, Hartmut Lück und Wolfgang M. Stroh, Musik im 20. Jahrhundert. Über den Reiz des Populären (= Studienreihe Musik, hg. von Johannes Hodek und Sabine Schutte), Stuttgart: Metzler, 86–119.
Helbing, Volker (2005), Choreographie und Distanz. Studien zur Ravel-Analyse, Diss., TU Berlin.
Hirsbrunner, Theo (1989), Maurice Ravel. Sein Leben. Sein Werk, Laaber: Laaber.
Jankélévitch, Vladimir (1958), Ravel, Hamburg: Rowohlt.
Orenstein, Arbie (1990), »Introduction«, in: Maurice Ravel, Songs 1896–1914, hg. von Arbie Orenstein, New York: Dover.
Schönberg, Arnold (1976), »Symphonien aus Volksliedern« [1947], in: ders., Stil und Gedanke (= Gesammelte Schriften 1), hg. von Ivan Vojtech, Frankfurt a.M.: Fischer.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.