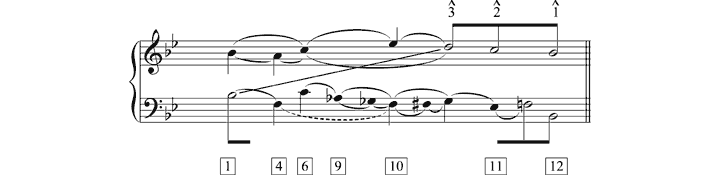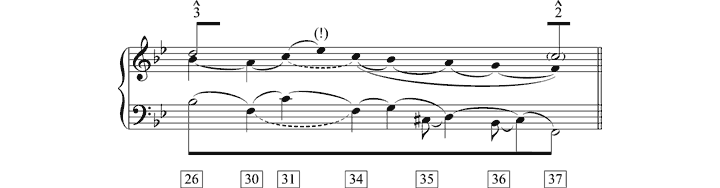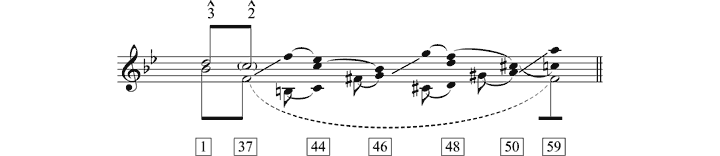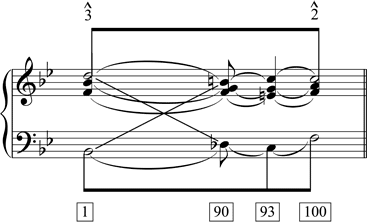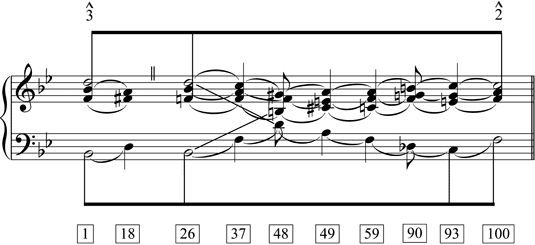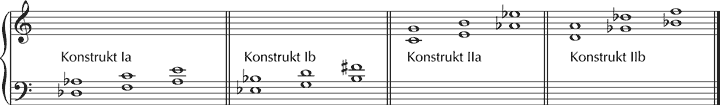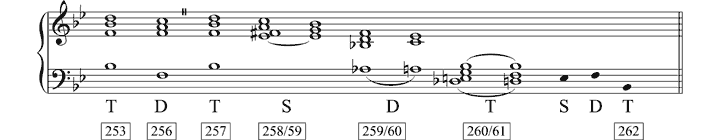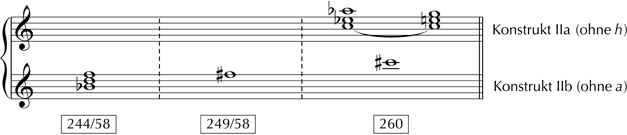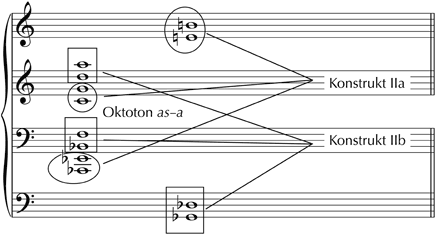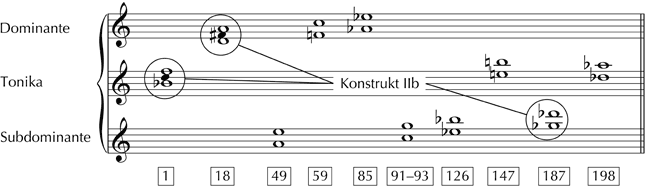Tonalität in Franz Schuberts späten Sonatenformen
Überlegungen zum Kopfsatz des Klaviertrios B-Dur D 898
Stefan Rohringer
Der nachfolgenden Untersuchung liegt die Annahme zugrunde, dass Tonalität in der Musik des ausgehenden 18. Jahrhunderts als ›Ursatz-Tonalität‹ (im Sinne Heinrich Schenkers), Tonalität in Werken ab etwa Mitte des 19. Jahrhunderts hingegen als eine ›Tonalität der Tonfelder‹ (im Sinne Albert Simons) verstanden werden kann. Innerhalb des funktionalen Systems ›Tonalität‹ hat sich demnach ein Wechsel des ›Programms‹ (Niklas Luhmann) ereignet. Dies impliziert einen Prozess, der von einzelnen auf Tonfeldern beruhenden Verfahren in der Musik der spätbarocken und empfindsamen Epoche bis zur vollständigen Okkupation aller Funktionen durch die ›neue Tonalität‹ (Bernhard Haas) in der Musik um 1900 reicht. Im Kopfsatz von Franz Schuberts Klaviertrio in B-Dur D 898, einem Werk des Übergangs, können sowohl Verfahren der ›Ursatz-Tonalität‹ als auch der ›Tonalität der Tonfelder‹ an der satztechnischen Einrichtung aufgezeigt werden. Gleichwohl erscheint weder die Einschätzung überzeugend, beide Programme koexistierten schlicht im Werk, noch müssen, weil nur ein Programm als konstitutiv für den musikalischen Zusammenhang anerkannt wird, die Verfahren des anderen für äußerlich erklärt werden. Demgegenüber wird hier vorgeschlagen, in der zu Verfahren der ›Ursatz-Tonalität‹ analogen Gestaltung von Nahkontexten eine Strategie zu erkennen, welche die ›Anschlussfähigkeit‹ des neuen Programms gewährleistet.
Am Ende des 18. und auch noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts sind es insbesondere die auf der ›Sonatenform‹ beruhenden Werke, anhand derer Tonalität paradigmatisch exemplifiziert erscheint. Freilich ist die in zahlreichen Harmonielehren vorgenommene Gleichsetzung von Tonalität mit einer regulierten Folge von Akkorden das Ergebnis einer keineswegs unproblematischen Abstraktion: Die Abstimmung der einzelnen Momente des Tonsatzes (darunter auch die Akkorde und ihre Folge), füllt nicht eine unabhängig zu denkende Form, sondern die Form selbst ist Ausdruck eben dieser Abstimmung.[1] Harmonische Funktionen[2] werden demnach an ihrer Formbedeutung erkannt und eine Formbedeutung daran, welche harmonische Funktion mit ihr einhergeht. Veränderungen der Tonalität schlagen sich in der Formgebung nieder, und die Art der Formwirkung gibt über die veränderte Funktion einzelner Harmonien Auskunft.
In diesem Sinne wird im Folgenden die zentrale harmonische Relation der Sonatensatzmusik, wie sie auch noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts für Sätze in Dur als repräsentativ gelten kann, am Beispiel des Kopfsatzes aus Franz Schuberts Klaviertrio B-Dur D 898 in den Blick genommen: die Spannung zwischen Tonika und Dominante in der Exposition. Gefragt wird primär nach dem harmonischen Weg, durch den beide verbunden sind. Denn der Gedanke, harmonische Funktion und Formfunktion seien Ausdruck ein und derselben Abstimmung, besagt, dass Tonika und Dominante in ihrer Relation zueinander noch nicht hinreichend beschrieben sind, werden sie nur als I. und V. Stufe einer Tonart bezeichnet.
Im Gegensatz zu Beethoven, der ab der ›mittleren Periode‹ regelmäßig auch in Dur-Sätzen die V. durch eine terzverwandte Stufe ersetzt[3], hat Schubert in keinem seiner späten Instrumentalwerke den traditionellen Rahmen des Quintabstandes zwischen Expositionsanfang und -ende verändert.[4] Gleichwohl weicht Schubert von der Norm ab, indem er zwischen reguläre Haupt- und Nebentonart zumeist einen dritten, relativ eigenständigen tonartlichen Bereich einschiebt, der durch die Exponierung neuen motivisch-thematischen Materials zusätzliches Gewicht erhält. Dieses Verfahren bezeichnete Felix Salzer als »Dreitonartenexposition«.[5]
Forschungsbericht
Schuberts Verfahrensweise hat unterschiedliche Interpretationen herausgefordert, denen zufolge etwaige ›Konkurrenztonarten‹ entweder der herkömmlichen harmonischen Polarität von Tonika und Dominante untergeordnet, oder als Teil einer verschiedene harmonische Regionen umfassenden Ordnung verstanden werden, die auf die ›Entmachtung der Dominante‹ zielt. So hat Hellmut Federhofer behauptet, »die harmonische Formanlage im Großen [werde] auch bei Schubert durch das dominantische Verhältnis bestimmt, dem sich die mannigfaltigen Terzbeziehungen als Struktur- und Farbwert fügen.«[6] Demgegenüber sieht Hans-Joachim Hinrichsen »die Tonika-Dominant-Spannung […] zugunsten eines reichen Beziehungsgeflechts terzverwandter Tonarten neutralisiert«.[7]
In Federhofers Argumentation wird eine den tonalen Zusammenhang verbürgende Hintergrundstruktur vorausgesetzt, die ggf. als überlagert, nicht jedoch zerstört gilt. Federhofer folgt hierin Heinrich Schenker, dessen Schichtenmodell auf dem Gedanken eines wechselseitigen Verhältnisses von relativem Hinter- und Vordergrund in einem tonalen Tonsatz beruht. Das Potential dieses Ansatzes spielt Federhofer in seinen Ausführungen freilich nur partiell aus, da er sich ausschließlich auf die Darlegung von Grundtonfolgen beschränkt und die Qualifizierung der damit einhergehenden Stufen ohne Berücksichtigung des Verlaufs der restlichen Stimmen, insbesondere der Oberstimme, vornimmt. Federhofer genügt dieses Vorgehen, um darzulegen, die Fügung der Terzbeziehungen unter das »dominantische Verhältnis«[8] sei daran zu erkennen, dass die terzverwandten Stufen als Bassdurchgänge eine Teilungsfunktion innerhalb der übergeordneten Rahmenquinte einnähmen. So überzeugend aber Federhofer beispielsweise in der Exposition des Kopfsatzes der C-Dur Sinfonie D 944 »den durch den Terzteiler gegliederten Weg zur Quinte«[9] beschreibt, indem er auf die »tonikalisierte e-Stufe, die den zweiten Gedanken […] einführt,«[10] verweist, so fragwürdig erscheint es andererseits, wenn er für den Kopfsatz des Klaviertrios B-Dur D 898 behauptet, dass »die A-Stufe den Weg von der B-Stufe abwärts zur F-Stufe [untergliedere].«[11] Denn während die e-Stufe in der Sinfonie als Bestandteil eines aufwärts gerichteten ›Dur-Moll-Parallelismus‹ (Carl Dahlhaus) C-(H)-e-(D)-G eingeführt wird, findet sich im B-Dur-Trio kein vergleichbarer übergeordneter harmonischer Gang, durch den die A-Stufe als durchgängiger ›Teiler‹ Plausibilität gewänne. Vielmehr hat bereits Felix Salzer[12] darauf hingewiesen, dass die Wendung zur Dominanttonart vorzeitig am Ende der Rekapitulation des Hauptsatzes vollzogen wird (T. 37). Demnach ereignet sich der modulierende Schritt entgegen der Behauptung Federhofers nicht mittels eines Durchgangs über der A-Stufe, sondern basiert auf einem ungeteilten Quintanstieg. Die A-Stufe hätte nach herkömmlichem Verständnis demnach als Ausweichung innerhalb der bereits erreichten Nebentonart F-Dur zu gelten. Der Begriff ›Ausweichung‹ aber erscheint für die Attraktivität, mit der die A-Stufe die Hauptzäsur innerhalb der Exposition markiert (T. 49ff.), merkwürdig schwach, und es überrascht daher nicht, dass ihn Federhofer für seine Argumentation nicht heranzieht. Die Schwierigkeit, dass ein als wichtig erachteter Formmoment einerseits bezeichnet werden soll, andererseits aber seine Ursache in einem technischen Sinne nicht angezeigt werden kann, lässt Federhofer letztlich bloß von einer ›Untergliederung‹ sprechen. So bleibt die Frage unbeantwortet, auf welchem Verfahren die ›Untergliederung‹, die der Weg von der B- zur F-Stufe erfährt, beruht, und welche harmonische Funktion der so auffällig heraus gespielte Formmoment attraktiv zu machen versucht.
Freilich dürfte eine befriedigende Antwort hierauf quer zu zentralen ästhetischen Wertvorstellungen Federhofers stehen, der Momente, die sich nicht unter das ›dominantische Verhältnis‹ fügen, grundsätzlich für problematisch zu erachten scheint. Damit steht er ganz in der Tradition von Schenkers Idee des ›Meisterwerks‹. Federhofer geht es offenkundig um eine ›Ehrenrettung‹ Schuberts mit Hilfe des Schenkerschen ›Gütesiegels‹.[13] Die Formulierung vom »Struktur- und Farbwert«[14] der Terzbeziehungen aber weist auf den ›blinden Fleck‹ in Federhofers Beobachtung. Denn von ›struktureller‹ Bedeutung im Sinne der angestrengten Argumentation sind die genannten Beziehungen gerade nicht.
Auch Hinrichsen geht es um eine Nobilitierung Schuberts. Hier aber lautet der Gedanke, diese vollzöge sich durch Verweigerung oder Unterlaufen der Prinzipien klassischer Formgestaltung. Hinrichsens Rede von einer »Umqualifizierung der Sonatenlogik«[15] bei Schubert impliziert eine ›Umqualifizierung‹ der Negativurteile älterer, den normativen Charakter der Beethovenschen Muster betonender Untersuchungen[16], ohne dass deren analytische Befunde zunächst grundsätzlich in Frage gestellt würden.
Man kann Hinrichsens Unbehagen gegenüber Federhofers normativem Theoriebegriff teilen und doch Zweifel an seiner analytischen Alternative hegen. Zunächst überrascht Hinrichsens These, der »Aufbau einer Tonartenpolarität« erfordere »die Vermeidung, jedenfalls aber die äußerst behutsame und rationelle Behandlung der Dominante vor ihrem eigentlichen und ereignishaften Eintritt als zweite Expositionstonart.«[17] Als Beispiel führt Hinrichsen den Kopfsatz aus Beethovens Klaviersonate G-Dur op. 31,1 an, wo »die ausführlich vorbereitete (T. 30–38) Ausbreitung der Dominante (T. 39–44) vor der angegangenen Wiederholung des Hauptthemas ihre Verwendung als Seitensatztonart nicht mehr zu[lasse].«[18] Hinrichsen verweist in diesem Zusammenhang auf den Gedanken der »harmonische[n] Oekonomie« bei August Halm.[19] Doch lassen sich zahlreiche Gegenbeispiele anführen: Im Kopfsatz von Mozarts ›Jupiter‹-Sinfonie etwa erscheint ein äußerst massiver ›Quintabsatz‹ (Heinrich Christoph Koch) in der Ausgangstonart bereits am Ende des ersten interpunktischen Teils (T. 23), ohne dass die Nebentonart dadurch eine andere wäre als für gewöhnlich.[20] Hinrichsens fragwürdiger Ansatz, die Vorgänge alleine einer quantifizierenden anstatt qualifizierenden Betrachtungsweise zu unterziehen, resultiert unmittelbar aus dem von ihm eingesetzten Instrumentarium herkömmlicher ›funktionstheoretischer‹ Harmonielehren, demzufolge alle harmonischen Ereignisse prinzipiell in einer Schicht zu liegen kommen.[21]
Hinrichsens zentraler These gemäß liegt die Ursache für die ungewohnte Stufendisposition und den Einsatz terzverwandter Klänge in diversen Analogiebildungen von Fundamentschrittfolgen der Akkord- und Stufenprogressionen zwischen verschiedenen Formteilen. Damit korrespondiert die Einschätzung, das den Zusammenhang generierende Moment der ›musikalischen Logik‹ werde zu Beginn des 19. Jahrhunderts von der Ebene der thematischen Arbeit (bei Beethoven) auf die des harmonischen Diskurses (bei Schubert) übertragen und in einem »unauffällig zielstrebigen Entwicklungsprozess«[22] der »miteinander in Beziehung tretenden, aufeinander verweisenden und auseinander hervorgehenden ›Klangräume‹ [Schnebel]«[23] verankert. Schuberts Formkonzept ziele darauf, »den Zusammenhalt und den Verlauf des Sonatensatzes von der Notwendigkeit des Fortgangs durch motivisch-thematische Arbeit zu entlasten.«[24] Gleichwohl scheint der Modus musikalischer Zusammenhangsbildung, so wie er sich mit der motivisch-thematischen Arbeit verbindet, nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Vielmehr überträgt Hinrichsen implizit Prinzipien der motivisch-thematischen Analyse auf den Bereich der Harmonik. Es ist daher fraglich, ob und inwieweit er einen Paradigmenwechsel unterstellt. In einer späteren Veröffentlichung hat Hinrichsen seine Analyse in Kurzform nochmals publiziert[25] und ihr Ergebnis dahingehend zusammengefasst, dass durch die »Zusammenschau von Expositions-, Durchführungs- und Reprisenbeginn […] sich alle harmonischen Ungewöhnlichkeiten des Satzes als in ein Geflecht von Querverweisen und Analogien einbezogen [erweisen]: Die für Schubert typischen Formmerkmale – der Reprisenbeginn außerhalb der Tonika, aber auch die überraschende Modulation zum Seitensatz durch einen Terzschritt – fügen sich gewissermaßen zu einem harmonischen System zusammen, in dem dominantische und mediantische Beziehungen gleichberechtigt an der Strukturierung der Form beteiligt sind.«[26]
Aufschlussreich ist die Formulierung »gewissermaßen zu einem harmonischen System«. Sie zeigt an, dass ›System‹ im engeren Sinne nicht gemeint ist, und ob ein solches mit Hinrichsens Instrumentarium überhaupt zu generieren wäre, erscheint fraglich. Eine motivisch-thematische Analyse konstatiert unterschiedliche Grade von Ähnlichkeit. (Davon unberührt bleibt, dass diese zumeist als ›Entwicklungen‹ ausgewiesen werden.) Die Menge denkbarer Beziehungen, die eine motivisch-thematische Prägung innerhalb eines Werkes mit anderen motivisch-thematischen Prägungen durch Ähnlichkeit haben kann (und mit motivisch-thematischen Prägungen anderer Werke), ist prinzipiell unbegrenzt. Hinrichsen kommt nur dadurch zu einer Eingrenzung, dass allein identische Schrittfolgen in Relation zueinander gesetzt werden. Demnach beruht Zusammenhang letztlich auf Wiederholung. Hieraus ergeben sich zwei grundsätzliche Probleme: Zum einen können auf diesem Wege nicht alle im Werk gegebenen Stufengänge aufeinander bezogen werden. Ein ›harmonisches System‹ kann aber im Hinblick auf sein ›materielles Substrat‹ nicht nur partiell gegeben sein. Zum anderen geht auch Hinrichsen nicht davon aus, in Schuberts Kompositionen könne jeder Akkord auf jeden bzw. jede Stufe auf jede andere folgen. Das aber besagt, dass die von Hinrichsen behaupteten Analogie- und Symmetriebildungen nicht primär formbildend sein können, sondern ihrerseits auf eine Ordnung zurückgehen, die durch den Hinweis auf wie auch immer geartete tonartliche Verhältnisse im Einzelnen selbst noch nicht aufgedeckt wird.
Hinrichsen scheint die Gefahr des Willkürlichen seiner Konzeption zu erkennen, wenn er äußert, dass das »Verhältnis von Form und Harmonik«[27] auf einer »wechselseitig begründeten Balance, die den Mangel an syntaktischer Verankerung der Formanlage in der Mikrostruktur des Tonsatzes zu kompensieren hat«[28], beruht. Als Beleg führt er das unterschiedliche Auflösungsverhalten bestimmter Signalakkorde an: so für den gesamten Zyklus von D 944 den übermäßigen Quintsextakkord[29] und für den Kopfsatz von D 956 den verminderten Septakkord.[30] Dass aber das unterschiedliche Auflösungsverhalten der Signalakkorde in D 944 wie auch D 956 nicht alle denkbaren Möglichkeiten der Auflösung umfasst, heißt abermals, dass sich die tatsächlich gewählten Optionen auf Ordnungskriterien beziehen, an denen die Struktureigenschaften der jeweiligen Akkorde zwar partizipieren, in denen sie aber nicht aufgehen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hinrichsens Beobachtungen, die immerhin den Anspruch erheben, die »Planmäßigkeit«[31] Schuberts zu zeigen, letztlich über ein mehr oder weniger loses Geflecht von Verweisen nicht hinausgehen. Diese Problematik wird durch die Überlegung, Schubert habe in nachklassischer Zeit in jedem Werk zu individuellen Lösungen kommen müssen, nicht entschärft.[32] Am Beispiel von Hinrichsens Analyse des Klaviertrios B-Dur D 898 soll diese Kritik verdeutlicht werden:
Hinrichsen führt die irreguläre Reprisenanlage als »Resultat der Durchführung« auf die harmonische Progression der ersten Durchführungshälfte zurück.[33] Der erste Durchführungsabschnitt des Kopfsatzes schließt mit dem Quintabsatz der Nebentonart in Takt 134 (einschließlich der Prolongation der Kadenzstufe ist sein Ende Takt 137). Dieser Abschnitt lässt sich wiederum in drei Taktgruppen untergliedern: Zunächst erfolgt die Rekapitulation des Hauptgedankens in b-Moll mit der Wendung zum dominantischen Teiler am Ende des Vordersatzes in Takt 116. Anders als zu Beginn der Exposition (dort T. 6) kann hier nicht mit der II. Stufe fortgefahren werden, da diese in Moll einen verminderten Dreiklang ausprägt. Der für den Themenbau der Klassik charakteristische harmonische Chiasmus I-V-V-I, der dort vielfach den Vordersatz eines ›musikalischen Satzes‹ prägt (siehe erneut den Beginn von KV 551,i), wird zu einer I-V-II-V-I-Wendung erweitert (mit Blick auf den Beginn von KV 576,i auch dies kein der Klassik unbekanntes Verfahren). Die Lösung des Problems in der Durchführung erfolgt nicht durch die denkbare Reduktion auf das Modell des schlichten Chiasmus: Das Wiederaufgreifen des Hauptsatzbeginns hebt nicht mit der F- sondern der As-Stufe an. Dadurch aber, dass letztere ebenfalls als Dominante behandelt wird und nach Des-Dur führt (T. 120), erscheint die Riposte des regulären Chiasmus auf die Ebene der parallelen Durtonart transponiert.
Die zweite Taktgruppe (ab T. 120) arbeitet mit dem Satzmodell einer steigenden 5-6-Konsekutive und führt von der Des-Stufe über eine durchgängige Es-Stufe (T. 126) zum vermeintlichen Ziel der Progression, der F-Stufe (T. 132). Hier scheint bereits die Rückleitungsdominante im Vorfeld einer regulären Reprise erreicht. Überraschend wird jedoch ein Quintabsatz in der Nebentonart angefügt (T. 134).[34] Die übergeordneten harmonischen Stationen sind folglich b-Moll, F-Dur und C-Dur. Dabei fungiert Des-Dur als Terzteiler auf dem Weg von der vermollten I. zur V. Stufe.
Der Beginn der Reprise (in der Deutung Hinrichsens T. 187[35]) steht in Ges-Dur. Der Nachsatz des Hauptthemas hebt analog zum Expositionsbeginn in as-Moll an. Die II. Stufe bildet hier, wie auch in Takt 31 der Exposition, den Ausgangspunkt für eine Oberquintmodulation. Ziel ist Des-Dur, wo eine weitere Rekapitulation des Hauptthemas erscheint. Deren nun in es-Moll beginnender Nachsatz wendet sich nach B-Dur (T. 211). An dieser Stelle ›klinkt‹ sich die Komposition in den Formverlauf der Exposition ein (dort T. 26). Insofern Schubert darauf verzichtet, das Hauptthema im Gestus der den Beginn von Exposition und Durchführung prägenden Forte-Eröffnung zu präsentieren, bleibt ein deutliches Reprisensignal aus. Für die Annahme, der erste Formteil der Exposition sei in der Reprise gestrichen, spricht, dass es die Taktgruppe ab Takt 26 ist, welche dort die Modulation von der Haupt- zur Nebentonart vollführt. Die Notwendigkeit, unter Voraussetzung einer regulären Retransposition des zweiten Expositionsteils die dort vor dem Eintritt des Seitensatzes erfolgende Interpunktion auf der A-Stufe zugunsten der D-Stufe zu ersetzen, hätte unter Beibehaltung des ersten Formteils zu einer redundanten Doppelung der Kadenzstufe geführt.[36] Insofern könnte auch Takt 211 als Eintritt einer (um ihren ersten Formabschnitt) verkürzten Reprise angesetzt werden. Damit würde der Vorgang in Takt 187 zur »Scheinreprise«[37] bzw. »falschen Reprise«[38] erklärt.
Beide angeführten Lesarten erscheinen als fragwürdige Alternativen, wenn man bedenkt, dass die harmonischen Vorgänge ab Takt 187 denen ab Takt 26 gleichen: Hier wie dort ereignet sich eine Oberquintmodulation, wenn auch diejenige nach Des-Dur ab Takt 187 noch nicht dem endgültigen Ziel der harmonischen Bewegung gilt, das offenkundig B-Dur ist. Die Zuordnungen von harmonischem Gang und Formteil erscheinen im Wesentlichen vertauscht: Die Oberquintmodulation des ursprünglichen zweiten Formabschnitts der Exposition ab Takt 26 begegnet im Vorfeld der tonalen Reprise in transponierter Form. Der Zusammenhang mit der Modifikation des harmonischen Chiasmus’ zu Beginn der Durchführung scheint evident. Im Gegenzug vollzieht der nunmehr zum ersten Abschnitt der tonalen Reprise gewordene Formteil (T. 211ff.) die harmonische Bewegung des ursprünglich zweiten Formteils der Exposition (T. 37ff.). Dass es sich nicht um eine weitere Modifikation des ursprünglich ersten Formabschnitts der Exposition handelt, ist daran erkennbar, dass, obwohl beide Formteile in die Obermediante modulieren, der dazu genutzte Sequenzmechanismus jeweils ein anderer ist.[39] Gleichwohl findet diese Verkehrung der Reihenfolge der harmonischen Gänge im Satzbild keine Entsprechung: Zwar hat Takt 187 Ähnlichkeit mit Takt 26, jedoch gleicht auch Takt 211 Takt 26 und nicht Takt 1.[40]
Um den Beginn der Reprise als »Resultat der Durchführung« ansehen zu können, ordnet Hinrichsen die As-Stufe in Takt 117 der in Takt 192, die Des-Stufe in Takt 120 der in Takt 198 und die Es-Stufe in Takt 126 der in Takt 203 zu. Das macht zunächst deutlich, dass Korrespondenzen zwischen ganzen Formteilen nicht gemeint sind: Nicht nur die Anfangsstufen von Durchführung und Reprise, sondern auch die jeweiligen Zielstufen (F-Dur in T. 132 bzw. C-Dur in T. 134 und B-Dur in T. 211) sind vom Vergleich ausgenommen. Als problematisch erweist ist aber insbesondere die Zuordnung der ausgewählten Stufen: Die as-Stufe in Takt 192 erklingt als II. Stufe in Ges-Dur, in Takt 117 hingegen ist es ihre Durvariante, die als V. Stufe in Des-Dur erklingt. Umgekehrt gilt, dass die Es-Stufe in Takt 126 – wie gezeigt – Durchgang auf dem Weg zur F-Stufe (T. 132) ist, ihre Mollvariante in Takt 203 jedoch wiederum II. Stufe, diesmal in Des-Dur. Beide Mollausprägungen sind demnach der jeweils vorangehenden Stufe zugeordnet, beide Dur-Ausprägungen hingegen zielen, wenn auch mit unterschiedlichem Harmonieschritt, auf die jeweilige Folgestufe. Hinrichsen führt folglich seinen Versuch einer Analogiebildung nicht nur partiell durch, sondern systematisiert Akkorde und Akkordprogressionen ohne Berücksichtigung des jeweiligen Kontextes. Auch darin gleicht sein Vorgehen dem der motivisch-thematischen Analyse herkömmlicher Provenienz, bei der es tendenziell nicht auf die Formfunktion einer motivisch-thematischen Prägung, sondern deren bloße Gruppenähnlichkeit ankommt.[41]
Ein neues Programm[42]: ›Tonalität der Tonfelder‹
Um einen alternativen Erklärungsversuch vorzubereiten, der gleichwohl Hinrichsens Gedanken eines neuartigen »Verhältnis[ses] von Form und Harmonik«[43] bei Schubert bewahrt, sei nochmals auf den ersten Durchführungsabschnitt zurückgekommen. Nach gängigen harmonischen Funktionstheorien bedeutet der Wechsel von b-Moll (T. 112) nach Des-Dur (T. 120) keinen Funktionswechsel, da beide Tonarten einander Paralleltonarten sind. Unüblich wäre es hingegen, das Verhältnis der F- und der As-Stufe, der jeweils zugehörigen Dominanten, analog zu begreifen. Stattdessen wird zumeist der Begriff der Zwischendominante herangezogen, der das Verhältnis von F- und As-Stufe allenfalls mittelbar bezeichnet. Die Relation ließe sich allerdings unmittelbar bestimmen, überträgt man das Paradigma der Verwandtschaftsbeziehung der Toniken auf die Dominanten. Dann wird der Übergang von der F- zur As-Stufe nicht als ein Funktionswechsel (zwischen zwei unterschiedlichen Zwischendominanten), sondern als ein Wechsel zwischen zwei unterschiedlichen Stufen ein und derselben dominantischen Funktion begriffen. Der in den herkömmlichen Harmonielehren oftmals nur aus Verlegenheit bemühte Begriff der ›Ellipse‹ kann entfallen. Diese Interpretation wird durch die oben vorgenommene syntaktische Analyse gestützt, die für die Taktgruppe 112–120 (in Analogie zum Beginn der Komposition) einen einzigen Formteil unterstellt, dem ein transformierter harmonischer Chiasmus (I-V-VII-III statt I-V-V-I) zugrunde liegt.
Eine systematische Fundierung dieser Auffassung leistet der musiktheoretische Ansatz Albert Simons.[44] Simon unterscheidet in der Musik zwischen Hochbarock und klassischer Moderne zwischen unterschiedlichen Tonfeldern, deren Relationen den musikalischen Zusammenhang im Werk verbürgen. Die engste Verwandtschaft zu den gängigen Funktionstheorien prägt dabei die sogenannte ›Funktion‹ aus: ein Tonfeld, das dadurch gewonnen wird, dass der bekannte Algorithmus zur Ableitung paralleler Tonarten unter Voraussetzung der Enharmonik bis zur vollständigen Zirkelbildung durchgeführt wird.[45] Die hierdurch gewonnenen acht Töne werden in eine Grundtonreihe und eine Quinttonreihe gegliedert.[46] Durdreiklänge ergeben sich durch Einfügen entsprechender Quinttöne, Molldreiklänge durch Einfügen entsprechender Grundtöne.[47] Klänge, die aus den Tönen einer Funktion gewonnen werden, gelten als funktional äquivalent. Jede Quinttonreihe kann zur Grundtonreihe einer benachbarten Funktion erklärt werden und umgekehrt. Insgesamt können auf diesem Wege drei Funktionen gebildet werden, bis auch hier ein Zirkel vollständig durchmessen ist: Jeder der 12 Töne des chromatischen Totals erhält dadurch seine Bestimmung als Grundton und als Quintton. Diese drei Funktionen heißen auch bei Simon ›Tonika‹, ›Dominante‹ und ›Subdominante‹.[48] Die Zirkelbildung führt dazu, dass ›steigend‹ (›plagal‹) von Dominante zu Subdominante, ›fallend‹ (›authentisch‹) von Subdominante zu Dominante gelangt wird.[49]
Beispiel 1: ›Funktionen‹ nach Simon mit b als einem Grundton der Tonika
Entwicklungsgeschichtlich scheint aufschlussreich, dass um 1770 ein Prozess zum Abschluss kommt, durch welchen das Verhältnis der Haupt- und Nebenstufen – unter Hauptstufen werden hier allein die I. und V. Stufe verstanden – dergestalt neu gruppiert wird, dass die Nebenstufen den Hauptstufen weit stärker in der Funktion von Prolongationen zugeordnet erscheinen als in barocker oder frühklassischer Musik.[50] Zugleich sind allerdings Tendenzen spürbar, durch welche diverse Nebenstufen erneut ein stärkeres Eigengewicht erhalten. Dabei gestalten sich die Verhältnisse deutlich anders als in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, insofern der Gebrauch von Nebenstufen nunmehr mit einem insbesondere durch Terzbeziehungen gestifteten neuartigen Gebrauch von Chromatik und Enharmonik einhergeht. Auf der Ebene der Formbildung zeigt sich, dass die attraktiven Formmomente nicht mehr (oder zumindest nicht mehr ausschließlich) durch »Knotenpunkte der Diatonik« (Felix Salzer) bestimmt sind. Ausdruck des Paradigmenwechsels zwischen ›alter‹ und ›neuer‹ Tonalität ist nicht zuletzt das Aufkommen neuartiger Formmodelle, die offenkundig im Dienste einer ›Tonalität der Tonfelder‹ stehen.
Hinsichtlich der interpunktischen Anlage des Kopfsatzes des B-Dur Klaviertrios gewinnen die auf dem Hintergrund der klassischen Formgebung irritierenden Vorgänge so eine eigene und neue Bedeutung. Sie können mit Blick auf die transponierte Riposte des harmonischen Chiasmus im Hauptsatz zu Durchführungsbeginn als Folge diverser Transformationen begriffen werden:[51] Demnach nimmt nicht mehr nur eine Stufe eine bestimmte Funktion wahr, sondern eine jede Stufe, die auf Grundlage des jeweiligen Tonfeldes gebildet wird. Zur entwicklungsgeschichtlichen Präzisierung dieser These gehört, dass das Äquivalenzverhalten der Stufen in Schuberts Komposition offenkundig noch Limitationen unterliegt, die einen spezifischen historischen Ort im Gebrauch der Tonfelder kennzeichnen.
Die D-Stufe wird am Ende des ersten größeren Formabschnittes der Exposition (T. 18ff.) über das prädominantische Signal des übermäßigen Quintsextakkordes im Rahmen eines Quintabsatzes erreicht. Doch g-Moll bleibt eine rein putative Tonart, die mit der durch den Akkord der V. Stufe (T. 24f.) vorbereiteten Rückkehr nach B-Dur endgültig negiert wird. Die Wiederaufnahme des Hauptthemas in der Ausgangstonart (T. 26) verdeutlicht retrospektiv, dass der vorausgegangene Abschnitt (ab T. 12) nicht als Überleitung zur Nebentonart, sondern als Erweiterung des Hauptsatzes zu verstehen ist. Dass die Wiederaufnahme des Hauptthemas als Ausgangspunkt der Modulation zur Nebentonart dient[52], ist ein aus zahlreichen Kompositionen der klassischen Epoche bekanntes Verfahren. Dies scheint zunächst dem Willen zu größerer motivisch-thematischer Ökonomie geschuldet: Die Wiederaufnahme des Hauptthemas ersetzt ein motivisch-thematisch unspezifisches Tutti, mit dem in der Regel Überleitungen von Expositionen im frühklassischen Additionsstil anheben. Ferner kann eine ›kontrastive Exemplifikation‹ (Nelson Goodman) des Hauptthemas eingeführt werden (so in KV 551,i). Die Wiederaufnahme des Hauptthemas schließt sich unmittelbar an seine Erstpräsentation an (dieses Verfahren in KV 428,i mit Takterstickung, in KV 333,i ohne Takterstickung) oder folgt auf eine durch den Quintabsatz der Ausgangstonart gebildete Zäsur (so in KV 551,i).
Das periodisch gebaute Hauptthema des Kopfsatzes von Joseph Haydns Sinfonie D-Dur Hob. I:96 erscheint ungeeignet für eine kontrastive Exemplifikation, die an die Stelle des motivisch-thematisch unspezifischen Tuttis ab Takt 25 treten könnte. An die durch den Quintabsatz in der Ausgangstonart (T. 31) vorbereitete Wiederholung des Hauptthemas schließt sich ein zweites motivisch-thematisch unspezifisches Tutti an (T. 39ff.). Dessen Ende scheint durch einen Quintabsatz in der Nebentonart in Aussicht gestellt (T. 57), die mögliche Zäsurbildung aber unterbleibt. Der Dominantbereich fungiert als retardierendes Moment bevor die Kadenz in der Nebentonart erfolgt (T. 71).[53] Vor dem Hintergrund einer interpunktischen Ordnung, für die Haydns Sinfonie als Beispiel dienen kann, liegt es nahe, die D-Stufe in Schuberts Trio als funktionales Äquivalent der F-Stufe zu begreifen. Es handelt sich gewissermaßen um einen ›Terzabsatz‹ in der Funktion des Quintabsatzes.[54] Damit die Transformation gelingt, wird die formale Kontextualisierung der Kadenzstufe beibehalten: Sie ist Ergebnis einer Halbschlussbildung und leitet die Wiederaufnahme einer kontrastiven Exemplifikation des Hauptthemas ein.[55]
Was die Differenzierung zwischen unterschiedlichen Formfunktionen ermöglicht, zeigt der Vergleich der beiden Passagen, die sich dem Hauptthema jeweils anschließen (T. 12–22 und T. 37–55). Sie stehen formal zwischen ›Erweiterung des Hauptsatzes‹ und ›Überleitung‹ und sind nicht motivisch-thematisch unspezifisch gehalten, sondern beruhen auf Material aus dem Kopfmotiv des Hauptthemas. Anders als Haydn scheut Schubert die Redundanz nicht; ›Pattern-Orientierung‹ scheint vielmehr Teil seines kompositorischen Konzepts zu sein. Beide Abschnitte entsprechen sich nicht nur hinsichtlich Motivik und Satzbild, sondern vollziehen auch dieselbe harmonische Bewegung in die jeweilige Obermediante: Die zweite Passage setzt von der F-Stufe aus an, die – wie bereits erwähnt – durch eine rasche Modulation am Ende der Rekapitulation des Hauptthemas erreicht wird (T. 37). Die weitgehende Analogisierung lenkt die Aufmerksamkeit auf die unterschiedlichen Sequenzmechanismen, mittels derer der harmonische Raum durchquert wird. Während die Modulation von B- nach D-Dur sich zunächst über einen fallenden ›Dur-Moll-Parallelismus‹ (Carl Dahlhaus) vollzieht, der von der I. über die V., VI. und III. zur IV. Stufe führt[56] und in dieser Form in klassischen Sonatensätzen oft einen Einschub vor dem Quintabsatz[57] der Ausgangsstufe bildet, ist beim korrespondierenden Formabschnitt eine Quintanstiegssequenz gesetzt. Die kontinuierlich sich vollziehende harmonische Aufwärtsbewegung wird gestützt durch die Vermollung der Interimsstufen. Sie scheiden damit als Dominanten aus und werden als lokale Subdominanten fortgeführt. Mit dem stetigen harmonischen Anstieg korrespondiert auch die Registerbehandlung. Die qualitative Veränderung, welche die so erreichte A-Stufe erfährt, wird durch die in den Seitensatz führende tonzentrale Modulation zusätzlich unterstrichen. Anders als in Takt 24f. fehlt hier ein herkömmlich vermittelnder Akkord. Das Seitenthema setzt direkt auf dem 3. Ton der Nebentonart an. Gleichwohl ist die damit verbundene Neubewertung eines vorausgehenden Zäsurtons, gemessen an klassischen Verfahren, prinzipiell nichts Ungewöhnliches: In zahlreichen klassischen Expositionen wird der mit dem Quintabsatz in der Oberstimme erreichte 2. Ton als 5. Ton der Nebentonart fortgesetzt. Auch der das Spannungsniveau der Nebentonart zusätzlich unterstreichende Effekt einer Höherlegung (beide Verfahren beispielsweise in KV 545,i) erscheint bei Schubert durch die tenorale Lage des Violoncellos adaptiert. In diesem Zusammenhang klärt sich nun auch der Sinn der Quintanstiegssequenz: Sie wirft eine hyperbolische Dominante an ihrem Ende aus, welche die Peripetie zur Nebentonart glaubhaft macht.[58] Eine vergleichbare Emphatisierung kann bei der vorangegangenen Ausweichung zur D-Stufe entfallen, denn dem ersten Terzabsatz soll die Qualität einer Peripetie zur Nebentonart nicht zuwachsen. In noch höherem Maße als an der Vergleichsstelle scheint für die dominantische Funktion der A-Stufe die putative Tonart, auf die sich der Halbschluss ›eigentlich‹ bezieht, nicht von primärer Bedeutung.[59]
Besonders aussagekräftig hinsichtlich Schuberts Formauffassung ist, dass die von klassischen Vorbildern her bekannte Dramatisierung von Überleitungspassagen in Verbindung mit der Modulation in die Nebentonart zunächst unterbleibt, weil die Modulation an das Ende der Wiederholung des Hauptsatzes vorgezogen wird. Dramatisierung und Modulation erscheinen auf diesem Wege voneinander getrennt. Die Dramatisierung bleibt dem sich anschließenden Gang zur A-Stufe vorbehalten. Die Wendung von B-Dur nach F-Dur hingegen ist denkbar unauffällig gehalten, wozu, neben dem formalen Ort, auch die verhaltene Dynamik und die Schlichtheit des gewählten Modulationsverfahrens beitragen (T. 34–37): Die trugschlüssige Auflösung der V. Stufe in B-Dur ermöglicht unter Einbezug der neuen VI. Stufe (in Abwandlung eines bekannten diatonischen Modulationsmodells, demzufolge die VI. Stufe der Ausgangstonart zur II. Stufe der Nebentonart wird) einen unspektakulären Übergang. Der Wendung haftet nichts von der Gewichtigkeit einer herkömmlichen Peripetie in klassischen Sonatensätzen an. Das Understatement des Übergangs wirkt gemessen an der Bedeutung des Formmoments geradezu seltsam verfehlt. Eine formfunktionale Einordnung des vollkommenen Ganzschlusses in der Nebentonart (T. 37) ist, gemessen an der traditionellen Interpunktionslehre, nicht ohne Schwierigkeit. Die Konstellation spricht deutlich für einen ersten Grundabsatz in der Nebentonart. Verblüffend wäre demnach der verfrühte Eintritt eines Formmoments, das in klassischen Formen zumeist erst mit dem Abschluss des Seitensatzes einhergeht (vgl. KV 332,i), sofern es nicht zugunsten des essentiellen Schlusses in der Nebentonart völlig ausgespart ist, wenn Seitensatz und Schluss-Kadenz syntaktisch eine übergeordnete Gruppe bilden (vgl. KV 545,i). Den Seitensatz einem Grundabsatz in der Nebentonart nachzustellen, ist zwar eine gebräuchliche Variante, bringt es aber zumeist mit sich, dass der vorausgehende interpunktische Abschnitt als Fortführung der dramatischen Überleitung eingerichtet wird: Auf diese Weise erscheint der dynamische und thematische Kontrast in den Schlussabschnitt oder in den dem Schluss unmittelbar vorausgehenden Abschnitt verlagert (vgl. KV 465,i).[60]
Auf diesem Hintergrund hat die von Schubert in Takt 37 gewählte Interpunktion keinen regulären Ort in einem Allegro-Sonatensatz um 1800, wohl aber erinnert sie stark an eine förmliche Ausweichung in die Quinttonart, wie sie im Rahmen kleinerer Formen – beispielsweise Tanzformen – zum Beschluss eines ersten Formteils üblich ist. Durch diese Übertragung erscheint die Funktion der V. Stufe innerhalb der Sonatensatzmusik von Schubert neu bewertet. Sie wird von ihrer Eigenschaft, Dominante im emphatischen Sinne zu sein, entbunden. Vorschnell erscheint demnach die Schlussfolgerung, Schuberts Umgang mit der V. Stufe bzw. mit der Funktion ›Dominante‹ sei vorrangig von »Antipathie«[61] oder dem Vorsatz der »Suspendierung«[62] geprägt. Denn der zur Verdeutlichung dieser Absicht beste Weg wäre die möglichst umfassende Aussparung beider. Dem widerspricht aber hier wie in anderen reifen Sonatensätzen Schuberts (in Dur) der beibehaltene Quintabstand von Haupt- und Nebentonart. Erst dieser bietet den Hintergrund, auf dem die Qualität der V. Stufe neu dimensioniert werden kann. In diesem Zusammenhang wäre vom Umgang mit der V. Stufe jener mit der ›Dominante‹ zu unterscheiden. Dass dies in der gängigen Forschung unterbleibt, beruht auf der dort gemachten Gleichsetzung von V. Stufe und dominantischer Funktion.[63]
Das alte funktionale Programm im Widerstreit mit dem neuen: ›Ursatz-Tonalität‹ versus ›Tonalität der Tonfelder‹
Die veränderte Funktion der V. Stufe kann eine Analyse unter Rekurs auf das Schichtenmodell Heinrich Schenkers veranschaulichen. Der Themenbau des Hauptsatzes beruht auf der kunstvollen Verknüpfung von Anstieg und Übergreifen.[64]
Beispiel 2: Strukturskizze zum Hauptsatz aus D 898,i, T. 1–12
Das Übergreifen rekurriert auf die von Robert O. Gjerdingen beschriebene melodische Formel 1-7-4-3.[65] Im Sinne der Schenkerschen Theorie erscheint dieses Schema besonders geeignet, die Terz als Kopfton zu etablieren.[66] Die entscheidenden Stationen sind Takt 4 und Takt 10. Modifiziert wird das Verfahren dadurch, dass nicht schlicht der harmonische Chiasmus I-V-V-I unterlegt ist, sondern die II. Stufe (T. 6ff.) sowie die erniedrigte VII. Stufe (T. 9) interpoliert werden. Beide Stufen gehen mit dem Strukturton c einher, dessen Einfügung den Übergreifvorgang a–es zur Brechung erweitert. Der Ton c wird dabei wie das anfängliche b zunächst tiefergelegt. In diesem Zusammenhang werden sowohl das f2 (T. 2) wie auch das analoge g2 (T. 7) als Bestandteil von Brechungen innerhalb der I. und II. Stufe mit dem Ziel einer Höherlegung gelesen.[67] Ein zweiter, wenngleich auf den ersten Blick nachrangiger Aspekt der Modifikation des Modells ist, dass mit Abschluss des melodischen Schemas 1-7-4-3 infolge einer Trugschlussverbindung die I. durch die VI. Stufe verdrängt wird (T. 10). Diese Veränderung erweist sich jedoch als Vorgriff auf das von Schubert gewählte Verfahren der Modulation in die Nebentonart im Zuge der Rekapitulation des Hauptthemas ab Takt 27. Hier ist bemerkenswert, dass der Gang zur V. Stufe bereits erfolgt, bevor der Kopfton wiedererreicht ist: Das rhythmische Signal der Synkopation, mit dem in Takt 10 das melodische Schema seinen Abschluss fand, findet sich nicht im fünften, sondern bereits im vierten Takt des Nachsatzes. Der ursprünglich vierte Takt mit seiner auffälligen Ausweichung in die erniedrigte VII. Stufe entfällt und damit zugleich auch der Abschluss des melodischen Schemas: Statt 4-3 erfolgt 2-1. Dazu setzt Schubert – wenn auch unter Verzicht auf den chromatischen Bassdurchgang – die bereits aus Takt 10 bekannte trugschlüssige Harmonieverbindung V-VI. Dieser neue vierte Takt wird Ausgangspunkt eines neuerlichen Übergreifens g3-f3, das den verweigerten Abschlusses des zunächst intendiert scheinenden Übergreifvorganges zu kompensieren scheint. Die Sequenzierung der trugschlüssigen Verbindung im Folgetakt (T. 35), die zugleich mit der Wiederherstellung des chromatischen Bassdurchgangs einhergeht, ist jedoch bereits Bestandteil des Gangs zur V. Stufe. Retrospektiv wird damit Takt 34 zum Ausgangspunkt eines lokalen Strukturzugs 5–1 in F-Dur erklärt: Takt 35 setzt mit b-a den Schritt c-b aus Takt 34 fort. Die den 2. Ton prolongierende Schlussformel der Takte 36–37 ist bereits vom Abschluss des Hauptsatzes der Takte 11–12 bekannt.
Beispiel 3: Strukturskizze zur Rekapitulation des Hauptsatzes aus D 898,i, T. 26–37
Das der Modulation in die Tonart der V. Stufe eigene Understatement wird aus der Perspektive der Schichtenlehre Schenkers dadurch angezeigt, dass die Peripetie zur Nebentonart ohne die Manifestation der Urlinienbewegung vom 3. zum 2. Ton vonstatten geht. Signifikant erscheint, dass eine auf das Wiedererreichen der Urlinie gerichtete Bewegung nicht zu Ende geführt wird. Das Moment des Abbruchs wird von Schubert dadurch zusätzlich hervorgehoben, dass mit der letzten Achtelgruppe in Takt 33 noch der Spitzenton es3 erreicht wird: die 4, die auf die 3 zu zielen scheint.[68] Der für die klassische Formgebung so zentrale Harmonieschritt ereignet sich folglich aus einer Mittelstimme heraus. Gleichwohl kann, da der Kopfton bereits durch die anfängliche Präsentation des Hauptsatzes etabliert worden ist (T. 10), die erste Bewegung in die Confinalis f (T. 37) so gedeutet werden, dass sie die Urlinienbewegung 3–2 impliziert, obgleich diese nicht manifest als reale Oberstimme akzentuiert wird. Auch die nachfolgende Quintanstiegssequenz lässt sich im Schenkerschen Sinne deuten: Ein mehrfaches Übergreifen bedeutet wiederum einen Gang zum Mittelstimmenton a, der zugleich tonikalisiert wird. Aus der Perspektive der Schichtenlehre ist der Eintritt des Tones a eine Antizipation der nebentonikalen Terz.[69] Zwar ermöglicht Schenkers Unterscheidung zwischen Stimmführung und Stufengang eine separate Betrachtung des Übergangs von der A- zur F-Stufe, er hat aber keine Funktion. Der Fundamentschritt scheint in dieser Hinsicht einem ›toten Intervall‹ vergleichbar.[70]
Beispiel 4: Strukturskizze zum Expositionsverlauf von D 898,i, T. 1–59
Anders das Ende der Taktgruppe 77–99: In den Takten 91–93 wird ein Halbschluss in der Variante der Nebentonart markiert. Durch ihn wird die zuvor erfolgte Ausweichung in die III. Stufe der Variante der Nebentonart (T. 85), die ihren Ausgang in der Molleintrübung der Nebentonart nahm, zurückgenommen. Zur Zäsurbildung kommt es jedoch nicht. Die Dominante dient der Vorbereitung der Antepänultima der Schlusskadenz: Nach zweitaktiger Prolongation beginnt eine Bewegung, die auf deren Beginn, den tonikalen Sextakkord, führt (T. 95). In diese ist als Latenz (in der rechten Hand des Klaviers) der Quintzug in die Confinalis eingeschrieben. Der lokale 1. Ton wird jedoch erst im Anschluss an die Generalpause mit Takt 100 erreicht. Dass auf eine manifeste Darstellung des Quintzuges verzichtet wird, korrespondiert mit der Taktgruppe 34–37. Auch hier ist die Leichtigkeit der Schlussgeste auffällig.
Aber auch in anderer Hinsicht scheint die Kadenzwirkung am Ende der Exposition geschwächt: Für Schlussbildungen in schnellen Sonatensätzen am Ausgang des 18. Jahrhunderts ist typisch, dass der als essentiell empfundene Schluss durch eine Reihe antizipierender Kadenzen vorbereitet wird. In der Regel wird bei der ersten, spätestens dritten Wiederholung einer schließenden Taktgruppe durch eine innere Erweiterung eine essentielle Schlussbildung hervorgebracht.[71] Insbesondere in Verbindung mit der harmonischen Doppelpunktwirkung der Dominante in den Takten 91–93 könnte daher in Schuberts Komposition eine gewichtige und eigenständige Schlussbildung erwartet werden. Dass darauf verzichtet und stattdessen wiederum jene Endigungsformel wiederholt wird, die zunächst auf den Grundabsatz der Nebentonart in Takt 81, dann aber auch auf den Grundabsatz in der III. Stufe der Variante der Nebentonart in Takt 85 führte, ist vor diesem Hintergrund von auffälliger Lakonik. Dem dramatischen Impetus der vorbereitenden Dominante wird nicht entsprochen.
Bemerkenswert erscheint aber auch die Wendung als solche, kann in ihr doch gleichsam die verspätetet eintretende Konvention einer phrygischen Halbschlussbildung gesehen werden, wie sie in schnellen Sonatensätzen des ausgehenden 18. Jahrhunderts zumeist dem Eintritt des Seitensatzes vorausgeht, sofern ein Quintabsatz in der Nebentonart gewählt ist. Aus der Perspektive der Schichtenlehre Schenkers ermöglicht dies eine Deutung, bei der die für Sonatenformen um 1800 spezifischen Auskomponierungsverfahren sowohl eine Umstellung erfahren, als auch durch andere substituiert erscheinen.
Den Ausgangspunkt dieser Deutung bildet eine Standard-Lesart der Schenkerian Analysis für Sonatenformen in Dur, derzufolge der übermäßige Quintsextakkord über der sechsten Bassstufe in Moll, der als Pänultima einer tenorisierenden mi-Kadenz der Vorbereitung des Quintabsatzes in der Nebentonart dient, aus einem chromatischen Stimmtausch resultiert. Demnach gilt bis zum Eintritt des Dominantsignals in der Nebentonart (II#) die I. Stufe als prolongiert. Vorhergehende peregrine Stufen werden dem Vordergrund zugewiesen und bleiben an die I. Stufe im Hintergrund gebunden.
Diese Interpretation geht auf Heinrich Schenker selbst zurück (vgl. 1956, Fig. 115,2). Ähnlich gelagert ist Schenkers Analyse zu Beethovens Klaviersonate C-Dur op. 2,3;i (1956, Fig. 154,2), in welcher der Eintritt des 2. Tons in der Urlinie mit Takt 43, dem Quintabsatz in der Nebentonart, angezeigt wird und nicht mit Takt 25, dem Quintabsatz in der Ausgangstonart. Obwohl ab Takt 27 g-Moll im Vordergrund lokale I. Stufe ist und d der in der strukturellen Oberstimme prolongierte Ton, subordiniert Schenker im Mittelgrund den gesamten Formteil zwischen beiden Quintabsätzen der I. Stufe. Der Ton d, dies wird durch Schenkers Bogensetzung deutlich, wird durch eine Koppelung antizipiert, gilt aber im Hintergrund noch nicht als erreicht. Vor Eintritt des Dominantsignals in der Nebentonart erscheint ein übermäßiger Quintsextakkord über der sechsten Bassstufe in Moll (T. 42). Carl Schachter wiederum hat erkannt, dass auf diesem Wege auch terzverwandte Stufen als in einen regulären Formverlauf interpoliert verstanden werden können, und zieht den chromatischen Stimmtausch für die Interpretation des Stufengangs in Schuberts D 944,i sowie Brahms’ op. 73,i heran. In diesem Zusammenhang widerspricht Schachter explizit der (von Federhofer vertretenen) Einschätzung, in diesen Beispielen läge eine Teilung des Quintanstiegs durch einen Terzteiler vor:
»To my mind, interpreting the Brahms exposition as I-III-V is unsatisfactory in at least one crucial respect: the analysis fails to reflect he extraordinary emphasis given to the V of A major that enters at the quasi ritenente of b. 118. The sudden unison tutti, the octave leaps, the accents and sforzandi, the jagged dotted rhythms – all of these combine to create the strongest contrast thus far in the movement and, consequently, the strongest emphasis. Surely the extraordinary gesture with which Brahms invests this E sonority suggests that it is a major turning point, not merely an incident on the way from F: minor to A.«[72]
Beispiel 5: Strukturskizze zum chromatischen Stimmtausch in D 898,i, T. 1–100
Beispiel 5 zeigt die Anwendung des chromatischen Stimmtausches im Falle von D 898,i: Das chromatische Derivat[73] der I. Stufe tritt mit Takt 90 ein. Die Auflösung der nachfolgenden V. Stufe der Nebentonart (T. 91–93) erfolgt im Anschluss an die Generalpause in Takt 100, der infolge Takterstickung zugleich der erste Takt des die Exposition beschließenden Epilogs ist.
Beispiel 6: Strukturskizze zum Expositionsverlauf von D 898,i, T. 1–100
In Beispiel 6 werden weitere Ereignisse des vorderen Mittelgrunds angezeigt, die den beiden Stimmtauschoperationen zugeordnet sind. Das im hinteren Mittelgrund die Takte 1 und 90 verknüpfende kontrapunktische Prolongationsverfahren erfährt eine modifizierte Analogiebildung im vorderen Mittelgrund: Auch der Quintabsatz in der putativen Tonart d-Moll wird durch eine Prädominantform als Pänultima vorbereitet (verminderter Septakkord h-d-f-gis als lokaler Vertreter der I. Stufe), die durch einen (halb-)chromatischen Stimmtausch aus der I. Stufe (T. 26) gewonnen wird. Die F-Stufe (T. 59) ist ein Durchgang, mit Hilfe dessen die A-Stufe (T. 49), die Auflösung des durch den ersten Stimmtausch hervorgebrachten Prädominantklangs (T. 48), mit dem Prädominantklang des übergeordneten Stimmtausches (T. 90) verbunden wird.[74] Noch näher dem Vordergrund steht der Terzteiler in Takt 18: Mit Takt 26 wird zur I. Stufe zurückgekehrt, und erst von hier nimmt die modulatorische Bewegung ihren Anfang. Nahe am Vordergrund erscheint in dieser Deutung auch die V. Stufe in Takt 37. Sie ist ein ›stehengelassener‹ Teiler, über den sich der erste Stimmtausch ›hinwegsetzt‹.
Freilich darf diese Deutung unorthodox genannt werden, denn, anstatt von einer zumindest latenten Bewegung der Urlinie vom 3. zum 2. Ton in Takt 37, wie in den Beispielen 3 und 4 angezeigt, auszugehen, wird nunmehr für die Stufe der regulären Nebentonart behauptet, was Schachter (1983) nur mit Blick auf eine ›peregrine‹ Stufe getan hatte: sie als Teil einer interpolierten Bewegung zu verstehen. Mit Blick auf die Gesamtform der Exposition kann diese Deutung anzeigen, woher der Eindruck rührt, die ›verfrühte‹ V. Stufe in Takt 37 verdanke sich nur einem zusätzlichen ›Faltenwurf der Form‹. Gleichwohl stützt sie aber keineswegs die oben diskutierte Einschätzung Federhofers, »die A-Stufe [untergliedere] den Weg von der B-Stufe abwärts zur F-Stufe«. Angesichts ihrer Prominenz als Stufe des Seitensatzes erscheint die Deutung der F-Stufe (T. 59) als Durchgang zwischen der A-Stufe (T. 49) und dem chromatischen Derivat des übergeordneten Stimmtausches (T. 90) fragwürdig.
Das Ergebnis der obigen Analyse stimmt mit dem Befund einer Reihe von Untersuchungen in der Nachfolge Schenkers darin überein, dass die Sonatenformen Schuberts einen ›Fluchtungsfehler‹ zwischen den von der traditionellen Formenlehre aufgeführten Momenten der insbesondere interpunktischen und motivisch-thematischen Gliederung und den durch die Schichtenlehre angezeigten Stufengängen und Stimmführungsvorgängen des Mittel- und Hintergrundes, aufweisen.[75] Insofern wird an den Sonatenformen Schuberts das in der Schenker-Analytik unter dem Schlagwort »Struktur versus Form« diskutierte Verhältnis zwischen Aspekten der sogenannten ›äußeren‹ und ›inneren‹ Form paradigmatisch virulent.[76]
Der in Beispiel 6 deutlich werdende ›Fluchtungsfehler‹ besteht zunächst darin, dass weder der 2. Ton in der Urlinie beim ersten Eintritt der V. Stufe (T. 37) angesetzt werden kann, noch der Bereich des Seitensatzes ab Takt 59 eine ›Fühlungnahme‹ (Schenker) mit der Urlinie erkennen lässt. Letztere erfolgt erst unmittelbar vor der essentiellen Kadenz (T. 93). Die Auskomponierungsverfahren erscheinen somit dem manifesten Eintritt des 2. Tons in der Urlinie zeitlich nicht nachgeordnet, sondern vorgeordnet. Mit einer solchen Deutung würde zugleich konstatiert, dass das reguläre tonale Verfahren zur Auskomponierung der Nebentonart – der Quintzug in die Confinalis unter dem 2. Ton in der Urlinie – durch die Verknüpfung diverser Verfahren des Mittelgrundes, die sich trotz der Analogiebildung zwischen den beiden chromatischen Stimmtauschoperationen anders als der Quintzug nicht einer bestimmten Direktive verdanken, ersetzt worden ist.[77]
Derartige Fragestellungen haben ihre Bedeutung freilich nicht nur mit Blick auf die Exposition. 2. Ton in der Urlinie und Quintzug in die Confinalis sind unauflöslich verbunden mit der für Schenker zentralen Idee, Sonatenformen zeichneten sich durch eine Unterbrechung in der Urlinie aus.[78] In diesem Zusammenhang verdient das Vorfeld der Submediant-Reprise (T. 187) nochmals besondere Aufmerksamkeit. Hier erscheint der besagte Quintzug erstmals in manifester Form, sondern, gemessen an seiner herkömmlichen Formfunktion, jedoch irregulär platziert: Die Prolongation der in Takt 161 erreichten typischen Rückleitungs-Dominante, die eine reguläre tonale Reprise nach sich ziehen könnte, wird mithilfe eines Orgelpunkts geleistet. Die in der Taktgruppe 169–170 anzutreffende Oberstimmenbewegung f-es-des-c, der Quartgang vom 5. zum 2. Ton, unterstützt aus der Perspektive der Schichtenlehre Schenkers diese Funktion: Die reale Oberstimme scheint nach dem Quintzug in die Confinalis unter dem 2. Ton der Urlinie und dem damit einhergehenden Gang in die Mittelstimme durch einen Übergreifzug wieder auf den Urlinieton zurückgebracht. Irritierend ist daher, dass nach der Wiederholung des Übergreifzuges durch die folgende Taktgruppe ab Takt 173 eben jener für die Auskomponierung der Nebentonart charakteristische Quintzug – nunmehr in der Varianttonart – angefügt und dadurch die Funktion der F-Stufe als Rückleitungs-Dominante zurückgenommen wird. Insofern könnte – entgegen der Einschätzung als Trugschluss – behauptet werden, der plötzliche Neuanfang in Ges-Dur (T. 187) befreie das Stück aus einer formalen Aporie. Zugleich weist diese Stelle auf das geänderte funktionale Programm: Die Rücknahme der Rückleitungs-Dominante und Neuansatz in der Untermediante der I. Stufe vertragen sich nicht mit dem für Sonatensätze von Schenker als konstitutiv beschriebenen Verfahren einer Unterbrechung.[79]
Mit Blick auf die hier skizzierte Problematik unterscheiden sich David Beach und Gordon Sly in der generellen Einschätzung der Formgestaltung bei Schubert. Während Beach (1994) in expliziter Abgrenzung zu Schachter (1983) und in offenkundiger Nähe zu Rothstein (1989) die Möglichkeit innere und äußere Form als miteinander agierende, aber prinzipiell unabhängig voneinander zu denkende Aspekte verficht, bezieht sich Sly (2001) bei seinem Versuch, die Schubertschen Formstrategien zu erhellen, bezeichnender Weise auf Charles J. Smith (1996). Sly bemüht bei dem Versuch, innere und äußere Form kongruent zu denken, die auf Schenker selbst zurückgehende Idee ›motivischer Parallelismen‹ (vgl. 1956, 50) zwischen unterschiedlichen Schichten des Werks. Freilich muss Sly, um den Stufengang der Durchführung in D 898,i (T. 112–211) als Augmentation der harmonischen Disposition des Hauptsatzes (T. 1–12) ansehen zu können, in beiden Formteilen den unmittelbaren Stimmführungszusammenhang aufweichen. Nur so kann als ›Tertium comparationis‹ ein über as und ges führender Quartgang von b nach f behaupten werden. In der Adaption von Verfahren motivisch-thematischer Analyse und in den Konsequenzen, die darin für die analytische Vorgehensweise liegen, ähnelt Sly (2001, 132) Hinrichsen (1988, 30). Slys Analyse zeigt, dass ›motivische Parallelismen‹ und die damit verbundene Idee einer zumindest partiell auf Selbstähnlichkeit beruhende Organisation der Schichten dem Versuch geschuldet sind, die auf Gruppenähnlichkeit rekurrierende Vorstellung von musikalischem Zusammenhang, wie sie in der traditionellen Formenlehre begegnet, für die Schichtenlehre zu adaptieren. Dies kann als unmittelbare Folge davon gelten, dass Aussagen darüber, welche Art von Diminutionsmotiven für welche Schicht charakteristisch ist und wie sich der transformatorische Prozess zwischen den einzelnen Schichten verhält, von Schenker nur für den Übergang von Hintergrund zu hinterem Mittelgrund systematisch getroffen worden sind. Die Erklärungen versiegen hingegen für den ›Tonraum‹ zwischen Mittelgrund und äußerstem Vordergrund, obgleich die überwiegende Anzahl der im Freien Satz gegebenen Analysen den Vordergrund betreffen.[80]
Mit Blick auf die ›Fluchtungsfehler‹ der vorstehenden Analyse, kann die Behauptung, das Programm ›Ursatz-Tonalität‹ allein böte eine hinreichende Erklärung für die Formanlage der Komposition Schuberts, problematisiert werden. Zudem erlaubt, was Anlass und Einstieg in die Analyse bot, das verspätete Dominantsignal (T. 91–93), auch eine andere Deutung als die einer Verlagerung des herkömmlichen Quintabsatzes in der Nebentonart. Gerade die vorausgehende Molleintrübung mit der includierten Ausweichung in eine Nebenstufe lässt auch an ein Verfahren denken, wie es beispielsweise aus Mozarts KV 332,i bekannt ist, wo eine sich an den Seitensatz anschließende Taktgruppe ebenfalls mit einer Molleintrübung einhergeht und die anschließende Rückwendung zur regulären Nebentonart durch einen entsprechenden Quintabsatz vorbereitet wird (T. 56–71). Der entscheidende Unterschied zu Schubert zeigt sich darin, dass der Quintabsatz bei Mozart im Rahmen der Kadenzdisposition an den gewichtigeren Quintabsatz im Vorfeld des Seitensatzes anschließt (T. 40). Aus der Perspektive der Schichtenlehre Schenkers wird dies daran ersichtlich, dass der zweite Quintabsatz mit einem Gang in den Mittelstimmenton d unter dem Urlinieton g einhergeht und in der realen Oberstimme nicht erneut auf g selbst führt. Zudem erscheint die gesamte Taktgruppe gegenüber der obligaten Lage, die durch den vorausgehenden Seitensatz markiert wird, um eine Oktave tiefergelegt.[81] So gesehen scheint der Quintabsatz bei Schubert an ein Ereignis anzuschließen, das realiter gar nicht stattgefunden hat, da der retrospektiv suggerierte reguläre Quintabsatz durch die Halbschlussbildung auf der A-Stufe substituiert wurde.[82]
Zum Programmwechsel: ›Anschlussfähigkeit‹
In Schuberts Verfahren kann eine Strategie gesehen werden, durch den teilweisen Rekurs auf herkömmliche ›Nahkontexte‹ Verbindlichkeiten zu bedienen, die ein neues Programm anschlussfähig machen.[83] Das setzt Überlegungen von Markus Neuwirth fort, die dieser in seinem Beitrag für diese Ausgabe dargelegt hat. Neuwirth hebt unter Hinweis auf eine entsprechende Äußerung Jan LaRues[84] zu Recht hervor, dass die »bloße, statistisch häufige Assoziation zweier Akkorde (wobei die funktionale Bedeutung des zweiten Akkords als Tonika außer Frage steht) als Kriterium zur Bestimmung harmonischer Funktionalität«[85] nicht hinreichend ist. Neuwirth hält der Ansicht, eine »V. Stufe erhielte ihre funktionalen (dominantischen) Qualitäten […] vor allem aufgrund hoher statistischer Übergangswahrscheinlichkeiten«, entgegen, »dass dann jeder Akkord, der der I. Stufe statistisch häufig vorausgeht, dominantisch sein müsste.«[86]
Das hier aufscheinende Problem scheint dem der Enharmonik verwandt: Tonqualitäten, die (gemessen an ihrer jeweiligen Zugehörigkeit zu diversen diatonischen Kontexten) nicht identisch sind, werden aufgrund einer Änderung des harmonischen Kontextes dennoch als identisch identifiziert. Geht man davon aus, dass mit Tonalität, so wie sie herkömmlich für den Zeitraum von etwa 1700 bis 1900 angesetzt wird, ein und dasselbe Programm gemeint ist, dann ergeben sich notgedrungen jene Schwierigkeiten, die Neuwirth referiert, denn für dieses Programm kann nicht plausibel gemacht werden, warum III# und V gleichermaßen dominantische Funktion haben sollten. Ein ganz anderes Bild ergibt sich, wenn ein neues Programm für solche Kompositionen unterstellt wird, in denen die Übergangswahrscheinlichkeit für III#-I bedeutend zunimmt. Unter dieser Voraussetzung erscheint die Frage, ob III# eine alternative Dominante zu V ist, von einer falschen Erwartung geleitet. Denn zwischen einer Dominante der Ursatz-Tonalität und einer Dominante der Tonalität der Tonfelder besteht keine Identität. Die Behauptung, das Tonfeld ›Funktion‹ impliziere die funktionale Äquivalenz der auf ihm beruhenden Stufen, meint letztlich die funktionale Äquivalenz einer neuen, nicht einer bekannten Qualität. Der Umstand, dass die von den herkömmlichen Funktionstheorien behauptete funktionale Äquivalenz zwischen kleinterzverwandten Klängen wie I und III in Moll und I und VI in Dur in der neuen Dominante aufgeht, kann Anlass zu Missverständnissen sein. Strenggenommen ist die Rede, die Funktion der Dominante greife auf andere durch das Tonfeld ›Funktion‹ definierte Stufen über, eine unzulässige Verkürzung, ebenso der Begriff der Transformation (als Veränderung der Gestalt) oder Substitution.
Gleichwohl scheint die neue Dominante in Teilen Eigenschaften und Verhalten der alten, bekannten Dominante zu ›erben‹. Diese Einschätzung kann unter Rekurs auf die Systemtheorie verortet werden: Angesichts des Ephemeren der Kunst kommt Niklas Luhmann in Die Kunst der Gesellschaft auf das »Problem der Systembildung« zu sprechen, das in der »Anschlussfähigkeit« läge, »in der rekursiven Wiederverwertbarkeit von Ereignissen.[87]
Operationen (bewußte Wahrnehmungen ebenso wie Kommunikation) sind nur Ereignisse. Sie sind nicht bestandsfähig, noch kann man sie ändern. Sie entstehen und verschwinden im selben Augenblick und nehmen sich nur so viel Zeit, wie nötig ist, um die Funktion eines nicht weiter auflösbaren Elements zu erfüllen. Nur auf der Ebene elementarer Ereignisse hat das Kunstsystem Realität. Es beruht, kann man sagen, auf dem Dauerzerfall seiner Elemente, auf der Vergänglichkeit seiner Kommunikationen, auf einer Art alles durchdringender Entropie, gegen die dann das, was Bestand gewinnt, organisiert sein muss.«[88]
Auf dem Hintergrund dieser Argumentation wäre zu bedenken, dass eine Stufe wie III#, deren Qualität als ›alternative Dominante‹ umstritten ist, nicht nur, weil sie an den ›Knotenpunkten‹ der Form in Erscheinung tritt, sich durch eine hohe statistische ›Übergangswahrscheinlichkeit‹ in eine nachfolgende Tonika auszeichnet. Sie ist vielmehr in eine Instantiierung von Nahkontexten eingebunden, wie sie aus herkömmlichen Übergängen bekannt ist. Gerade am Beispiel des Kopfsatzes aus Schuberts großem B-Dur-Klaviertrio kann gezeigt werden, inwiefern durch die zu Verfahren der ›Ursatz-Tonalität‹ analoge Gestaltung von Nahkontexten das neue Programm seine ›Anschlussfähigkeit‹ erhält. Damit korrespondiert die Beibehaltung des Signifikanten ›Dominante‹. Sie ermöglicht Anschlusskommunikationen im sozialen System Kunstanalyse:
Auch in Schuberts Komposition werden die Stufen immer noch zum Ausdruck einer Tonart verbunden. (Nur die Rede, die Komposition stünde in B-Dur, gestattet D-Dur als III# und F-Dur als V zu bezeichnen.)
Das materiale Substrat der Dominante der neuen Tonalität zeichnet sich gegenüber dem Substrat der Dominante der ›neuen‹ Tonalität durch den Aspekt der Erweiterung (›Generalisierung‹) und Selektion (›Spezifikation‹) aus: Eine Erweiterung bedeutet es, wenn die das Substrat der Dominante bildende Tonmenge der alten Tonalität (z.B. die Töne f, a, c) um weitere Töne in der ›neuen‹ Tonalität ergänzt wird (dort treten zu f, a, c die Töne d, fis, a, h, dis, fis, as, c und es hinzu). Zur Selektion gehört, dass für eine Dominante in der Ursatz-Tonalität ein spezifischer Stimmführungszusammenhang behauptet wird (2/V), der für eine Dominante der ›Tonalität der Tonfelder‹ in dieser Form nicht vorausgesetzt ist.
Die Ähnlichkeit des Nahkontextes der III# bei Schubert im Vergleich demjenigen der V in Kompositionen des 18. Jahrhunderts bezieht sich vorwiegend auf die ›weichen‹ Momente der Instantiierung einer dominantischen Interpunktion:
Die III# ist Zielstufe eines Halbschlusses.
Die vorausgehenden Sequenzmechanismen sind in Kompositionen des 18. Jahrhunderts charakteristisch für den Quintabsatz der Haupttonart (fallender ›Dur-Moll-Parallelismus‹) und den Quintabsatz der Nebentonart (›Quint-Anstiegssequenz‹).
Zwischen haupttonartlichem und nebentonartlichem Bereich vermittelt ein Verbindungston: In der Ursatz-Tonalität wird der 2. Ton der Haupttonart zum lokalen 5. Ton. In Schuberts Komposition ist der Grundton der neuen Dominantstufe auch 3. Ton der Nebentonart. Im Übergang zur Nebentonart erscheint der vermittelnde Ton ›höhergelegt‹.
An die III# in B-Dur schließt sich eine kontrastive Exemplifikation des Hauptsatzes in der Haupttonart an, an die III# in F-Dur ein Seitensatz in der Nebentonart. Beide Stufen gehen dadurch mit einer standardisierten Interpunktionsfolge (hinsichtlich der Abfolge von Halbschluss- und Ganzschlussbildungen vor der Mittelzäsur der Exposition) einher.
Die Aufstellung zeigt, wie Verfahren beider Formen von Tonalität in Schuberts Komposition aufeinander bezogen sind. Demnach erscheint weder die Einschätzung überzeugend, beide Programme koexistierten schlicht im Werk[89], noch müssen, weil nur ein Programm als konstitutiv für den musikalischen Zusammenhang anerkannt wird, die Verfahren des anderen für äußerlich erklärt werden.[90] Zwar widerspräche eine schlichte Doppelung funktionaler Strukturen im Werk der Idee von musikalischem Zusammenhang als ›Einheit‹. Gleichwohl erweisen sich im Lichte des Konzept der ›Anschlussfähigkeit‹ Inkommensurabilität oder Beziehungslosigkeit beider Programme als falsche Gegensätze.
Ausblick
›Anschlussfähigkeit‹ zielt auf die Fortsetzung von Kommunikation. Sie gibt keine Erklärung der funktionalen Phänomene. Von ihr bleibt beispielsweise unberührt, dass der ›Theorie der Tonfelder‹ zufolge nicht beliebige, sondern nur bestimmte Stufen als ›Funktion‹ einander ersetzen können.[91] Hier zeigt sich: Die Diskussion darüber, ob III# eine ›alternative Dominante‹ ist oder nicht, leidet an der Unmöglichkeit zu sagen, was eine Dominante überhaupt ist. Die Rede von der Funktion der Dominante zielt auf ein durch und durch musikalisches Phänomen. Eine begriffliche Klärung ist sowohl für die Ursatz-Tonalität als auch für die Tonalität der Tonfelder unmöglich. ›Strukturen‹ sind nicht das Vermittelnde, sondern das Vermittelte. Sie »verursachen tonalen Zusammenhang nicht, sondern indizieren sein Gelingen.«[92]
Soll der Gebrauch des Terminus ›Dominante‹ in Verbindung mit der ›neuen‹ Tonalität gleichwohl nicht zu einer fragwürdigen Äquivokation werden, muss das veränderte Programm angezeigt werden. Die Funktionsbezeichnung erfolgt aber nicht durch einen neuen Terminus, sondern dadurch, dass bisherige Signifikanten[93] wie ›Dominante‹ um neue ergänzt werden, damit auch an den bisherigen eine Veränderung der Bezeichnungsleistung verständlich wird. Dies geschieht in der Theorie Albert Simons, indem weitere Tonfelder, ›Konstrukte‹ und ›Quintenreihe‹, eingeführt werden und musikalischer Zusammenhang durch die Verhältnisse zwischen allen drei Klassen von Feldern (oder zumindest zwei von ihnen) bestimmt wird.
Auf diesem Hintergrund soll auf die bereits angesprochene Problematik der Repriseneinrichtung und ihr Verhältnis zur Durchführung nochmals Bezug genommen werden. Aus der Perspektive Simons handelt es sich bei dem Themeneinsatz in Takt 187 um eine Subdominantreprise. Auch hier mag zunächst verblüffen, dass ein Topos unter Schuberts Formstrategien der späten 1810er Jahre wieder aufgegriffen, die reguläre Stufe jedoch durch eine äquivalente Stufe verdrängt worden ist (eine ›untransformierte‹ Subdominantreprise findet sich bereits in KV 545,i). Die im Anschluss von Ges-Dur nach Des-Dur vollzogene Oberquintmodulation wäre demnach als Rückführung zur Funktion der Tonika zu begreifen. Der Übergang von Des-Dur nach B-Dur (T. 203ff.) erscheint als Kippbewegung zur ›Frontansicht‹[94] innerhalb ein und derselben Funktion.
In der Mitte der Durchführung wird der mediantische Anschluss des Seitensatzes sequenziert (T. 137–155) und auf diese Weise, ausgehend von der C-Stufe, ein Großterzzirkel durchlaufen. Schubert führt damit ein weiteres Tonfeld aus. Es umfasst sechs Töne, die sich wiederum in Grund- und Quinttöne gruppieren lassen. Durdreiklänge ergeben sich durch Einfügen entsprechender Grundtöne, Molldreiklänge durch Einfügen entsprechender Quinttöne. Das Feld beinhaltet Quinten aller drei Funktionen und trägt daher den Namen ›Konstrukt‹.[95] Anders als bei der Funktion sind Konstrukte absolut im Tonraum definiert: Jedes Konstrukt kann durch ein komplementäres Konstrukt zum chromatischen Total ergänzt werden. Für diese Anordnung bestehen wiederum prinzipiell zwei Möglichkeiten.
Beispiel 7: Konstrukte nach Albert Simon
Für die Harmonik Schuberts kann es als typisch gelten, dass ein Wechsel zwischen benachbarten Funktionen durch die Wahl einer ›Transformation‹ so eingerichtet ist, dass der Übergang zugleich ein Konstrukt hervorbringt. Dieses Verfahren begegnet in der Exposition des Kopfsatzes des Klaviertrios B-Dur an zwei unterschiedlichen Stellen: Das Verhältnis von Tonika B-Dur und Dominante D-Dur bringt zu Beginn der Exposition ein fünftöniges Konstrukt IIb hervor.[96] Analog hierzu wird ein fünftöniges Konstrukt Ia durch das Verhältnis von A- und F-Stufe generiert.
Es zeigt sich, dass ein Formverlauf, der auf die Vervollständigung oder Eliminierung eines Tonfelds hin ausgerichtet ist, der Formdramaturgie einen prozessualen Charakter verleihen kann. Hier verdient die über die Vermollung der Nebentonart vollzogene Ausweichung nach As-Dur innerhalb des Schlussabschnitts der Exposition besondere Beachtung (T. 77ff.): Die motivisch-thematische Analogisierung der Takte 85 und 77 legt zunächst einen Stufenwechsel innerhalb der Funktion der Nebentonart nahe. Zugleich vervollständigt jedoch die Einführung des Tones as auch das im Übergang von A- zu F-Stufe aufgespannte Konstrukt Ia um den noch fehlenden Ton. Von einer vergleichbaren ›Fernwirkung‹ zehrt auch der Beginn der Durchführung: Mittels des traditionellen Topos’, diesen Formabschnitt mit der Mollvariante des Hauptthemas zu eröffnen, wird des, der noch fehlende sechste Ton des von B- und D-Stufe aufgespannten Konstrukts IIb, eingeführt. Der Großterzzirkel C-As-E-C inmitten der Durchführung (T. 137–155) schließlich ergänzt das Konstrukt IIb durch das komplementäre Konstrukt IIa zum chromatischen Total. Ein fünf Töne umfassendes Konstrukt IIa bilden bereits die As-Stufe (T. 77ff.) und die C-Stufe des Quintabsatzes der Nebentonart (T. 91–93). Dass die E-Stufe die einzige durch den Großterzzirkel der Durchführung neu eingeführte Stufe ist und mittig im gesamten Satz steht, spricht für ihre Qualität als ›Rückseite‹ der Tonika.
Diese Beobachtungen sind vorläufig. Der an Federhofer und Hinrichsen geübten Kritik kann erst in vollem Umfang entsprochen werden, wenn analog zum Ansatz Schenkers zwischen unterschiedlichen Schichten im Tonsatz unterschieden wird.[97] Eine Direktive kann dabei die durch Bernhard Haas übermittelte These Albert Simons sein, Werke, die auf Tonfeldern beruhten, würden in der Regel durch ›zwei Tonfelder des Ganzen‹ konstituiert.[98] Tonbewegungen würden sich dann nicht allein durch das Abgreifen der Töne eines einzelnen Feldes ereignen, sondern gingen auf das gegebenenfalls polare Verhältnis unterschiedener Felder zurück. Die bisherigen Beobachtungen weisen daraufhin, dass die Beziehung zwischen B-Dur und b-Moll bzw. zwischen den Tönen d und des einer hintergründigeren Schicht zugehörig ist[99], anders als das komplementäre Konstrukt IIa, das trotz der mit ihm einhergehenden Vervollständigung (oder vielleicht auch gerade wegen dieser) eher ein Vordergrundphänomen zu sein scheint. Dass das Konstrukt IIb eines der ›Tonfelder des Ganzen‹ ist, darauf verweist auch, dass der neuralgische Punkt des Stückes – jenes Ges-Dur in T. 187 – nicht nur eine der ›Seiten‹ der Subdominante bildet, sondern auch die dritte, bis dato nicht explizit artikulierte Stufe des Konstrukts.
Der Umstand, dass innerhalb von Konstrukt (und Funktion) enharmonisch identifizierbare Tonstufen in Erscheinung treten, erlaubt es, die Bedeutung der Enharmonik für die großformale Disposition bei Schubert zu reformulieren:[100] Enharmonische Identifikationen können mit großräumigen Überführungen von einer Tonqualität zu ihrem enharmonischen Pendant (hier von fis zu ges) einhergehen. Freilich tritt hier eine Erklärungslücke zwischen der zuvor gemachten theoretischen Voraussetzung von der uneingeschränkt geltenden Enharmonik einerseits und der Erfahrung der Ton- und Stufenwirkungen im Stück andererseits zu Tage. In Schuberts Komposition wird offenkundig nicht bloß der Zweck der besseren Lesbarkeit verfolgt (wie Schönberg meinte, der damit über einen bereits veränderten Gebrauch der Tonfelder an einem anderen historischen Ort Auskunft gibt[101]). Simon selbst gibt auf diese Problemstellung dadurch eine Antwort, dass er neben den beiden bereits eingeführten Feldern ›Funktion‹ und ›Konstrukt‹ noch eine dritte Kategorie, die ›Quintenreihe‹, einführt. Hierdurch wird die harmonische Distanz zwischen unterschiedlichen (nicht zuletzt enharmonisch identifizierbaren) Stufen auf Grundlage reiner Quintabstände beschreibbar. Aus der Quintenreihe »erwachsen«[102] die chromatischen und enharmonischen Tonbeziehungen der Funktionen und Konstrukte.
Einen Hinweis auf eine entsprechende Anordnung gibt die Coda des Satzes. Hier scheint plakativ ein Ordnungsprinzip zur Anwendung gebracht, dass sich auffällig anders ausnimmt als die vorigen: Ab Takt 293 führt die Koppelung jeweils zweier diatonischer Terzfälle zunächst von B-Dur nach Es-Dur und dann noch weiter nach As-Dur (T. 305). Die Zielstufe ist durch die klangliche Massierung (einziges dreifaches Forte im gesamten Satz) auf das Äußerste markiert. Der Rückweg nach B-Dur atmet dann die schon bekannte Leichtigkeit des Stufenwechsels innerhalb ein und derselben Funktion (T. 307–309). Schubert kommt hier auf einen bereits im Hauptsatz gesetzten Effekt (T. 9–11) zurück. Die Art aber, wie die As-Stufe erreicht wird, unterscheidet sich von dem dort gewählten Verfahren durch das konsequente Durchschreiten des Quintenzirkels. Der Ton as wird hierdurch zum Sockelton eines ›Tetratons‹ (as-es-b-f) erklärt. Nimmt man die Dreiklangsterzen mit hinzu, ergibt sich ein ›Heptaton‹ (as-es-b-f-c-g-d) über as. Im Moment der Rückführung nach B-Dur wird dieses durch Einführung des Leittones a zum ›Oktoton‹ ergänzt. Diese kurzzeitige Erweiterung des Tonvorrats ist ein auffällig inszenierter Moment bevor sich die Musik mit dem allerletzten Schluss wieder auf die Diatonik von B-Dur, dem Heptaton (es-b-f-c-g-d-a) über es, ›zurückzieht‹.
Dass Schubert erst am Ende des Satzes auf den bereits im Hauptsatz der Exposition gesetzten Effekt zurückkommt, scheint durch die im Zuge der rekomponierten Reprise erfolgende Aussparung der Taktgruppe 1–26 motiviert. Dennoch wirkt der Moment nicht wie das Telos der Anordnung, sondern mutet retrospektiv an. Dies erklärt sich vor dem Hintergrund des Seitensatzes der Reprise. Dessen syntaktische Struktur als ›Periode‹ ist im Nachsatz auffällig erweitert.[103] Durch die Gattungskonvention des Rollentauschs der melodieführenden Instrumente motiviert, erscheint der Seitensatz als Doppel-Periode. Schon im Nachsatz der ersten der beiden Perioden (T. 248–253) wird anstatt der schlichten Auskomponierung der 1-7-1-Wechselnotenbewegung im Bass mit I-V-I (wie zu Beginn des Vordersatzes) die Reharmonisation der 7 durch einen verminderten Septakkord zum Ausgangspunkt einer Progression über einem chromatisch steigenden Bass gemacht. Erst im Nachsatz der zweiten Periode aber (T. 257– 262) werden dabei alle drei verminderten Septakkorde des chromatischen Totals berührt. Jeder dieser Akkorde kann als Grundtonreihe einer der drei Funktionen aufgefasst werden, die durch den jeweiligen nachfolgenden Akkord um zwei Quinttöne ergänzt werden: im Falle der Subdominante es-fis-a-c (T. 258) durch b und g zur IV. Stufe (T. 259), im Falle der Dominante as-h-d-f (T. 259) durch es und c zur erniedrigten VII. Stufe (T. 260) und im Falle der Tonika b-cis-e-g (T. 260) durch f und d zur I. Stufe (T. 261). Im Vordergrund ist das Geschehen der Takte 257–261 demnach eine Kadenz mit der Folge T-S-D-T. Darauf folgt eine konventionelle Schlusskadenz am Ende des Nachsatzes (T. 261f.), die offensichtlich in keinem direkten Zusammenhang zur Auskomponierung der Funktionen steht.[104] Die innere Erweiterung scheint zunächst, wie im Nachsatz der ersten Periode, auf die Subdominante (T. 259) zu zielen, die im Vordersatz erneut ausgespart ist. Der nachfolgenden erniedrigten VII. Stufe eignet im Vergleich zur IV. Stufe der Charakter der Überbietung.
Beispiel 8: Strukturskizze zum Seitensatz der Reprise in D 898,i, T. 253–262, Funktionen im Vordergrund
Mit dem Eintritt der Subdominante wird das Heptaton es–a vervollständigt, das die Diatonik der Haupttonart B-Dur begründet. Mit der erniedrigten VII. Stufe geht die Subponierung eines weiteren Quinttons einher, durch den die Anordnung zum Oktoton as–a ergänzt wird. Dieses Verfahren ähnelt dem im Hauptsatz. Dort liegt als syntaktische Struktur keine ›Periode‹ sondern ein ›Satz‹ vor.[105] Mit Ende der fünftaktigen ›Grundidee‹ erfolgt zwar ein Ausfallschritt zur V. Stufe, doch spricht die nachfolgende Transposition der Eröffnungstakte als ›Grundidee‹ im Bereich der II. Stufe dafür, zunächst von der Darstellung des Hexatons es-d durch die Akkorde der I. und II. Stufe auszugehen und die V. Stufe der Takte 4–5 als Durchgang zu verzeichnen. Auf dem Hintergrund der Erwartung, das Hexaton es-d möge zum Heptaton es-a, das die Diatonik von B-Dur begründet, vervollständigt werden, ist es bemerkenswert, dass in Takt 9 zunächst as und erst im Folgetakt a erscheint. Mit dem Ton a wird zwar der Ton as als irregulärer 7. Ton durch den diatonisch regulären Ton verdrängt, doch scheint dies auch hier primär Folge davon zu sein, dass in Schuberts Komposition auf herkömmliche Kadenzbildungen, ihren Stufengang und den damit einhergehenden Tonvorrat (noch) nicht verzichtet wird, weswegen als ›gemeintes‹ Feld des gesamten Hauptsatzes im Mittelgrund hier das Oktoton as–a angenommen wird.
Diese Anordnung wird im Seitensatz der Reprise durch den Simultanquerstand c-cis in Takt 260 signifikant erweitert.[106] Der im Hauptsatz als Durchgangston verwendete Ton ges (T. 9) bedeutet einen Vorgriff auf die Repriseneinrichtung in Ges-Dur ab Takt 187, welche die Taktgruppe 1–26 ersetzt. Durch den in direktem Anschluss an den Durchgang erfolgenden Trugschluss (T. 10) wurden in Umkehrung der Bewegungsrichtung die Töne ges und fis erstmals direkt nebeneinander gestellt. Die Bedeutung des Tones ges als Grundton im Konstrukt IIb wird auch in der Rekapitulation des Seitensatzes in der Reprise ins Spiel gebracht: Zu Beginn des Nachsatzes ersetzt der verminderte Septakkord der VII. Stufe den Quintsextakkord der V. Stufe (T. 249 bzw. 258). Wiederum ist das Moment der Expektanz wesentlich: Erst mit Ende der Taktgruppe 258–260 wird dem Grundton fis der Quintton cis im Mittelgrund zugeordnet.[107]
Die besondere Qualität von Takt 260 rührt allerdings auch daher, dass durch die Synkopation des Tones c der As-Dur-Dreiklang und der C-Dur-Dreiklang unmittelbar aufeinanderfolgen. Damit ist auch das zu IIb komplementäre Konstrukt IIa gegeben[108], und es kommt zu einem Widerhall der Zirkelharmonik im Mittelteil der Durchführung (T. 137–155). Der As-Klang erscheint im Seitensatz der Reprise somit in dreifacher Hinsicht bestimmt: im Mittelgrund als Teil der subdominantischen Funktion und des Konstruktes IIa und im Hintergrund als Teil des Oktotons as–a. Er ist Zentralklang der Anordnung ohne tonikal zu sein.
Beispiel 9: Strukturskizze zum Seitensatz der Reprise in D 898,i, T. 244–260, Konstrukte IIa und IIb im Mittelgrund
Für eine Quintenreihe als zweites ›Tonfeld des Ganzen‹ spricht bereits das auffällige Vordergrundphänomen der ajoutierten Sexte g in Takt 2f. Durch die Analogisierung im Bereich der II. Stufe wird der Ton as erstmals eingeführt (T. 7f.). Die affirmative Wendung nach As-Dur im Rahmen der Coda aber resultiert aus dem besonderen Stellenwert nicht alleine des Tones as sondern der Dreiklangsquinte as-es. Beide Töne bilden die tiefste Quinte im Oktoton as-a sowie im Konstrukt IIa. Von daher könnte das Prinzipielle des Verfahrens in der Zuordnung zweier komplementärer Konstrukte zu einem Oktoton gesehen werden: Ein Oktoton enthält vier Quinten, die über Kreuz zwei komplementären Konstrukten angehören. Im vorliegenden Fall sind dies: as-es und c-g als Teil-Konstrukt IIa und b-f und d-a als Teil-Konstrukt IIb. Ein jedes Oktoton kann durch Ergänzung der beiden fehlenden Quinten zu einem durch zwei komplementäre Konstrukte strukturierten Zwölftonfeld erweitert werden. Wird, wie im vorliegenden Fall, die Quintenbreite über die ›tiefste‹ Quinte (as-es) hinaus um eine weitere Quinte ergänzt (ges-des), komplettiert dies das eine Konstrukt (IIb), wird über die ›höchste‹ Quinte (d-a) hinaus eine weitere Quinte ergänzt (e-h), komplettiert dies das andere (IIa).
Beispiel 10: Verhältnisse zwischen Oktoton as–a und den Konstrukten IIa und IIb
Das Oktoton ›entlässt‹ die Konstrukte. Die ›Ton‹-Bewegung findet ihren Abschluss darin, dass zum Ausgangsfeld zurückgekehrt wird. Wie gezeigt wurde, erfolgt die entscheidende Wiederherstellung des Oktotons bereits mit dem Seitensatz der Reprise. Die Aufgabe der Coda kann darin gesehen werden, die besondere Qualität des As-Klangs als Zentralklang und damit die gesamte Anordnung ein letztes Mal in den Fokus zu rücken. Ein Anklang an das Konstrukt IIa wird hier durch die Betonung der reinen Quintbeziehungen zur Gänze gemieden. Dass die As-Stufe Teil der dominantischen Funktion ist, wird erst mit dem ›Einfädeln‹ in die Schlusskadenz relevant. Herausgestellt wird demnach nochmals die Bedeutung des Oktoton as–a als eines der beiden ›Tonfelder des Ganzen‹. Nach den bisherigen Beobachtungen steht ihm das Konstrukt IIb als das andere ›Tonfeld des Ganzen‹ gegenüber.[109]
Das Oktoton as–a ›entlässt‹ nicht nur das Konstrukt IIb, sondern zugleich das komplementäre Konstrukt IIa, wodurch die Organisation eines Zwölftonfeldes möglich wird. In Analogie zu IIb prägt der Expositionsverlauf auf dem Hintergrund des Sonatenprinzips das Konstrukt Ia als Oberquinttransposition von IIb aus. Das hierzu wiederum komplementäre Konstrukt Ib ist jedoch nicht Bestandteil der Analogiebildung. Insofern geht es in Schuberts Komposition nicht um ›zwei mal zwölf‹ Töne.[110]
An die drei Quinten des Konstrukts IIb lagern sich die Auskomponierungen der drei Funktionen an: Im Falle der Dominante treten zu d-a (T. 18)[111], f-c (T. 59) und as-es (T. 85) hinzu. Zwar fehlt die Quinte h-fis, jedoch erscheint fis als Terzton im Rahmen der D-Stufe (T. 18). Im Falle der Subdominante treten zu ges-des (T. 187), a-e (T. 49), c-g (T. 91–93) und es-b (T. 126) hinzu, wobei der Ton ges bereits im Rahmen des Expositionsepilogs als kleine 6. Bassstufe der Nebentonart antizipiert wird (T. 100ff). Im Falle der Tonika treten zu b-f (T. 1), des-as (T. 198)[112] und e-h (T. 147) hinzu. Hier fehlt die Quinte g-d, jedoch erscheint d als Terzton im Rahmen der B-Stufe. Eine Antizipation des Tones des erfolgt bereits mit Beginn der Durchführung (T. 112).[113]
Beispiel 11: Strukturskizze zu Exposition, Durchführung und Beginn der Reprise in D 898,i, T. 1–198, Konstrukt IIb und angelagerte Funktionen
Anmerkungen
Vgl. dazu mit Blick auf das Verhältnis von Harmonik, Diastematik und Metrik Michael Polth: »Tonalität ist nicht dasselbe wie Harmonik. Harmonik bildet – wie auch Diastematik und Metrik – ein Teilsystem der Tonalität.« (2001, 27) | |
Die Begriffe ›Funktion‹/›funktional‹ werden in der vorliegenden Untersuchung in drei unterschiedlichen Bedeutungen verwendet: 1.) Mit Blick auf den Begriff der ›Funktionalität‹ bzw. den der ›funktionalen Analyse‹ bei Niklas Luhmann: »Die funktionale Analyse benutzt Relationierungen mit dem Ziel, Vorhandenes als kontingent und Verschiedenartiges als vergleichbar zu erfassen.« (1987, 83) Nicht gemeint ist die Spezifikation, die der Begriff im Zusammenhang mit Luhmanns Gesellschaftstheorie erfährt (vgl. auch Rohringer, Druck in Vorbereitung). 2.) Mit Blick auf die musiktheoretische Tradition als ›harmonische Funktion‹, jedoch nicht im eingeschränkten Sinne der so genannten ›Funktionstheorie(n)‹. 3.) Als spezifisches Tonfeld in der Systematik Albert Simons. | |
Vgl. die Kopfsätze von op. 29 (VI), op. 31,1 (III) und op. 53 (III#). | |
Vgl. Coren 1974, 569. | |
Salzer 1927, 86–125. – Die im Zentrum der nachfolgenden Analyse stehende Komposition, der Kopfsatz des Klaviertrios B-Dur D 898, weist keine ›Dreitonartenexposition‹ im engeren Sinne auf. Allerdings ist die Stufendisposition auch hier gegenüber einer Komposition des ausgehenden 18. Jahrhunderts stark angereichert, so dass sich dieselben prinzipiellen Fragen aufdrängen, die sich auch mit Kompositionen mit einer ›Dreitonartenexposition‹ verbinden. | |
Federhofer 1978, 68. | |
Hinrichsen 1988, 21. | |
Federhofer 1978, 68. | |
Ebd., 63. | |
Ebd. | |
Ebd., 67. | |
Salzer 1927, 114. | |
»Er hat die klassische Tonalität nicht über Bord geworfen. Eine Krise gibt es in Schuberts Harmonik nicht.« (Federhofer 1978, 68) | |
Ebd. | |
Hinrichsen 1988, 20. | |
Vgl. insbesondere Költzsch 1927. | |
Hinrichsen 1994, 114. | |
Ebd. | |
Halm 1920, 81ff. | |
Mozarts Disposition macht nur auf die Möglichkeit des ›double emploi‹ der V. Stufe aufmerksam, die sowohl als Ultima-Klang der Halbkadenz in der Funktion der ›Unterbrechung‹ (Heinrich Schenker) auftreten kann, als auch die Peripetie zur Tonart der Quinte zu bilden vermag. (Dieses Verfahren ist von Winter (1989) als ›Bifocal Close‹ beschrieben worden.) Mozart kombiniert beide Möglichkeiten: Der zweite zur Nebentonart führende Quintabsatz (T. 37) wird ›erstickt‹ (Heinrich Christoph Koch), Beethoven hingegen lässt es in op. 31,1 bei der ersten Möglichkeit bewenden und schlägt die zweite durch den Gang nach h-Moll demonstrativ aus. | |
Hiervon wäre allenfalls das Phänomen der Zwischendominante auszunehmen. Allerdings wird die Erörterung der Analyse des Klaviertrios B-Dur D 898 weiter unten im Haupttext zeigen, dass diese Differenzierungsmöglichkeit bei Hinrichsen ungenutzt bleibt. | |
Hinrichsen 1988, 49. | |
Ebd. | |
Hinrichsen 1994, 356. | |
Hinrichsen 1997, 501f. | |
Ebd., 502. | |
Hinrichsen 1994, 357. | |
Ebd. | |
Hinrichsen 1988, 40. | |
Hinrichsen 1994, 447ff. | |
Hinrichsen 1997, 501. | |
Ebd., 357f. | |
Hinrichsen 1988, 31. | |
Dieser Hinweis auch bei Hinrichsen (ebd., 30). | |
Hinrichsen (ebd., 31) unterstellt, dass die thematische Wiederkehr des Hauptgedankens ein hinreichendes Kriterium für die Annahme einer Reprise in T. 187 ist, auch wenn die tonartlichen Verhältnisse des Ausgangs noch nicht wieder hergestellt sind. | |
In KV 551,i erfolgt kein entsprechender Schnitt, da die Reformulierung der Überleitung ihren Ausgang von der Mollvariante des Hauptthemas nehmen soll. | |
Leichentritt 21920, 162 | |
Neuwirth 2009. | |
Vgl. dazu weiter unten im Haupttext. | |
Vgl. zur Frage des Repriseneintritts auch Sly 2001, 149f., Anm 16. | |
Vgl. dazu die Einschätzung Hinrichsens: »Der vorliegende Satz [D 898,i] zeigt […] eine spezifische Art des Entwicklungsdenkens, die freilich nicht die der motivischen Arbeit ist, dafür aber die Grundlagen der harmonischen Struktur der Gesamtform in ihren Bereich hineinzieht.« (1988, 32) | |
Es wird im vorliegenden Beitrag nicht von einem ›Systemwechsel‹ gesprochen. Vielmehr wird in Anlehnung an die Systemtheorie Niklas Luhmanns unter ›System‹ allein das funktionale System mit Namen ›Tonalität‹ verstanden. Ihm sind ›Ursatz-Tonalität‹ und ›Tonalität der Tonfelder‹ als unterschiedliche ›Programme‹ zugeordnet. Programme leiten die Beobachtungen im System und erlauben dadurch dessen Selbstregulierung und Selbstkontrolle (vgl. Luhmann, 1992, 401ff.). Nur unter Voraussetzung dieser terminologischen Differenzierung können (weiter unten im Haupttext) unter dem Stichwort ›Anschlussfähigkeit‹ diejenigen Verfahren diskutiert werden, die den Wechsel zwischen beiden Programmen ermöglichen. ›Anschlussfähigkeit‹ eröffnet die Möglichkeit zur ›Anschlusskommunikation‹, die, wie jede Form der Kommunikation, eine Operation innerhalb eines (sozialen) Systems – hier des Kunstsystems – ist und auf dessen Erhalt zielt. Kommunikation über Systemgrenzen hinweg ist aufgrund der ›System/Umwelt-Differenz‹ nicht möglich. Offen bleiben kann in diesem Zusammenhang, ob ›funktionales System‹ und ›Tonalität‹ gleichbedeutend sind. Denn unklar scheint zum gegenwärtigen Stand der Forschung, ob – historisch betrachtet – vor dem Entstehen der Tonalität nur ein anderes funktionales Programm maßgeblich, oder aber das System selbst (noch) kein funktionales war. | |
Hinrichsen 1994, 357. | |
Die Quellenlage zur Musiktheorie Albert Simons ist prekär. Eine schriftliche Niederlegung seines Ansatzes scheint diversen Zeitzeugen nach zwar existent, ist aber bislang unveröffentlicht geblieben. Seinen Ansatz referiert und um eigene Analysen ergänzt hat Bernhard Haas, der über mehrere Jahre hinweg Privatschüler Simons war, in Die neue Tonalität (2004). Auf dessen Ausführungen stützen sich wiederum die Darlegungen von Michael Polth in seiner Rezension von Haas’ Buch (2006a). | |
Der entsprechende Zirkel, der F- und As-Stufe enthält, lautet ›fallend‹: f-F-d-D-h-H-gis-Gis(=As). | |
Dass die Töne als Skala geordnet den 2. Modus nach Messiaen ergeben, zeigt, dass Simon Phänomene ordnet, die auch andernorts Anlass zur Bildung musiktheoretischer Systeme waren. Dies gilt auch für seine Nähe zu Theoremen anderer Musiktheoretiker ungarischer Herkunft wie Ernö Lendvai (1971) und Zsolt Gardonyi (2002) (vgl. auch Polth 2006a, 169, Anm. 1–3). Darüber hinaus gibt es Ähnlichkeiten zur Neo-Riemannian Theory. Aus deren Sicht handelt es sich bei den Operationen, die das Feld der ›Funktion‹ hervorbringen, um die alternierende Folge von ›R‹-Operationen (Wendung zur ›Parallelstufe‹) und ›P‹-Operationen (Wendung zur ›Variantstufe‹) (vgl. Cohn 1996). | |
Die Möglichkeit, dass Töne eines Tonfeldes durch andere Klangbildungen abgegriffen werden können als solche, die durch die Dur-Moll-Tonalität vertraut sind, bietet eine Erklärungsmöglichkeit dafür, wie sich der Übergang von der so genannten romantischen zur so genannten atonalen Harmonik vollzogen haben könnte: als Wechsel der satztechnischen Einrichtung, nicht als Wechsel des funktionalen Programms, geschweige denn als Wechsel des Systems. | |
Die Bildung ›funktionaler‹ Achsen geschieht in der Theorie Simons analog zu derjenigen Lendvais und unterscheidet sich dementsprechend von der durch Segmentierung des Riemannschen ›Tonnetzes‹ gewonnenen in der Neo-Riemannian Theory: So gehen bei Richard Cohn unterschiedliche funktionale ›regions‹ und ›Hexatonic Systems‹ miteinander einher (bei Simon firmieren diese Tonfelder als ›Konstrukte‹; vgl. im Haupttext S. 299): »The notion of ›region‹ suggested here generalizes Riemann’s harmonic functions in the spirit of Erno Lendvai’s ›axis tonality,‹ but along different lines. Lendvai focuses on the functional equivalence of pitch-classes re-lated by minor third, whereas the regions […] suggest functional equivalence between harmonies whose roots are related by major third.« (Cohn 1999, 219, Anm. 20) Bei Cohn firmieren die von Simon als ›Konstrukte‹ bezeichneten Tonfelder als ›Hexatonic Systems‹. Mit Blick auf Schuberts D 960,i klassifiziert Cohn (1996, 219) das Konstrukt IIb als ›Tonic‹, das Konstrukt Ia als ›Dominant‹ und das Konstrukt Ib als ›Subdominant‹. Entsprechend könnte auch in D 898,i verfahren werden, das in derselben Grundtonart steht. Freilich wirft bereits der Umstand, dass Cohn keine Entsprechung zum Konstrukt IIa geben kann – eine vierte ›Funktion‹ wird nicht zugeordnet –, die Frage nach der Konsistenz seiner Systematik auf. | |
Vgl. dazu auch die Darstellungen bei Haas (2004, 11–19) und Polth (2006a, 171f.). | |
Vgl. Polth 2000a, 105f. | |
Damit sind nicht Transformationen im engeren Sinne der ›transformational theory‹ gemeint: »[The transformational] attitude does not ask for some observed measure of extension between reified ›points‹; rather it asks: ›If I am at s and wish to get to t, what characteristic gesture should I perform in order to arrive there?‹« (Lewin 1987, 159) | |
Hepokoski/Darcy sprechen von ›merged‹- bzw. ›non-merged transitions‹ (2006, 95). | |
Damit soll nicht gesagt sein, Haydn enttäusche etwaige Erwartungshaltungen. Es scheint sich angesichts der Häufigkeit dieser formalen Strategie vielmehr um einen Typ eigenen Rechts zu handeln. | |
Vgl. Salzer: »Eigentümlich ist jedenfalls die Art der Modulation, die schon in der ersten Gruppe des Nachsatzes die F-dur-Tonart erreicht, aber durch ihre Wendung zur A-Stufe gezeigt hat, daß Schubert erst in der Terzrückung die eigentliche Überleitung zum Seitensatz gehört haben wollte.« (1927, 115) | |
Insofern wird der Aussage Federhofers, der die Kritik Salzers an Schuberts Formgestaltung aufgreift, ohne deren Wertung zu übernehmen, widersprochen, der zufolge »[v]om Standpunkt der klassischer Formgestaltung […] die breite Auskomponierung der ›D‹-Stufe am Ende des Vordersatzes ebenso entbehrlich [ist] wie jene der ›A‹-Stufe am Ende des Nachsatzes«. (1978, 67) | |
IV in B wird durch 5-6-#6 zum übermäßigen Quintsextakkord, dem charakteristischen Akkord der sechsten Bassstufe in (g-)Moll. | |
Vgl. KV 547a,i. | |
In klassischen Sonatensätzen in Dur tritt an der Nahtstelle von Durchführungsende und Reprisenbeginn anstelle der Verbindung V-I mitunter die Verbindung III#-I. Gleichwohl verdankt sich deren funktionale Neubewertung durch Schubert nicht schlicht der Verlagerung in den Expositionsablauf. In Sätzen in Moll ist es bereits ab den 1740er Jahren auch innerhalb der Exposition ein gängiges Verfahren, auf den Quintabsatz in der Ausgangstonart unmittelbar den Eintritt der Nebentonart folgen zu lassen (vgl. dazu Neuwirth 2009). | |
Von daher erklärt sich auch, warum Schubert die entsprechende Transposition der Quintanstiegssequenz von der B-Stufe in die D-Stufe in der Reprise übernimmt und auf die aus der Exposition bekannte erste Präsentation des Hauptsatzes mit anschließender Wendung zur D-Stufe verzichtet. | |
Die Vorform dieses Verfahrens begegnet in der Frühklassik zumeist als Moll-Episode (Monn, Wagenseil etc.). Polth spricht von »Kontrastteile[n] in älteren Expositionen (2000a, 274ff.). Am Beispiel KV 465,i wird eine veränderte Bedeutung entsprechender Taktgruppen in jüngeren Expositionen deutlich: Der periodisch organisierte Formteil, der an den Grundabsatz in der Nebentonart anschließt (T. 72 mit Auftakt) ist keine ins Moll ›getauchte‹ untergeordnete Episode, sondern ein vollgültiger Seitensatz, der sich weder in seinem formalen Bau – Periode mit 5. Ton als lokalem Kopfton und Unterbrechung (T. 75) – noch durch seinen Folgekontext – Schlussgruppe mit essentieller Kadenz (T. 91) – von solchen Seitensätzen unterscheidet, denen ein Quintabsatz in der Nebentonart vorausgeht. | |
Webster 1978, 24 und 26. | |
Hinrichsen 1988, 29. | |
Damit ist nicht diejenige Unterscheidung zwischen V. Stufe und ›Dominante‹ gemeint, für die Michael Polth plädiert hat: »Die Funktion ›Dominante‹ soll in einem engen Sinne verstanden werden, der sich vom Gebrauch in der V. Stufe in der Kadenz ableitet.« (2000a, 90) Von der ›Dominante‹ scheidet Polth eine »harmonische V. Stufe«: »›Harmonisch‹ besagt, daß die Terz nicht mehr als Leitton empfunden wird, sondern in der Verbindung der Akkordtöne aufgeht.« (Ebd., 92) Für die III# als Dominante hingegen scheint essentiell, dass die Terz als Leitton empfunden wird, auch wenn es sich bei ihr gar nicht um den Leitton der nachfolgenden Tonika handelt. Die Differenz der gemachten Unterscheidungen ergibt sich daraus, dass Polths Bestimmung nicht mit Blick auf einen Programmwechsel innerhalb des tonalen Systems erfolgt, sondern allein mit Blick auf das Programm der ›Ursatz-Tonalität‹. | |
In den folgenden Strukturskizzen nach Schenker wird aus Gründen der vereinfachten Darstellung ein Lagenausgleich vorgenommen. | |
Gjerdingen 1988. | |
Vgl. Schmalfeldt 1991. | |
Die vorliegende Deutung stimmt damit in Grundzügen mit derjenigen von Gordon Sly (2001, 127) überein. Freilich geht Sly von einem regulären Anstieg aus, d.h. die 1-7-4-3-Struktur (nach Gjerdingen) findet in seiner Lesart keine gesonderte Berücksichtigung. In der Interpretation Salzers (1960, Fig. 389) wird f2 hingegen als Kopfton gelesen. Daraus resultieren Schwierigkeiten für die Deutung des im Vordergrund analogen g2 (T. 7), da die für Kompositionen mit der Quinte als Kopfton charakteristische Auskomponierung der oberen Wechselnote zum Kopfton unabgeschlossen erscheint. | |
Der Ton wird im Folgetakt in der Begleitstimme tiefergelegt und dort aufgelöst. Sly (2001, 127) deutet c (T. 30ff.) als Nebennote zu b (T. 34). Folglich markiert der Ton f (T. 37) nicht das Ende eines Quint-, sondern eines von a ausgehenden Terzzuges, der sich der Wechselnotenbewegung b-c-b anschließt. Fraglos erscheint in dieser Deutung das ›Moment des Abbruchs‹ gemildert, zumal d nicht durch es gefordert erscheint. | |
Vgl. die paradigmatische Deutung des mediantischen Reprisenübergangs in Beethovens op. 24,i durch Schachter (1987, 298, Ex. 8). Dazu auch Neuwirth 2009. | |
Schenkers eigene (frühe) Deutung im Kontext seiner Harmonielehre als Form des ›Trugschlusses‹ trifft sich mit dieser Einschätzung freilich nicht (1906, 353). Vgl. dazu auch Neuwirth 2009. | |
Dieses Verfahren findet sich z.B. in KV 333,i T. 50–59. | |
Schachter 1983, 62f. | |
Der übermäßige Quintsexakkord ist hier durch den übermäßigen Terzquartakkord ersetzt. | |
Zugleich scheint hiermit ein Untergreifzug a-h-c (T. 49–93 bzw. 100) ›effiziert‹. Der Begriff ›effiziert‹ ist von Bernhard Haas in die Diskussion eingeführt worden. ›Effiziert‹ ist eine Bewegung dann, wenn die Töne, aus denen sie gebildet ist, zwar verschiedenen strukturellen Schichten angehören, dennoch aber durch den Rekurs auf ein gängiges Muster, beispielsweise einen Zug, aneinander gebunden scheinen. | |
Beach 1993 und 1994; Sly 1994 und 2001. Sly spricht von »the misalignment that exist between the voice-leading structure and the tonal-thematic design« (2001, 121). | |
Die Möglichkeit, dass analoge tonale Strukturen eine unterschiedliche Zuordnung im Formgeschehen erhalten und umgekehrt analoge Formerscheinungen unterschiedlich in der tonalen Struktur verankert sind, ist eine wesentliche Voraussetzung der Schichtenlehre. Im Freien Satz spricht Schenker nur von der »streng logischen Bestimmtheit im Zusammenhang einfacher Tonfolgen mit komplizierten«. (1956, 49) Inwieweit dies Kongruenz einschließt, scheint offen. Gleichwohl hat Charles J. Smith (1996), der in einer umfänglichen Reformulierung der Schenkerschen ›Formenlehre‹ versucht hat, alle relevanten Formmomente in der ›tiefsten‹ Schicht zu verankern, darauf hingewiesen, dass Schenker in der Zuordnung von ›innerer› und ›äußerer‹ Form nicht immer konsequent verfährt (vgl. auch Schwab-Felisch 2005, 365f.). | |
Wohl nicht zufällig brechen Schachters Analysen zu Brahms’ op. 73,i (1983, 64) und Schuberts D 944,i (ebd., 66) noch vor Abschluss der jeweiligen Expositionen ab und lassen insofern offen, ob und gegebenenfalls in welcher Funktion ein Quintzug in die Confinalis der Nebentonart noch erfolgt. | |
Eine pointierte Definition findet sich bei Sly: »Sonata form arises from two-part fundamental structure, and the sole requirements of development and recapitulation sections are those that serve this structural division: the impulse toward closere is interrupted following the arrival or prolongation of 2 ans dominant harmony; a recommencement of that motion ensues, this time carrying to closure. It is the recovery of the primary tone an the tonic scale step at the point of recommencement – rather than the reappearance of principal thematic material – that for Schenker defines the onset of the recapitulation.« (2001, 147, Anm. 7) | |
Anders als in der vorliegenden Untersuchung liegt der Fokus von Beiträgen der Schenkerian Analysis zumeist auf Schuberts irregulärer Repriseneinrichtung und deren Bedeutung für Schenkers Paradigma, die klassische Sonatenform basiere auf einer Unterbrechung. Selbst aber den umfangreichen Graphen Slys (2001, 127–132) ist letztlich nicht mit definitiver Bestimmtheit zu entnehmen, ob von einer Unterbrechung mit Beginn der Durchführung (T. 112), mit Beginn der Submediant-Reprise (T. 187) mit dem Ton des als chromatischer Antizipation des Kopftons d, einer Unterbrechung bei Wiederkehr des d (T. 211ff.), oder sogar von zwei Unterbrechungen – am Beginn der Durchführung und mit Wiederkehr des d (vgl. hierzu Adrian 1990) – ausgegangen wird. | |
Zu dieser Problematik ausführlich Schwab-Felisch (2005, 354–357). | |
Vgl. Polth 2000b, 182ff. | |
Diese Einschätzung der Vorgänge ist selbstverständlich nur möglich, wenn – anders als bei Webster (1978, 25) und Sly (2001, 125 und 149, Anm. 15) – nicht davon ausgegangen wird, der 2. Ton der Urlinie werde bereits mit dem ersten Grundabsatz in der Nebentonart manifest. In der vorliegenden Analyse wird die Figuration der Violine in Takt 37 als Ornament des Vordergrunds aufgefasst. | |
Komplementär hierzu verhält sich das Ergebnis der obigen Schenker-Analyse hinsichtlich der ›Fernkontexte‹, deren Verbindlichkeiten bei Vergrößerung des diskutierten Werkausschnittes zunehmend aufgekündigt erscheinen. | |
LaRue 1992, 61. | |
Neuwirth 2009. | |
Ebd. | |
Luhmann 1997, 84. | |
Ebd. | |
So lässt sich die Anmerkung von Bernhard Haas interpretieren, der zufolge »[i]n einem bestimmten Zeitraum […] beide Systeme [in Sinne der vorliegenden Untersuchung ›Programme‹] in jedem Werk in einer noch nicht erforschten Weise [zu] koexistieren« scheinen. (2004, 10, Anm. 2) Gleichwohl relativiert Haas seine eigene Begriffswahl, wenn er davon spricht, die Tonfelder würden »im einzelnen mit Mitteln der Stimmführung und des Stufenganges[…], also mit traditionellen (schenkerianischen) auskomponiert.« (Ebd., 70) Entsprechend geht Haas’ Analyse von Schuberts Ihr Bild (ebd., 70–81) zunächst von einer Deutung des Liedes im Lichte der späten Theorie Schenkers aus und ordnet im Anschluss die durch die Auskomponierungsverfahren einander zugehörigen Töne den Tonfelder Simons zu. (Auf diese Art kann beispielsweise ein Quintzug in Dur mit oberer Wechselnote 5-6-5-4-3-2-1 als Hexaton gelesen werden.) Das, was derartige ›Übersetzungsleistungen‹ viabel macht, wird bei Haas nur indirekt an seiner Analyse deutlich. Hier setzt die vorliegende Untersuchung an. | |
Vgl. die folgenden Ausführungen von Michael Polth: »Abgeschlossen war der Wandlungsprozeß [von der Ursatz-Tonalität zur Tonalität der Tonfelder] um 1850. Von da an existierte die Ursatz-Tonalität nicht mehr als Grundlage des tonalen Zusammenhangs. In dieser Hinsicht war sie abgelöst durch ein neues System des musikalischen Zusammenhangs. Wer Kompositionen nach 1850 – beispielsweise von Brahms – dennoch allein nach Schenker analysiert und glaubt, mit seiner Analyse die tonalen Sachverhalte angemessen zu treffen, täuscht sich demzufolge: Er verwechselt die Erscheinungen, die er an der Fassade des Kunstwerks noch finden kann (die Züge, Ausfaltungen usw.), mit den konstitutiven Grundlagen des musikalischen Zusammenhangs.« (Polth 2006b, 155) Die von Simon beschriebenen Effekte würden »nicht unmittelbar durch die Inanspruchnahme der traditionellen Satztechnik erzeugt« (ebd., 152). (In der Verwendung des Begriffs ›System‹ folgt Polth Haas 2004, vgl. die vorige Anmerkung; zur andersartigen Verwendung des Begriffs in der vorliegenden Untersuchung vgl. Anmerkung 42.) Freilich lässt Polth Raum für die in der vorliegenden Untersuchung entwickelte Position, wenn er anschließend erklärt, »die Ursatz-Tonalität« fungiere »als eine Art Vehikel […], das die neuen harmonischen Beziehungen transportiert« (2006b, 158). | |
Insofern der Hauptakzent der vorliegenden Untersuchung auf dem Moment der Anschlussfähigkeit liegt, wird der Frage, in welchem Maße die in der Theorie Simons unterstellten Felder nur eine pragmatische Anfangsunterscheidung bilden (im Sinne Luhmanns), einen Idealtyp mit geschichtlicher Substanz ausprägen (im Sinne Dahlhaus’) oder gar eine in den materialen Gegebenheiten des Tonsystems wurzelnde physikalische Sachhaltigkeit (im Sinne Lendvais) repräsentieren, nicht explizit nachgegangen. | |
Polth 2001, 31. | |
In der Theorie Simons werden neben den Termini ›Tonika‹ und ›Subdominante‹ beispielsweise auch die Bezeichnungen ›authentischer‹ und ›plagaler‹ Schritt beibehalten. | |
Das Bild des Würfels geht auf Bernhard Haas zurück. | |
»Im Konstrukt finden sich Töne, die traditionell sehr verschiedenen Sphären angehören, in engster Verbindung und gleichsam hermetisch gegen die anderen Töne abgeriegelt.« (Haas 2004, 31) | |
Um von einer Funktion oder einem Konstrukt reden zu können, bedarf es keiner Vollständigkeit. | |
Hierdurch kann auch die bisweilen auftretende Strukturanalogie zwischen Akkordformen und Akkordprogressionen, die von Hinrichsen beobachtet wird, gedeutet werden, nämlich als Analogie fraktal aufeinander bezogener Vorder- und Hintergrundphänomene identischer Tonfelder. | |
Haas 2004, 71. | |
Für die besondere Bedeutung dieser Töne spricht auch die (trotz ihres durchgängigen Charakters) enigmatische d-Moll-Stelle in Takt 157. Sie scheint in einem besonderen Verhältnis zu dem kurz darauf erscheinenden b-Moll-Wechselquartsextakkord zu stehen, durch den der Ton des abermals betont wird. | |
Ein entsprechender Ansatz findet sich bereits bei Seidl 1963. | |
Vgl. Schönberg 1922, 181. | |
Vgl. Haas 2004, 32. | |
Der Seitensatz der Exposition bildet mit seiner getreuen Transposition eine Analogie auf einer ›späteren‹ Schicht. | |
Das bestätigt die Einschätzung von Polth, dass »diese besonderen Effekte [im Sinne des Programms ›Tonalität der Tonfelder‹] nicht zwingend etwas mit der Herbeiführung von Schlüssen oder dem Abrunden von Formverläufen zu tun« haben. (2006b, 152) | |
Diese und die nachfolgenden Formbegriffe nach Caplin 1998. | |
Der Bezug erscheint auf rhythmischer Ebene durch die Synkopation, auf motivisch-thematischer Ebene durch den melodischen Umriss hergestellt. | |
Bereits im Vordersatz dient die durchgängige Ausweichung in die VI. Stufe weniger der Darstellung der Tonika als der des Konstruktes mit Hilfe der lokalen V. Stufe: Hier folgen nicht unähnlich der Konstellation der Takte 9–10 die Töne fis und ges in der Klavierbegleitung unmittelbar aufeinander (T. 246 bzw. 255). Im Zuge der ›weiblichen Endung‹ des Halbschlusses ergänzt die Abdunkelung von d zu des im Folgetakt den vorigen Durchgangsterzquartakkord a-c-d-fis zum vollständigen Konstrukt IIb im Vordergrund. | |
IIa erscheint in fünftöniger Form wie auch das mittelgründige IIb. | |
Zu dieser Überlegung passt, dass Schubert in der Coda nach Erreichen des Höhepunktes auf der As-Stufe zwar mit der bereits vom Ende des Hauptsatzes her bekannten Endigungsformel schließt (vgl. T. 10–13 und 309–311), am Ende des Satzes aber statt des alterierten Durchgangstons ges die diatonische Grundstufe g verwendet. Auch eine diskantisierende Wendung unter Rekurs auf das enharmonische Pedant fis fehlt hier im Unterschied zur Satzeröffnung: Das stabilisiert das Oktoton as–a. Diese Beobachtung widerspricht indirekt der Deutung Slys, derzufolge der Stufengang der Durchführung (T. 112–211) ein »expansive echo« (2001, 134) des Hauptsatzes (T. 1–12) ist. Denn es erhebt sich die Frage, warum Schubert den angeblich intendierten Zusammenhang zwischen Hauptsatz und Durchführung in der Coda nicht retrospektiv in Erinnerung ruft, sondern ges (und fis) durch g demonstrativ ersetzt. | |
Vgl. Haas 2004, 29. | |
Wird im Rahmen der Reprise Takt 234ff. wieder aufgegriffen. | |
Wird im Rahmen der Reprise Takt 270ff. wieder aufgegriffen. | |
Diskutabel wäre, ob die in dieser Übersicht den jeweiligen Funktionen zugeordneten Töne alle einer Schicht angehören. Im Vergleich zur Schenkerschen Schichtenlehre ist für die ›Tonalität der Tonfelder‹ derzeit noch nicht systematisch erschlossen, worin im Einzelnen die Auskomponierungsverfahren bestehen, die es ermöglichen, Schichten voneinander abzugrenzen. Bernhard Haas’ Analysen (2004) sind erste Versuche hierzu. Michael Polth (2007) hat eine Schichtenanlyse zu einem Werkausschnitt Bruckners vorgelegt, die offenkundig auf den Ansatz Simons und einige prinzipielle Überlegungen zur Schichtenanalyse bei Haas/Diederen (2008) rekurriert. |
Literatur
Adrian, Jack (1990), »The Tenary-Sonata-Form«, Journal of Music Theory 34/1, 57–80.
Beach, David (1993), »Schubert’s Experiments with Sonata Form: Formal-Tonal Design versus Underlying Structure«, Music Theory Spectrum 15/1, 1–18.
––– (1994), »Harmony and Linear Progression in Schubert’s Music«, Journal of Music Theory 38/1, 1–20.
Caplin, William E. (1998), Classical Form: A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart and Beethoven, Oxford und New York: Oxford University Press.
Cohn, Richard (1996), »Maximally Smooth Cycles, Hexatonic Systems, and the Analysis of Late-Romantic Triadic Progressions«, Music Analysis 15/1, 9–40.
––– (1999), »As Wonderful as Star Clusters: Instruments for Gazing at Tonality in Schubert«, 19th-Century Music, 22/3, 213–232.
Coren, David (1974), »Ambiguity in Schubert’s recapitulations«, Musical Quarterly 60, 568–582.
Federhofer, Hellmut (1978), »Terzverwandte Akkorde und ihre Funktion in der Harmonik Franz Schuberts«, in: Bericht vom Schubert Kongress Wien 1978, hg. von Otto Brusatti, Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 61–70.
Gjerdingen, Robert O. (1988), A Classic Turn of Phrase: Music and the Psychology of Convention, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Haas, Bernhard (2004), Die neue Tonalität von Schubert bis Webern. Hören und Analysieren nach Albert Simon, Wilhelmshaven: Heinrichshofen.
Haas, Bernhard / Veronica Diederen (2008), Die zweistimmigen Inventionen von Johann Sebastian Bach: Neue musikalische Theorien und Perspektiven, Hildesheim u.a.: Olms.
Halm, August (1920), Von zwei Kulturen der Musik, 2. Aufl., München: Georg Müller.
Hepokoski, James / Warren Darcy (2006), Elements of Sonata Theory. Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata, Oxford: Oxford University Press.
Hinrichsen, Hans-Joachim (1988), »Die Sonatenform im Spätwerk Franz Schuberts«, in: AfMW 45/1, 16–49.
––– (1994), Untersuchungen zur Entwicklung der Sonatenform in der Instrumentalmusik Franz Schuberts (= Veröffentlichungen des Internationalen Franz Schubert Instituts 11), Tutzing: Hans Schneider.
––– (1997), »›Bergendes Gehäuse‹ und ›Hang ins Unbegrenzte‹: Die Kammermusik«, in: Schubert Handbuch, hg. von Walther Dürr und Andreas Krause, Kassel u.a.: Bärenreiter/Metzler, 451–511.
Költzsch, Hans (1927), Franz Schubert in seinen Klaviersonaten, Leipzig: Breitkopf & Härtel.
LaRue, Jan (1992), »Bifocal Tonality in Haydn’s Symphonies«, in: Convention in Eighteenth- and Nineteenth-Century Music: Essays in Honor of Leonard G. Ratner, hg. von Wye J. Allanbrook, Janet M. Levy und William P. Mahrt, Stuyvesant und New York: Pendragon Press, 59–73.
Leichentritt, Hugo (1920), Musikalische Formenlehre, 2. Aufl., Leipzig: Breitkopf & Härtel.
Lewin, David (1987), Generalized Musical Intervals and Transformations, New Haven: Yale University Press.
Luhmann, Niklas (1987), Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
–––– (1992), Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
–––– (1997), Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Neuwirth, Markus (2009), »Der mediantische Reprisenübergang bei Joseph Haydn und einigen seiner Zeitgenossen zwischen Konvention und Normverstoß. Satztechnische Inszenierung, formale Implikationen und Erklärungsmodelle«, ZGMTH 2–3/2009, 231–271. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/454.aspx
Polth, Michael (2000a), Sinfonieexpositionen des 18. Jahrhunderts: Formbildung und Ästhetik, Kassel u.a.: Bärenreiter.
––– (2000b), »Analyse der Sonate KV 332, 1. Satz«, in: Gruhn Wilfried und Möller, Hartmut (Hg.), Wahrnehmung und Begriff: Dokumentation des Internationalen Symposiums Freiburg, 2.–3. Juni 2000 (= Hochschuldokumentationen zu Musikwissenschaft und Musikpädagogik, Musikhochschule Freiburg 7), Kassel: Bosse, 175–196.
––– (2001), »Nicht System – nicht Resultat«, Musik und Ästhetik 18, 12–36.
––– (2006a), »Tonalität der Tonfelder: Anmerkungen zu Bernhard Haas ›Die neue Tonalität von Schubert bis Webern. Hören und Analysieren nach Albert Simon‹«, ZGMTH 1/2006, 167–178. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/210.aspx
––– (2006b): »In den Freiräumen der Schenkerschen Tonalität: Harmonische Effekte durch Tonfelder in der Prager Sinfonie«, Dutch Journal of Music Theory 11/3, 151–163.
––– (2007), »Zum Verhältnis zwischen Satztechnik und musikalischem Zusammenhang: Bemerkungen zu einer Sequenz in Bruckners 6. Symphonie«, in: »Vom Erkennen des Erkannten«: musikalische Analyse und Editionsphilosophie, Festschrift für Christian Martin Schmidt, hg. von Thomas Ahrend, Heinz von Lösch und Frederike Wißmann, Wiesbaden u.a.: Breitkopf & Härtel, 335–344.
Rohringer, Stefan (Druck in Vorbereitung), »Schenker, Luhmann und das Problem der ›steigenden Urlinie‹«, in: Schenkerian Analysis – Analyse nach Heinrich Schenker: Bericht über den internationalen Schenker-Kongreß in Berlin, Sauen und Mannheim, 4.–12. Juni 2004, hg. von Oliver Schwab-Felisch, Michael Polth und Hartmut Fladt, Hildesheim u.a.: Olms.
Rothstein, William (1989), Phrase Rhythm in Tonal Music, New York: Macmillian.
Salzer, Felix (1927), »Die Sonatenform bei Franz Schubert«, Studien zur Musikwissenschaft 14, 86–125.
––– (1960), Strukturelles Hören: Der tonale Zusammenhang in der Musik, 2 Bd., Wilhelmshaven: Noetzel.
Schachter, Carl (1983), »The First Movement of Brahms’s Second Symphony: The Opening Theme and Its Consequences«, Music Analysis 2/1, 55–68.
––– (1987), »Analysis by Key: Another Look at Modulation«, Music Analysis 6/3, 289–318.
Schenker, Heinrich (1906), Harmonielehre (= Neue musikalische Theorien und Phantasien von einem Künstler 1), Stuttgart/Berlin: Cotta, Reprint Wien: Universal Edition, 1978.
––– (1956), Der freie Satz (= Neue musikalische Theorien und Phantasien, Bd. 3), hg. und bearbeitet von Oswald Jonas, 2. Aufl., Wien: Universal Edition.
Schmalfeldt, Janet (1991), »Towards a Reconciliation of Schenkerian Concepts with Traditional and Recent Theories of Form«, Music Analysis 10/3, 233–287.
Smith, Charles J. (1996), »Musical Form and Fundamental Structure: An Investigation of Schenker’s ›Formenlehre‹«, Music Analysis, 15/2–3, 191–297.
Schönberg, Arnold (1922), Harmonielehre, 3. Aufl., Wien: Universal Edition.
Schwab-Felisch, Oliver (2005), »Zur Schichtenlehre Heinrich Schenkers«, in: Musiktheorie (= Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft 2), hg. von Helga de la Motte-Haber und Oliver Schwab-Felisch, Laaber: Laaber, 337–376.
Seidl, Elmar (1963), Die Enharmonik in den harmonischen Großformen Franz Schuberts, Heidelberg: Grosch.
Sly, Gordon C. (1994), An emerging symbiosis of structure and design in the sonata practice of Franz Schubert, Diss. Uni. Rochester, Ann Arbor, Mich.: UMI.
––– (2001), »Schubert’s Innovations in Sonata Form: Compositional Logic an Structural Interpretation«, Journal of Music Theory 45/1, 119–150.
Webster, James (1978): »Schubert’s Sonata Forms and Brahm’s First Maturity«, 19th Century Music 2/1, 18–35 und 3/1, 52–71.
Winter, Robert S. (1989), »The Bifocal Close and the Evolution of the Viennese Classical Style«, Journal of the American Musicological Society 42/2, 275–337.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.