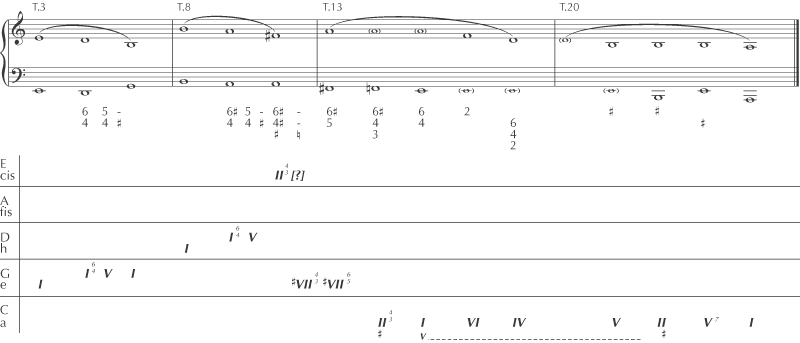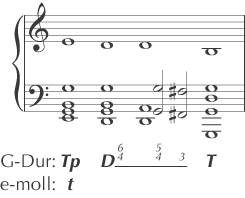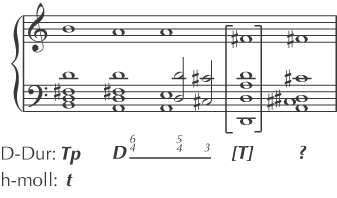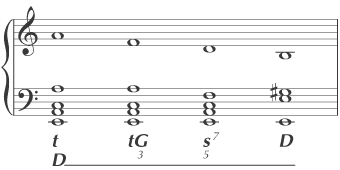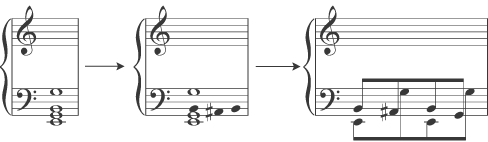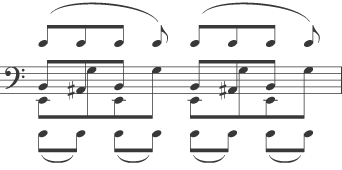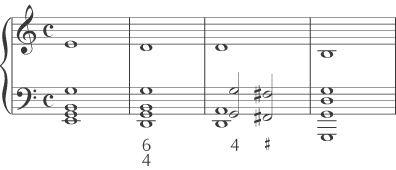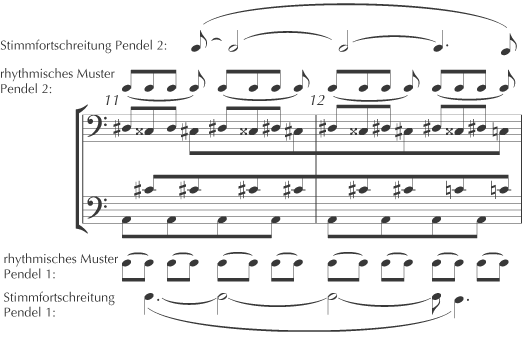Klang in Chopins Prélude op. 28, Nr. 2
Johannes Quint
Viele Komponisten des 20. Jahrhunderts, besonders die der ›New York School‹, stellen den Augenblick, die Magie des ›reinen‹ Klangs ins Zentrum ihrer Poetik. Vorläufer dieses Denkens finden sich – wenn auch unter anderen Voraussetzungen – schon in der Musik der Romantik. Chopins Prélude op. 28, Nr. 2 war schon oft Gegenstand satztechnischer Analysen. Dabei ging es entweder um die Form oder um das zugrundeliegende harmonische Gerüst oder um den ›Algorithmus‹ der Figuration. Das Besondere des Préludes wird aber erst erfahrbar, wenn man Schritt für Schritt beobachtet, wie die unterschiedlichen Parameter aufeinanderprallen: Ohne daß an irgendeiner Stelle traditionelle Stimmführung mißachtet würde, wird die Syntax der Tonalität aus den Angeln gehoben und die klangliche Magie der Dissonanz tritt in den Vordergrund.
»One of the problems about functional harmony is that it hears for us, see. We no longer have to hear.«[1]
Worauf Morton Feldman hier anspielt, ist die Besonderheit tonaler Musik, in oft ganz präzisem Sinne vorhersehbar zu sein. Diese Vorhersehbarkeit erst erlaubt es, von tonaler Syntax zu sprechen. Man pendelt beim Hören ständig zwischen Zukunft und Vergangenheit: Man erwartet einerseits Auflösungen von Dissonanzen, Fortsetzungen von Sequenz- oder Kadenzmodellen, andererseits hört man rückwirkend ›Trugschlüsse‹ und deutet Akkorde ›um‹ etc.
Ein »Problem«nun stellt all das für Feldman deshalb dar, weil dabei die magische Präsenz und Gegenwärtigkeit des Klangs als blinder Fleck aus dem Gesichtsfeld des Hörers zu fallen droht.
Feldmans Kritik ist natürlich polemisch. Die Tendenz der tonalen Musik, mehr ›zukünftig‹ (und eben auch ›vergangen‹) als ›gegenwärtig‹ zu sein, ist nicht von der Hand zu weisen. Andererseits lassen sich tonale Kompositionen nicht auf diesen Aspekt allein reduzieren. Man könnte es dabei bewenden lassen: Schließlich ist Feldmans Bemerkung in erster Linie eine Umschreibung seiner eigenen Poetik, bzw. der der ›New York School‹, und es geht hier nicht um die Musik des 20. Jahrhunderts. Doch ein ausgeprägtes Bewußtsein für den Preis, den man für eine bestimmte musikalische Syntax zu zahlen hat (ein Bewußtsein, das für Feldmans und Cages Poetik zentral ist), findet sich durchaus auch, und zwar in unterschiedlichster Ausformung, in der musikalischen Romantik. Sowohl in Hinsicht auf die großformale Anlage als auch auf einzelne musikalische Details lassen viele romantische Kompositionen eine Aversion gegenüber jener Vorhersehbarkeit erkennen, die die Rückseite der tonalen Musiksprache ist.
Offensichtlich wird das im Wandel, den die Kategorie ›Klang‹ im 19. Jahrhundert durchmacht: Klang im Sinne von ›Klangfarbe‹ ist eine jener musikalischen Ebenen, auf denen sich die bahnbrechenden Neuerungen der romantischen Musik vor allem vollziehen. Doch wird ›Klang‹ in der Romantik in einem durchaus umfassenderen Sinn zum Thema.
Es ist besonders faszinierend, dem Verhältnis von Syntax und Klang anhand der Musik Frédéric Chopins nachzugehen. Chopins Werke weisen zum einen eine für ihre Zeit einzigartige satztechnische Komplexität auf, zum anderen ist diese Komplexität nie vom Klang des Klaviers abstrahierbar: Die vergeblichen Versuche, Chopins Musik zu instrumentieren, weisen darauf hin.
Chopins Musik kennt Momente, die eine unvergleichliche Empfindlichkeit für feine Differenzierungen zeigen, andererseits solche, in denen die Musik all diese Differenzierungen hinter sich läßt und sich wie im Rausch dem Klang hingibt. Die folgenden Beispiele aus den Mazurken zeigen die beiden extremen Pole – klangliche Differenziertheit und klangliche Extase – quasi ›isoliert‹. Daß Chopin auch in der Lage ist, beide Pole miteinander in Kontakt zu bringen, soll später gezeigt werden.
Beispiel 1: Chopin, Mazurka op. 63, Nr. 1
Über Chopins Polyphonie ist viel geschrieben worden. Das Besondere ist daran sicher nicht, daß es bei ihm (neben vielen impliziten) auch immer wieder explizite Verweise auf kontrapunktische Techniken gibt. Nichts ist engstirniger, als der – Reger zugeschriebene – Ausspruch: »100 Fugen muß einer komponiert haben, dann kann er etwas.«[2] Wer so denkt, verwechselt Handwerk mit Poetik, kombinatorische mit ästhetischer Komplexität. In Chopins Mazurka frappiert denn auch weniger der Oktavkanon für sich, als vielmehr, wie Chopin die Polyphonie in die Sphäre einer Mazurka hineinholt. Genau diese Anverwandlung kontrapunktischen Denkens meint Charles Rosen, wenn er schreibt:
»Above all, Chopin was the greatest master of counterpoint since Mozart. This will appear paradoxical only if we equate counterpoint with strict fugue ... It is the facility of Chopin’s voice leading or part-writing which is dazzling.«[3]
Das Beispiel wurde gewählt, da die Differenziertheit der Satztechnik innerhalb eines Tanzsatzes besonders bemerkenswert ist. Es finden sich natürlich unendlich viele Stellen bei Chopin, die eine noch komplexere, weil versteckte Detailarbeit beinhalten, deren Analyse aber den hier gesetzten Rahmen sprengen würde. Das nächste Beispiel ist nun dem ersten geradezu diametral entgegengesetzt.
Beispiel 2: Chopin, Mazurka op. 33, Nr. 2
Auch an einer Stelle wie dieser wird natürlich die ›functional harmony‹ nicht völlig ausgeblendet. Trotzdem überträgt sich vor alle die Wirkung eines magischen Strudels, in den der Hörer durch die beschwörende Wiederholung des Diskant-d'' gezogen wird, ein Klang-Strudel, der die Vergangenheit vergessen und die Antizipation der Zukunft in den Hintergrund treten läßt.
»Die Praeludien bezeichnete ich als merkwürdig, [...] es sind Skizzen, Etudenanfänge oder will man, Ruinen, einzelne Adlerfittiche, alles bunt und wild durcheinander.«[4]
Es ist bemerkenswert, daß sich gerade der ›literarische‹ Schumann über die Form der Préludes wunderte. Chopins Sammlung besteht aus Fragmenten – vielleicht die ersten im Bereich der ›absoluten Musik‹ – und greift damit die zentrale poetische Form der Frühromantik musikalisch auf. In bezug auf den Begriff ›Fragment‹ ist allein schon bezeichnend, daß Chopin mit offensichtlichem Verweis auf Bachs Wohltemperiertes Klavier eine Sammlung komponiert, die ausschließlich aus »Praeludien« besteht.[5]
Doch das Fragmentarische zeigt sich nicht nur äußerlich. Die Standardisierung der Tonartenpläne im 18. Jahrhundert war spätestens um die Jahrhundertwende zu einem Stereotyp geworden, und während Beethoven versuchte, die alten I-V-I-Verläufe durch Alternativen zu ersetzen und dabei das ›dialektische‹ System der Reprisentonalität aufrechtzuerhalten, finden sich bei Schubert, Schumann und eben auch bei Chopin Verfahren, diesem ›systematischen‹ Ansatz etwas prinzipiell Anderes entgegenzusetzen. Chopin experimentiert mit verschiedenen Konzepten: Schnelles Durchlaufen entfernter Tonarten (Prélude Nr. 9), Verzicht auf eine ›Gegentonart‹ zur Ausgangstonart (Prélude Nr. 1) oder Chromatisierungen, die die tonale Orientierung stören (Prélude Nr. 4). All diese Verfahren führen zu einer Schwächung der synthetisierenden Wirkung des Tonartenverlaufs, eine Wirkung, auf die die Komponisten der Klassik nicht verzichten wollten. Auch die Disposition der Tonarten wird dabei tendenziell fragmentarisch.
Besonders interessant ist in dieser Hinsicht das zweite Stück des Prélude-Zyklus. Über den besonderen Tonartenverlauf in Chopins op. 28, Nr. 2 wurde schon viel nachgedacht. Das Prélude ist eines der wenigen Beispiele tonaler Instrumentalmusik, die auf den Bogen Ausgangstonart = Zieltonart verzichten, und somit den konventionellen Tonartenverlauf fragmentieren. Auf Melodiephrasen und Harmonieverlauf reduziert ergibt sich für das Prélude das folgende Bild:
Beispiel 3: Chopin, Prélude op. 28, Nr. 2, harmonisches Gerüst
Wie man sieht, beginnt das Prélude in e-Moll/G-Dur, wendet sich sequenzartig nach h-Moll/D-Dur, um am Ende der zweiten Phrase auf einen Akkord zu führen, der den Kontext von cis-Moll andeutet. Diese Stelle – T. 11f. – ist in mehrfacher Hinsicht zentral für das Prélude und wir werden darauf noch mehrfach zurückkommen. Im Zusammenhang mit der Tonartenanlage ist hier erst einmal bemerkenswert, daß die Phrasengliederung der Melodie und der Wechsel der Tonarten asynchron laufen: Noch in der zweiten Phrase wird der halbverminderte Septakkord alteriert und so in den Tonartenbereich von e-Moll geführt, das über die Phrasengrenze hinweg Bezugstonart bleibt.
Danach erst (T. 14) senkt sich die Musik – erstmalig – in den Raum der Zieltonart a-Moll, den sie dann bis zum Schluß nicht mehr verläßt.
Asynchronizitäten verschiedener Parameter erzeugen Ambivalenzen und stören die Orientierung – dies geschieht hier durch die Verschiebung der Phrasengliederung der Melodie gegen die Tonartenabfolge. Zusammen mit deren Asymmetrie (Ausgangstonart ≠ Zieltonart) führt das dazu, daß der Tonartenverlauf lange Zeit unvorhersehbar und damit die Verräumlichung des tonalen Prozesses problematisch bleibt.
In einem ersten Überblick hat sich gezeigt, daß schon auf der Ebene der Tonartendisposition – sozusagen aus der Vogelperspektive des musikalischen Hörens – Kräfte wirksam sind, die der Vorhersehbarkeit der Musik entgegenarbeiten. Damit ist allerdings die Frage nach der Aufgabe, die dabei der Kategorie ›Klang‹ zukommt, noch nicht berührt. Um sie zu beantworten, müssen wir erst die ›lokale‹ Ebene der Tonalität, die tonale Syntax betrachten. Hier vollzieht sich ja im engeren Sinne das, worauf Feldman mit seinem »We no longer have to hear« abzielt. In einem ersten Schritt wollen wir daher die Satzmodelle, aus denen das Prélude besteht, unterscheiden. Folgende Gliederung bietet sich an:
Beispiel 4: Kadenz in G-Dur, T. 1–7 (zu den Oktavparallelen s.u.)
Beispiel 5: Kadenz in D-Dur mit trugschlüssiger Wendung, T. 8–12
Der letzte Klang ist der erste Akkord des Prélude, der sich nicht in eindeutige Satzmodelle einfügt. Als (unkonventioneller) Trugschluß verlangt er eine Fortsetzung, da er aber die Kadenztonart verläßt, entsteht eine Irritation. Denkbar wäre (a) die Fortsetzung mit einer Kadenz in cis-Moll: der Akkord würde zu einer ›sixte-ajoutée‹-Funktion, oder (b) die Fortsetzung in einer Sequenz.
Beispiel 6: Mögliche Fortsetzungen des halbverminderten Septakkordes (T. 11)
Doch Chopin wählt einen anderen Weg:
Beispiel 7: (Ton-für-Ton-) Alterationskette, Überleitung zur Zieltonart a-Moll, T. 12–14
Konsequenterweise findet sich hier ein satztechnisches Verfahren, das durch seine Unvorhersehbarkeit gekennzeichnet ist. Während ›Kadenz‹ und ›Sequenz‹ ›standardisierte‹ Progressionen sind, bezeichnet das Prinzip der »Alterationskette« lediglich einen übergeordneten Progressionsmodus, ohne dabei im Detail festzulegen, welche Stimme sich wie fortzubewegen hat.[6] Dadurch wird die Orientierungslosigkeit, die durch den Eintritt des Trugschlusses entsteht, in beträchtlicher Weise verlängert. Erst mit Eintritt des übermäßigen Terzquartakkordes in T. 14 wird in den neuen tonalen Kontext (a-Moll) übergeleitet und eine Kadenz antizipiert.
Beispiel 8: Orgelpunktgruppe auf der V. von a-Moll, T. 15–22
Beispiel 9: Kadenz in a-Moll, T. 22f.
Auch hier – aus der Perspektive der Satzmodelle – zeigt sich also die zentrale Position der Takte 11/12: Zum einen findet sich wieder eine Asynchronizität zu den Phraseneinschnitten der Melodie (zusammen mit der Tonartenfolge überlagern sich damit drei Ebenen asynchron). Noch wichtiger aber sind vielleicht der Einsatz des Trugschlusses und seine Fortführung durch das Alterationsmodell: die Erzeugung einer tiefgreifenden Irritation des tonalen Hörens.
Die Formulierung »We no longer have to hear« ist – soviel läßt sich hier schon sagen – eine allzu starke These: Die tonale Syntax funktioniert natürlich keineswegs so, daß in jedem Augenblick der ›Möglichkeitsraum‹ gleich eng ist. Im Gegenteil: Irritation und Desorientierung gehören zum Wesen der Tonalität. Wir werden bald sehen, daß in unseremBeispiel diese Wirkungen zusätzlich auf der Ebene des Klangs auskomponiert werden.
Sowohl Tonartenplan als auch Syntax sind abstrakte Beschreibungsmodelle. All das, was in den vorherigen Abschnitten aufgezeigt wurde, könnte sich auch in einem Werk mit einer ganz anderen Oberfläche finden. Das Besondere von Chopins Prélude tritt daher erst dann zu Tage, wenn man tiefer in die Klangkomposition mit ihrem spezifischen ›Algorithmus‹ der Figuration eindringt. Es wird sich zeigen, daß die funktional-zentrale Position der Takte 11/12 durch eine Klangerscheinung verwirklicht wird, die gerade die Wahrnehmung eben dieses funktionalen Kontextes (sowohl in Hinsicht auf den Tonartenverlauf als auch auf die Syntax) in den Hintergrund drängt.
Zunächst sei der ›rein‹ klangliche Charakter des Prélude betrachtet. Läßt man die Figuration beiseite, so stechen zwei auffällige Klangkomponenten hervor: Die Lage der Begleitfigur (die ›Registrierung‹) und die reale ›Harmonisierung‹ durch die Stimmverdopplungen. Vergleichen wir die harmonische Reduktion der Anfänge der ersten drei Préludes:
Beispiel 10: Klangaufbau in den Préludes op. 28, Nr. 1, 2 und 3
Während erstes und drittes Prélude für die tiefen Akkordtöne die transparente weite Lage wählt, ist der e-Moll-Dreiklang des zweiten in einer akustisch ›ungünstigen‹, engen Registrierung auskomponiert. Es ergibt sich ein Klang, der zur Undurchhörbarkeit und zum Geräuschhaften hin tendiert.
Das Besondere ist hier die Verdopplung der Terz, die den e-Moll-Dreiklang klanglich individualisiert: Durch den relativ großen Abstand spaltet er sich in einen tiefen Dreiklang und einen hohen verdoppelten Terzton. Zur Undurchhörbarkeit tritt die Unausgewogenheit des Klangs – ein Charakteristikum, mit dem das ganze Prélude hindurch gearbeitet wird.
Die Stimmung des Prélude – Melancholie im ganzen Umfang des Begriffs – wird nicht unwesentlich durch eben diese Klangcharakteristik bewirkt. Dennoch sollte nicht übersehen werden, daß Klang bei Chopin durchaus auch funktional eingesetzt wird: Der Klangcharakter wird immer wieder auf die anderen Ebenen der Komposition bezogen. Das bedeutet hier: Die Unausgewogenheit des Klangs erzeugt nicht nur eine charakteristische Stimmung, sondern wird auf den folgenden Klang funktional bezogen. In T. 3 wird durch das e' der Melodie der Klang ausgewogen ergänzt, indem aus der Konstellation ›tiefer Dreiklang‹ <=> vereinzeltes g' die Verklammerung zweier Dreiklänge (in enger und in weiter Lage) wird:
Beispiel 11: Klangaufbau in op. 28, Nr. 2, T. 1 und T. 3
Es ergibt sich sozusagen eine klanglich Kadenz – eine klangliche ›Dominante‹ löst sich auf.
Untersuchen wir nun die Figuration. Bei der Analyse des Klangs haben wir es ja immer noch mit einer harmonischen Reduktion zu tun und sind noch nicht beim realen Klang angelangt. Dorthin gelangt man erst, wenn man die Auskomponierung der Harmonie durch die Figuration betrachtet – eine Figuration, die außergewöhnlich artifiziell ist. Sie stellt das eigentliche ›Herz‹ des Prélude dar, sie ist der zentrale Einfall des Komponisten, das Individuelle der musikalischen Erscheinung.
Beschreiben läßt sie sich als ›Algorithmus‹: als eine Verwandlung des Harmoniegerüsts in zwei Schritten[7]:
Beispiel 12: Figurationsschema
In einem ersten Schritt wird die zweitoberste Stimme mit einer chromatischen Wechselnote verziert. Das Ergebnis wird dann aufgespalten in eine Pendelfigur, die aus der Unter- und der Oberstimme des Akkordes besteht, und eine zweite, die die beiden Mittelstimmen repräsentiert. Dabei entsteht eine Bewegung, die trotz des langsamen Tempos eine Atmosphäre von Unruhe erzeugt: Ein Pendant zur Unausgeglichenheit des Klangs.
Zurückgeführt auf den vierstimmigen Generalbaßsatz sähe das folgendermaßen aus:
Beispiel 13: Figuration als vierstimmiger Satz
Die Wahl dieser Figuration hat nun Konsequenzen auf mehreren Ebenen:
Klang: Es erklingen nur vollkommene Konsonanzen bzw. Dissonanzen (5, 8, v7), die imperfekten Konsonanzen, die normalerweise das Klangbild tonaler Musik prägen, bleiben ausgespart.
Melodik: Die Figuration verdrängt die vierstimmige Harmonik zugunsten einer Zweistimmigkeit, die den vierstimmigen Akkord nach dem Prinzip der ›Einrahmung‹ entfaltet (ein Pendel repräsentiert die Außenstimmen und rahmt so das andere ein). Dabei ergibt sich für das Außenstimmenpendel die charakteristische Dezimenbewegung.[8]
Rhythmik: Die Wechselnote erzeugt eine rhythmische Hierarchie: Während sich das Muster des ersten Pendels im Wert einer Viertel wiederholt, ergibt sich für das zweite eines in Halben:
Beispiel 14: Rhythmische Hierarchie
Dieser Aspekt rhythmischer Hierarchie spielt eine entscheidende Rolle, wenn im weiteren Verlauf des Prélude die Figuration auf das Harmoniegerüst stößt. Man kann dabei sehen, wie die Klanglichkeit in eine subtile Konkurrenz zur Syntax bzw. zur Architektur tritt. Das sei an zwei Stellen aufgezeigt: An T. 5 als ›Einführung‹ und an den Takten 11/12, die ja schon in mehrfacher Hinsicht als zentrale Takte hervorgetreten sind.
Vergegenwärtigen wir uns noch einmal das Harmoniegerüst der ersten Phrase:
Beispiel 15: Harmonisches Gerüst, T. 3–6
In T. 5 findet sich ein Quartvorhalt über der V. Stufe innerhalb einer Kadenz in G-Dur. Diese Dissonanz-Wendung ist eine der häufigsten Kadenzformeln in der Geschichte der Tonalität.[9] Als schlichtes Harmoniegerüst betrachtet, ändert auch die Oktavparallele zwischen zweitunterster und oberster Stimme nichts an dieser Konventionalität: Sie erscheint hier eindeutig als Klangverdopplung.
Chopins Figurations-Algorithmus besteht nun aus zwei ›Regeln‹:
Die zweitunterste Stimme wird durch eine chromatische Wechselnote verziert.
Das ›Ergebnis‹ entfaltet sich in zwei Pendelfiguren.
T. 5 erscheint daher in dieser Gestalt:
Beispiel 16: Figuration in T. 5
Es entsteht hierbei eine Figur von höchster Originalität und Expressivität: Die alte Kadenzformel wird zu neuem Leben erweckt. Zwei Aspekte spielen hier eine Rolle:
In den Takten 1–4 hatte sich das Muster 3 + 1 Achtel für das nach oben gehalste Pendel etabliert. Es war gekoppelt an die Intervallfolge K(onsonanz)/D(issonanz)-K/K
Beispiel 17: Intervallstruktur von T. 1
Das gleiche Muster scheint sich in T. 5 zu wiederholen:
Beispiel 18: Intervallstruktur von T. 5
Die Pointe besteht nun aber darin, daß die letzte Konsonanz (die Oktave G-g ) syntaktisch (oder anders gesagt: übergeordnet) eine Dissonanz ist. Dies wird aber erst wirklich in der zweiten Hälfte von T. 5 deutlich, da sich das Rhythmusgefühl erst auf das übergeordnete Muster der Quartauflösung (in Halben) einstellen muß.
Beispiel 19: Intervallstruktur und Quartauflösung, T. 5
Die Oktave G-g auf der vierten Achtel ist dabei in höchstem Maße ambivalent: Im übergeordneten Kontext dissonant, ist sie ›lokal‹ als Klang vollkommen (konsonant) und in der tiefen Lage auch besonders stabil.
Hinzu kommt, daß die Oberstimme der vierstimmigen Begleitharmonie im Harmonieauszug eindeutig als verdoppelte Stimme erschien. Doch auch hier sorgt die Figuration für eine Irritation – oder eher: für eine Individuation. Die Quartauflösung g-fis erfolgt ja in den beiden betroffenen Stimmen asynchron:
Beispiel 20: Asynchrone Quartauflösung
Die Figuration lädt so die konventionelle Kadenzformel mit individueller Bedeutung auf. Es entsteht real die Intervallfolge 5-v8-5-8-5-k7-5-8, eine Folge, die sich in ihrer Klanglichkeit sehr weit von der (mitzuhörenden) 4-3-Fortschreitung entfernt, zu einer Verfremdung führt und so verhindert, daß der Klang von der Syntax, oder, anders gesagt: der Augenblick von der Zukunft verschluckt wird.
Die ›Gefährdung‹ der tonalen Syntax, die wir in T. 5 beobachtet haben, wird durch eine Figuration erzeugt, die die basalen Harmoniefortschreitungen stark in den Hintergrund treten läßt und die Klänge der Einzelintervalle in ihrer klanglichen Autonomie stärkt. In den Takten 11/12 wird das noch überboten.
Der halbverminderte Septakkord in T. 11 stellt – wie gezeigt – den Wendepunkt der Tonalität des Prélude dar: In bezug auf den Tonartenplan findet sich hier der Akkord, der am weitesten von der Zieltonart entfernt ist (II in cis-Moll), in bezug auf die zugrundeliegende Syntax wirkt er trugschlüssig und ambivalent: Er ist sowohl auf die vorhergehende Kadenz als auch gleichermaßen auf die folgende Alterationskette bezogen. Mit seinem unmittelbaren Kontext sieht das Harmoniegerüst folgendermaßen aus:
Beispiel 21: Harmonisches Gerüst, T. 8–12
Im Vergleich mit T. 5 ergeben sich nun entscheidende Unterschiede. Der Gang cis-c in der Ober- bzw. der zweituntersten Stimme der linken Hand läßt sich – im Unterschied zum Gang g-fis in T. 5 – nicht ohne weiteres als Auflösung verstehen: Das Sekund-Terz-Modell wird ersetzt durch eine Fortschreitung große Sekunde => übermäßige Sekunde. Diese Fortschreitung stellt dann den Beginn der Alterationskette dar.
Mindestens ebenso wichtig ist aber ein weiterer Unterschied zu T. 5: Die Klangfortschreitung erfolgt erst nach anderthalb Takten (T. 5: 1/2). Die Figuration ergibt in T. 11/12 daher:
Beispiel 22: Figuration in T. 11/12
Anderthalb Takte (eine in dem langsamen Tempo des Prélude sehr lange Zeit) lang breitet sich somit eine Figur aus, die in einem tonalen Kontext einen einzigartig dissonanten Klanggehalt entfaltet. Tritonus–verminderte Oktave–Tritonus und dagegengesetzt die leere Oktave: Diese Klangfolge verliert bei ihrer Entfaltung ihre syntaktische Einbettung, die Klangfortschreitung wird zum Klangstillstand und die unmittelbare sinnliche Wirkung der Klänge tritt hervor. Entscheidend ist aber auch, daß das Ausblenden von Syntax (und auch das der architektonischen Position des Akkordes) genau in Beziehung gesetzt wird zu ebendiesen Ebenen: Das syntaktisch/architektonische Hören schlägt genau dann in klangliches Hören um, wenn der syntaktisch/architektonische Verlauf seinen neuralgischen Punkt erreicht. Wir werden somit als Hörer an einen Punkt geführt, an dem die Tonalität eben nicht mehr für uns hört, sondern wir dem ›dumpfen Schmerz‹ der dissonanten Klänge ohne den Schutz eines harmonischen Schemas ausgesetzt sind:
»Auch Krankes, Fieberhaftes, Abstoßendes enthält das Heft.«[10]
Schumanns Reaktion zeigt das Gefühl von Fremdheit, das Chopins Musik hervorrufen konnte und immer noch hervorrufen kann – in nicht unwesentlichem Maße ist dafür die Rückeroberung unmittelbarer Klangwirkungen verantwortlich, die im hier analysierten Prélude eine Atmosphäre von Verstimmung, von Widerwillen – von Melancholie erzeugt.
Für Morton Feldman ist Tonalität ein System, das den Hörer vom sinnlichen Erlebnis des gegenwärtigen Augenblicks ablenke. Meine Analyse hat dagegen gezeigt, wie eine tonale Komposition den Klang, den ›blinden Fleck‹ der Gegenwart zum Thema haben kann: In T. 11/12 des Prélude – der Krisis des tonalen Verlaufs – verschiebt sich für den Hörer die Perspektive von harmonischer Prozessualität hin zur sinnlichen Klangerfahrung. Interessanterweise geschieht dies nicht dadurch, daß an irgendeiner Stelle die tradierten Satzkonventionen der Tonalität mißachtet werden, sondern einzig und allein durch eine höchst individuelle Figuration. Nun wäre es natürlich naiv, zu behaupten, Chopins Musik antizipiere die Poetik der New York School. Die Zentrierung des Klangs ist ja bei Chopin trotz allem in den tonalen Prozeß eingebunden, mehr noch: von ihm abhängig. Es wurde gezeigt, wie Chopin im zeitlichen Ablauf ›Klang‹ genau auf Syntax und Architektur bezieht. Und trotzdem: Was wäre der Sinn einer Analyse von Musik der Vergangenheit, wenn sie nicht zu der der Gegenwart in Beziehung gesetzt würde? So ist es bemerkenswert, daß Feldman in seiner Entwicklung als Komponist von seinem ursprünglichen Ideal einer »Musik ohne Gedächtnis«, einer Musik, die nur den Klang der Gegenwart im Visier hatte, wieder abging und eine Konzeption entwickelte, die die Magie des Augenblicks ›dialektisch‹ durch Verfahren der »Gedächtnisirritation« hervortreten ließ. Eine Musik also, die alle Modi der Zeit beinhaltete, wenn auch in unterschiedlicher Gewichtung.
Wie auch immer: Wie sich der Augenblick zum Ganzen verhält und umgekehrt, ist eine denkbar abstrakte Fragestellung, der kein Komponist entgehen kann. Die romantische Philosophie hat den Stellenwert des Systems genau reflektiert – ohne sich dabei einseitig auf die eine Seite oder die andere Seite zu schlagen:
»Wer ein System hat, ist so gut geistig verloren, als wer keins hat. Man muss eben beides verbinden.«[11]
heißt es bei Friedrich Schlegel. Seine ›dialektische‹ Forderung, daß sowohl System und Nicht-System als auch die doppelte Verlorenheit zusammengedacht werden müssen, könnte man auch so paraphrasieren:
»Wer voraushört, hört genauso nichts, wie der, der es nicht tut. Man muß eben beides verbinden.«
Anmerkungen
Feldman 2000, XVIII. | |
Zit. nach Grabner 1958, 5. | |
Rosen 1998, 285. | |
Schumann 1982, 163. | |
Bei Bach heißt ›Praeludium‹ ja immer: Verweis auf die folgende Fuge. Interessant in dieser Hinsicht, daß Chopin offensichtlich in Konzerten einzelne Prélude s als Einleitungsstücke zu größeren Werken positionierte (vgl. Kallberg 1998, 135ff.). | |
Chopin hat dieses Verfahren besonders geschätzt: So beruht beispielsweise das vierte Prélude oder die sogenannte ›letzte Mazurka‹ fast ausschließlich auf Alterationsketten. | |
Zum ›algorithmischen‹ Aspekt der Chopinschen Kompositionstechnik vgl. Kinzler 1977. | |
Bildlich gesprochen, könnte man sagen: Die Figuration bewegt sich wie einer, der auf einer schiefen Ebene geht – oder wie jemand mit einem langen und einem kurzen Bein. Daß die Charakteristik der Begleitfigur, die ja am Anfang des Prélude ›nackt‹ hervortritt, gerade in der ersten Pendelfigur liegt, wird leider von den meisten Interpreten eher versteckt als herausgestellt. | |
Und kann als Musterbeispiel dafür stehen, was Feldman mit seinem »wir brauchen nicht mehr selbst zu hören« meinte. | |
Schumann 1982, 163. | |
Zit. nach Frank (1989), 225. |
Literatur
Feldman, Morton (2000), »The Future of Local Music« (1984), in: ders., Give my Regards to Eighth Street. Collected Writings of Morton Feldman, Cambridge (MA): Harvard University Press, XVIII.
Frank, Manfred (1989), Einführung in die frühromantische Ästhetik, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Grabner, Hermann (1958), Anleitung zur Fugenkomposition, Leipzig: Kistner & Sigel.
Kallberg, Jeffrey (1998), »›Small Forms‹. In Defense of the Prelude«, in: ders., Chopin at the Boundaries, Cambridge (MA): Harvard University Press.
Kinzler, Hartmuth (1977), Frédéric Chopin. Über den Zusammenhang von Satztechnik und Klavierspiel, Wiesenfeld: Katzbichler.
Rosen, Charles (1998), The Romantic Generation, Cambridge (MA): Harvard University Press.
Schumann, Robert (1982), Schriften über Musik und Musiker, Stuttgart: Reclam.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.