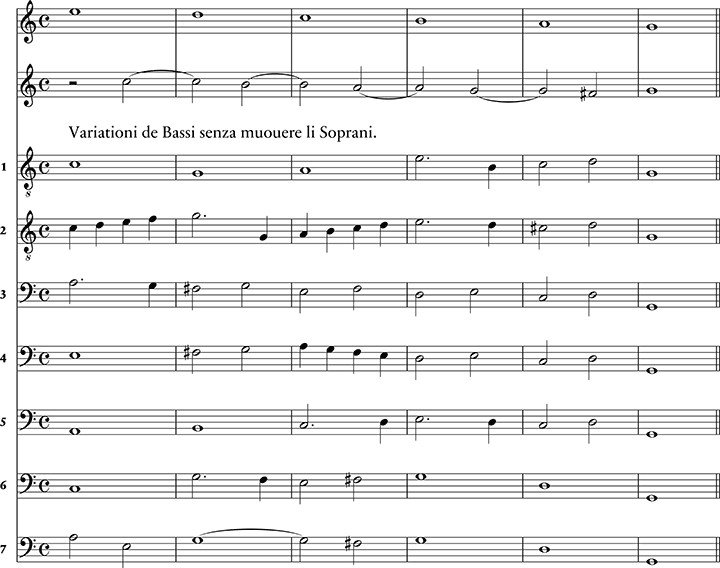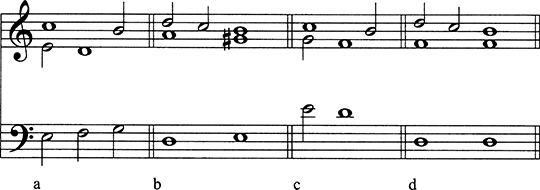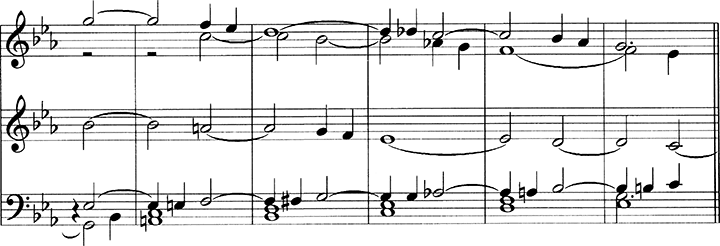Intervallsatz und Geschichte
Folker Froebe
In seinen Arbeiten zur Theorie- und Kompositionsgeschichte ist Carl Dahlhaus einem emphatischen Begriff von Musiktheorie gefolgt wie kaum ein anderer Musikwissenschaftler vor ihm. Während er einerseits die Musiktheorie ›historisierte‹, fragte er andererseits nach dem systematischen Gehalt der historischen Musiktheorie und der impliziten Theorie, die in der Kompositionsgeschichte enthalten ist. Dahlhaus’ hermeneutische Doppelbewegung hat nachfolgende Generationen von Musiktheoretikern geprägt und die deutschsprachige Musiktheorie grundlegend verändert. Vor diesem Hintergrund werden Wechselbeziehungen zwischen musiktheoretischem Denken und historischer Narration in Dahlhaus’ Werk herausgearbeitet und problematisiert: Inwieweit bestimmen systematische Voraussetzungen die Konstruktion von Geschichte? Inwieweit beeinflussen narrative Strategien die musiktheoretische Kategorienbildung? Der vorliegende Beitrag geht diesen Fragen anhand des zentralen Begriffs ›Intervallsatz‹ nach.
In his work on the history of music theory and composition Carl Dahlhaus pursued an emphatic concept of music theory like hardly a musicologist before him. While historicizing music theory, he also systematically investigated the contents of historical music theory as well as the implicit theory inherent in the history of composition. Dahlhaus’s hermeneutic ‘double motion’ strongly influenced subsequent generations of musicologists and fundamentally transformed German music theory. Against this background, the interrelations between theoretical thinking and historical narration in Dahlhaus’s work are identified and problematized: To what extent is the construction of history determined by systematic conditions? To what extent do narrative strategies influence music-theoretical conceptualization? The present article explores these issues with reference to the concept of ‘Intervallsatz’ (intervallic composition).
1. Intervallsatz – Akkordsatz – harmonische Tonalität
Carl Dahlhaus’ Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität von 1967[1] erzählen eine verwickelte, rund 400 Jahre währende Beziehungsgeschichte. In ihr stehen zwei grundverschiedene Protagonisten einander gegenüber, von denen nicht klar ist, ob es sich bei ihnen um Angehörige zweier aufeinanderfolgender Generationen, um Geschwister oder vielleicht sogar um zwei Aspekte einer Person handelt: Intervallsatz und Akkordsatz. Beide dienen einem Dritten, dem musikalischen Zusammenhang. Darin, wie sie dies tun, erweisen sie sich als verschieden: Der Intervallsatz bringt Ereignisketten hervor, vermag aber keinen tonalen Zusammenhang herzustellen. Dem Akkordsatz hingegen wächst diese Fähigkeit im Laufe der Zeit zu, und es könnte scheinen, als sei er nur um ihretwegen in die Welt gekommen. Doch stürzt er in eine nie überwundene Identitätskrise. Denn die (funktionalen) Akkorde der ›harmonischen Tonalität‹ sind mit den (manifesten) Akkorden des Akkordsatzes keineswegs identisch. Der gesamte ›Plot‹ der Erzählung ist um diese Konstellation herum gebaut; und wie oft in guter Literatur gibt es kein ›Happy End‹, keine Synthese am Schluss, sondern nur die Schlüssigkeit des Erzählzusammenhangs als Ganzes. Nicht zuletzt kann Dahlhaus’ Erzählung auch noch mit einer zunächst unerwarteten, ja paradox erscheinenden Pointe aufwarten, nämlich dass Fortschreitungsmodelle des Intervallsatzes auch unter den Bedingungen der harmonischen Tonalität, mithin bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, für den musikalischen Zusammenhang konstitutiv blieben.
Die Einzelmomente dieser Erzählung bedingen einander; sie bilden ein Netzwerk von Voraussetzungen und Resultaten. Ihre zentralen Begriffe – Intervallsatz, Akkordsatz und Tonalität – sind jeweils beides zugleich: Voraussetzung und Resultat. Die Behauptung, der Intervallsatz könne keine Tonalität konstituieren, ist nur plausibel, wenn Tonalität exklusiv als harmonische Tonalität bestimmt wird, und umgekehrt. Insofern Dahlhaus in seinen Untersuchungen die systematische Bestimmung und Klärung des Begriffs ›harmonischer Tonalität‹ dem historischen Teil voranstellt, ist sein hermeneutisches Vorgehen transparent.
* * *
Welche Funktion übernehmen die bisher angesprochenen Begriffe in Dahlhaus’ Erzählung und welche Verhältnisbestimmungen erfahren sie?
Folgt man Dahlhaus’ Diskussion früherer Forschungsergebnisse, so unterstellten Edward E. Lowinsky[2], Povl Hamburger[3] und andere Autoren, bereits »das früheste Auftauchen etwa der Progression I-IV-V-I« sei »Zeichen und Ausdruck eines neuen ›Tonalitätsgefühls‹ gewesen, das dann allmählich statt einzelner Teile ganze Formen unter seine Herrschaft brachte«.[4] Dem Versuch, die Entwicklung der tonalen Harmonik als »Wachstum eines Keims«[5] zu begreifen, setzt Dahlhaus die Figur eines »qualitativen Sprung[s]« entgegen.[6] Er zeigt, dass in Satzbildern des späten 15. bis frühen 17. Jahrhunderts, die man geneigt sein könnte, mit tonalen Akkordsätzen zu identifizieren, nur Einzelmomente tonaler Harmonik realisiert sind. Die historische Entwicklung wäre demnach nicht durch ein quantitatives Wachstum im Raum, sondern durch die Verfestigung und den Zusammenschluss von Einzelmomenten harmonischer Tonalität zum Systemzusammenhang gekennzeichnet.[7]
Der Begriff von Intervallsatz, dem Dahlhaus folgt, ist darauf abgestellt, den ›Systemwechsel‹ an die Konzepte ›Akkord‹ und ›harmonische Tonalität‹ zu binden: Eine Intervallprogression sei »in sich abgeschlossen«[8]; der Zusammenhang, in dem sie steht, ändere »nichts an ihrer Bedeutung«; sie sei »unabhängig von der Tonart«[9]. Gerade die ›Funktionalität‹ intervallisch beschreibbarer Klangfolgen hätte als Indiz für deren ›Aufhebung‹ im tonalen Akkordsatz zu gelten.
Weder ist die Behauptung, die Intervallprogression sei kontextuell und tonal indifferent, zwingend, noch sind es die daraus gezogenen Schlussfolgerungen: Erstens gilt Entsprechendes auch für eine Akkordfortschreitung, insofern jede Aussage über ihre Funktion in einem tonalen Zusammenhang keine Aussage über die Akkordfortschreitung als solche, sondern eine relationale Bestimmung darstellt. Zweitens lassen sich entsprechende relationale Bestimmungen (etwa hinsichtlich Stellung und Verhalten im tonalen Raum, Intervallqualitäten und melodischer Bezüge) auch für Fortschreitungen von Intervallen und Intervallverbänden vornehmen. In diesem Sinne folgen etwa Ludwig Holtmeiers Herleitung der Oktavregel aus der »›Durchkadenzierung‹ der Skala mittels […] kontrapunktische[r] Kadenzmodelle«[10] oder William Renwicks[11] und Nicolas Meeùs’[12] Versuche, die Schenker’schen Kategorien ›Zug‹ und ›Ursatz‹ auf die historische Klausellehre zu beziehen, unter jeweils verschiedenen Gesichtspunkten dem Paradigma eines »tonalen Intervallsatzes«[13]. Dahlhaus’ Rede vom ›neutralen‹ oder ›abstrakten‹ Intervallsatz schließt Bestimmungen innerhalb eines Paradigmas aus, um sie einem anderen zuzuschreiben.
Die Kennzeichnung des Intervallsatzes als ›neutral‹ und ›abstrakt‹ konkretisiert demnach die systematische Voraussetzung, Tonalität sei nur als harmonische denkbar: »›Intervallprogression‹«, so Dahlhaus, »ist ein Gegenbegriff« zur Kategorie »der tonalen Harmonik«.[14] Diese Entgegensetzung dient jedoch nicht allein der Begriffsklärung, sie arbeitet darüber hinaus auch dem narrativen Postulat zu, eine Handlung möge ihren Ausgang von einer grundlegenden Opposition nehmen, die ihr Richtung und Dynamik verleiht. Einige Stationen dieser Handlung seien im Folgenden nachgezeichnet.
Um beide Kategorien – Intervallsatz und tonale Harmonik – entwicklungsgeschichtlich aufeinander beziehen zu können, bedarf es eines vermittelnden Moments, nämlich des ›älteren‹ Akkordsatzes. Er bildet die historische Voraussetzung für das Entstehen harmonischer Tonalität, ohne selbst bereits tonal zu sein.
War für die Sukzessivkomposition ein hierarchisch strukturiertes Netzwerk aus Gerüst- und Ergänzungsstimmen charakteristisch, so eröffnet die Simultankonzeption im Laufe des 16. Jahrhunderts die Möglichkeit, einen »drei- oder viertönigen Zusammenklang als unmittelbar gegebene Einheit« zu verstehen.[15] Allerdings sind, wie Dahlhaus betont, ›Dezimensatz‹ oder ›Tenor-Diskant-Gerüst‹ auf der einen Seite und ›Simultankonzeption‹ auf der anderen keine Gegenbegriffe. Dass ›Satzmodelle‹ bzw. ein Denken in ›Intervallverbänden‹ oder bassbezogenen Akkorden den kontrapunktischen Komplex simultan ›greifbar‹ machen, hindert nicht, die Satzstruktur hierarchisch, also in einem strukturellen Sinne ›sukzessiv‹ zu verstehen. Noch in Angelo Berardis Auflistung alternativer Unterlegungen einer Vorhaltskette durch den Bass fungiert letzterer offenkundig als kontrapunktische Ergänzungsstimme.
Beispiel 1: Angelo Berardi: Documenti armonici (1687), 154
Dass ein Triosatz von Corelli, dessen Bass sich streckenweise als kontrapunktische Ergänzungsstimme verstehen lässt, ›tonal‹ ist, eine Frottola um 1600 im ›Akkordsatz‹ hingegen nicht, hängt nicht davon ab, ob satztechnisch von ›unmittelbar‹ gegebenen Akkorden oder von einem Netzwerk aus Gerüst- und Ergänzungsstimmen auszugehen ist. Der ›qualitative Sprung‹ zur harmonischen Tonalität erfordert daher eine Differenzierung zwischen Akkordgestalt und Akkordfunktion: Akkorde im Sinne des jüngeren, funktionalen Akkordbegriffs, so Dahlhaus, seien keine dem Notentext unmittelbar zu entnehmenden »Sachverhalte«, sondern »Teilmomente einer musikalischen Hörweise«.[16] Die Wahrnehmung eines Zusammenklangs als ›unmittelbar gegebene Einheit‹ bedarf der Vermittlung durch einen Zusammenhang: Der jüngere, funktionale Akkordbegriff ist relational.
Dahlhaus erzählt die Entwicklung vom Akkordsatz zum ›Akkordsystem‹ harmonischer Tonalität in einem Handlungsstrang: ›Akkordsatz‹ und funktionaler Akkordbegriff sind, um jeweils als musikgeschichtliche bzw. musikalische ›Tatsache‹ gelten zu können, aufeinander angewiesen. Die von Dahlhaus formulierte Schwierigkeit, zwischen »Erscheinung und Bedeutung, Präsentem und Repräsentiertem«[17] zu unterscheiden, ist demnach nicht allein, wie Dahlhaus schreibt, »Ausdruck eines Problems, das in der Sache selbst steckt«, sondern ebenso eine Folge des Versuches, Musiktheorie im Medium der Geschichte zu schreiben.
2. Intervalldissonanz – harmoniefremder Ton – Akkorddissonanz
Ich habe bis hierher versucht, die ›Grundkonfiguration‹ der Dahlhaus’schen Erzählung herauszuarbeiten. Ich möchte nun zeigen, welche Schwierigkeiten daraus erstens für die Betrachtung satztechnischer Einzelmomente und zweitens für die Frage nach dem ›musikalischen Zusammenhang‹ resultieren.
Als erstes beziehe ich mich auf Dahlhaus’ Versuch, das Konzept der Akkorddissonanz für die Musik des frühen 17. Jahrhunderts plausibel zu machen.[18]
Dahlhaus gibt vier Beispiele:
Beispiel 2: Dahlhaus 2001a/GS3 131, Bsp. 46
Alle vier Beispiele lassen sich widerspruchsfrei im Rahmen eines rein kontrapunktischen Paradigmas verstehen. Beispiel c) etwa repräsentiert das Fragment einer tenorisierenden Klausel mit Septimenvorhalt. Eben durch das Anliegen, die mit dieser ›historischen‹ Erklärung korrelierende Hörweise für die Dissonanzenbehandlung des frühen 17. Jahrhunderts als anachronistisch zurückzuweisen, dürfte die Auswahl der Beispiele motiviert sein. Denn der »Begriff der Intervalldissonanz«, so Dahlhaus’ Kernthese, bezeichne »ein der Differenz zwischen Akkorddissonanz und ›harmoniefremdem‹ Ton geschichtlich vorausgehendes – und sie ausschließendes – Prinzip der Dissonanzenauffassung«.[19]
Dahlhaus’ Kriterium für eine Bestimmung als Akkorddissonanz ist die »Wechselwirkung« von Dissonanzenauflösung und Fundamentschritt:[20]
Die Septime wird als Akkorddissonanz empfunden, sofern der Fundamentton bei der Auflösung der Dissonanz wechselt (Beispiel a und b), dagegen als ›harmoniefremder‹ Ton, sofern er festgehalten wird (Beispiel c und d).[21]
Betrachten wir die Beispiele c) und d): Würde ihnen jeweils der Fundamentschritt d-g unterlegt, so hätten die Septimen – der Vorhalt in Beispiel c) und der Durchgang in Beispiel d) – nach Dahlhaus’ Kriterien als Akkordissonanzen zu gelten. Eben darum ist für Dahlhaus die hier abgebildete Fassung ohne Fundamentschritt des Basses im selben historischen Moment nur als harmoniefremder Ton (und eben nicht als Intervalldissonanz) denkbar. Er scheint von der Triftigkeit des einfachen Umkehrschlusses auszugehen, demzufolge vom Fehlen eines manifesten Fundamentschritts auf »das Fehlen eines ›Harmoniewechsels‹ während der Dissonanzauflösung«[22] geschlossen werden könne. Allerdings lässt sich in Beispiel d) die mit Zählzeit ›drei‹ eingestellte Sexte h auch mit größter Mühe nicht als (latenter) Bestandteil des vorangehenden Klangs verstehen. Und in Beispiel c) ist keineswegs klar, zu welchem Akkord sich die Septime als harmoniefremder Ton verhält. Handelte es sich schlicht um den Sextenklang d-f-h, so bestünde kein prinzipieller Unterschied zwischen Intervalldissonanz und harmoniefremdem Ton: Um in Dahlhaus’ Sinne von einem harmoniefremden Ton sprechen zu können, bedarf es des Bezugs auf einen Fundamentton.
Im Rahmen sowohl der Fundamentschritttheorie als auch der Funktionstheorie würde die 7-6-Auflösung in Beispiel c) regelmäßig als Fortschreitung von einer subdominantischen Antepenultima in eine dominantische Penultima, also II-VII-I- oder II-V-I-Verbindung interpretiert. Und es ist nicht einzusehen, warum die Denkfigur einer »Wechselwirkung zwischen Dissonanzauflösung und Fundamentschritt«[23] es nicht erlauben sollte, von der Dissonanzenauflösung her auf einen Harmonie- bzw. Funktionswechsel, also einen verschwiegenen Fundamentschritt zu schließen.
Demgegenüber ist Dahlhaus’ Bestimmung der Septime als harmoniefremder Ton durch zwei einander widersprechende Momente gekennzeichnet: Zum einen wird von der Bewegungslosigkeit der manifesten Bassstimme auf die Bewegungslosigkeit des Fundaments geschlossen. Dies aber bedeutet nichts anderes, als ein Teilmoment der manifesten kontrapunktischen Disposition zum Kriterium der harmonischen zu erklären: Die kategoriale Differenz zwischen Intervall- und Akkordsatz, die Dahlhaus durch die Gegenüberstellung von Intervalldissonanz und harmoniefremdem Ton eigentlich zu erweisen sucht, wird ad absurdum geführt. Zum anderen zwingt die Annahme einer über beide Zählzeiten der Tenorklauselpenultima gleichbleibenden Harmonie dazu, als Fundament bereits des Klanges d-f-c entweder die VII. oder die V. Stufe anzunehmen. Beide Deutungen löschen den Klang der II. Stufe aus und stehen, anders als etwa die Annahme einer II-V-I-Verbindung, zur manifesten satztechnischen Disposition in Spannung.
Die Vermengung von ›Erscheinung‹ – also Bewegungslosigkeit der Bassstimme – und ›Bedeutung‹ – also Bewegungslosigkeit des Fundaments – scheint hier weniger einer Unschärfe des musiktheoretischen Denkens geschuldet als der historiographischen Motivlage. Einerseits wird die Ablösung des älteren Paradigmas als geschichtlicher Bedeutungswandel erzählt: ›Dasselbe‹ (die Intervalldissonanz) wird im Rahmen eines verschobenen Bezugssystems als ›etwas anderes‹ gehört (nämlich als Akkorddissonanz). Andererseits wird der Bedeutungswandel, um ihn in der ›musikalischen Wirklichkeit‹ verorten zu können, von einem bestimmten Moment der satztechnischen Konfiguration abhängig gemacht, dem manifesten Fundamentschritt der Bassstimme. Wenn aber das neue Paradigma der Akkorddissonanz als neues historisches Stadium plausibel gemacht werden soll, dann muss es auch dort durchgeführt werden, wo die zuvor aufgestellten materialen Kriterien der neuen Bestimmung nicht gegeben sind. Erforderlich wird eine weitere Differenzierung, im Zuge derer dem Septimenvorhalt über der liegenden Tenorklauselpenultima die neue Qualität eines harmoniefremden Tons zugewiesen wird. Der kategoriale Fehlschluss von der Bewegungslosigkeit der manifesten Bassstimme auf die Bewegungslosigkeit des harmonischen Fundaments ist der konsequenten Durchführung einer dialektischen Erzählstruktur geschuldet. Dass er eine veränderte Hörweise reflektiert, erscheint fraglich.
3. Musikalischer Zusammenhang – funktionaler Zusammenhang
Die unklare Verhältnisbestimmung von Substanz- und Funktionsbegriffen, die sich, wie wir gesehen haben, bis in die Interpretation satztechnischer Details nachverfolgen lässt, betrifft umso mehr auch die Frage nach dem ›musikalischen Zusammenhang‹.
Der Begriff ›musikalischer Zusammenhang‹ durchzieht Dahlhaus’ Schriften seit den 50er Jahren wie ein roter Faden. Er wird von ihm an keiner Stelle explizit bestimmt, beschreibt aber offenkundig den eher kleinräumigen Konnex von einem musikalischen Moment zum nächsten bzw. die Kohärenz einer musikalischen Ereignisfolge. Sprachlich analog gebildet ist die Rede vom ›funktionalen Zusammenhang‹. Sie gehört zu einem Feld sprachlicher Formeln, die sich um den Begriff der harmonischen Tonalität gruppieren. In welchem Verhältnis aber stehen die Begriffe ›musikalischer Zusammenhang‹ und ›funktionaler Zusammenhang‹ zueinander?
Ein viel zitierter Satz aus »Relationes Harmonicae« von 1975 lautet:
Satztechnische Modelle wie die Quintschrittsequenz oder die Sextenkette […] bilden ein selbstständiges Konstituens musikalischen Zusammenhangs neben der tonalen Harmonik.[24]
So kann Dahlhaus etwa sagen, der »musikalische Zusammenhang« in einer Partie aus Wagners Tristan sei durch eine »Kette von Septimensynkopen« bestimmt«, derjenige zu Anfang der Waldsteinsonate hingegen durch »die Funktionen der einzelnen Akkorde«.[25]
Demnach wäre der ›funktionale Zusammenhang‹ einer von zwei verschiedenen Modi ›musikalischen Zusammenhangs‹. Der Funktionsbegriff bliebe der tonalen Harmonik vorbehalten. Wodurch und in welcher Weise dagegen satztechnische Modelle, also Fortschreitungsmodelle des Intervallsatzes, musikalischen Zusammenhang konstituieren, bleibt eigentümlich unbestimmt. Dahlhaus scheint vorauszusetzen, dass die »Stringenz«[26] von Modellen in der kontrapunktischen Fortschreitungslogik, also dem »Wechsel der Klangcharaktere« und der »Bewegungsart«[27] sowie in der Kettenbildung (also dem Aspekt syntagmatischer Fügung) gründet. Ernst Kurths energetisches Konzept wird in diesem Zusammenhang ebenso zurückgewiesen wie Schenkers Konzept des tonal bestimmten ›Zuges‹:[28] Nicht die Linie erscheint Dahlhaus als das primäre Moment, sondern das »abstrakte Intervallgerüst«, dessen einzelne Progressionen sich »zu einem Sekundgang zusammenschließen«.[29]
Beispiel 3: Dahlhaus 2001c/GS3, 596, Bsp. 10: Johann Sebastian Bach, Ricercare aus dem Musicalischen Opfer, T. 57–62
So ist es nur konsequent, dass Dahlhaus etwa in den abgebildeten Takten 57–62 des Ricercars aus dem Musicalischen Opfer in der Gegenbewegung der Oberstimme keinen »primäre[n] Bewegungszug«, sondern »das Resultat von Oktavversetzungen einzelner Töne des Schemas«, nämlich der aufsteigenden 5-6-Konsekutive, erkennt.[30] Nun ließe sich einwenden, dass auch die Gegenbewegungsfaktur zwischen Bass und Oberstimmen in den Quellen des 18. Jahrhunderts als eigenständige Konfiguration beschrieben wird. Doch ist dies nicht der zentrale Punkt. Denn auch unabhängig davon wäre es widerspruchsfrei möglich, einen Zweck der von Dahlhaus beschriebenen Operationen im linear vermittelten Registerwechsel des Oberstimmentons g und dem Bassgang von g nach es zu erkennen. Derartige Bestimmungen werden von Dahlhaus nicht nur nicht vorgenommen, sondern bisweilen auch (etwa im Rahmen der Federhofer-Kontroverse) mit Verweis auf das in kleinräumiger Satztechnik für konstitutiv Erachtete explizit zurückgewiesen. Der durch Satzmodelle konstituierte ›musikalische Zusammenhang‹ ist, so wie Dahlhaus ihn versteht, kein funktionaler, sondern ›sich selbst genug‹. Er fällt zusammen mit dem präfigurierten, gegebenenfalls um ergänzende Bestimmungen bereicherten satztechnischen Zusammenhang des Modells. Für den Gebrauch von Satzmodellen im Kontext harmonischer Tonalität gilt sinngemäß, was Dahlhaus über die Bassformel des 17. Jahrhunderts schreibt:
Der Beziehung des Einzelnen auf das Allgemeine verdankt eine tonale Akkordfolge ihre Geschlossenheit. Eine Baßformel [respektive ein Modell] aber repräsentiert nichts als sich selbst.[31]
Wo der Gebrauch von Intervallsatzmodellen mit funktionaler Harmonik einhergeht, fordert Dahlhaus daher ein »Auseinanderlegen der Momente«, im oben zitierten Bach-Beispiel etwa von »Sequenzmodellen und ›hereinspielenden‹ Dominanten«.[32] Aus dieser Sicht bilden tonale Harmonik und Intervallsatzmodelle konkurrierende »Dimensionen« des Tonsatzes, die wechselnde Bestimmungsverhältnisse eingehen:
Die tonale Harmonik erweist sich demnach als eine Dimension des Tonsatzes, die entweder ein primäres, fundierendes oder aber ein sekundäres, fundiertes Moment darstellt, die entweder deutlicher oder aber schwächer ausgeprägt sein kann und manchmal bis zur Irrelevanz verblasst.[33]
Wenn aber in Intervallsatzfortschreitungen und -modellen ›Substanz‹ und Bedeutung zusammenfallen, für tonale Harmonik jedoch behauptet wird, der Zusammenhang, den sie konstituiert, sei ›funktional‹, ergeben sich Probleme. Denn unter dieser Voraussetzung können der ›musikalische Zusammenhang‹, den satztechnische Modelle konstituieren, und der ›funktionale Zusammenhang‹ tonaler Harmonik nicht auf einer kategorialen Ebene liegen: Sie konkurrierten nicht miteinander, sondern repräsentierten schlicht verschiedene Gesichtspunkte einer Sache. Genauer: sie verhielten sich zueinander wie ›Substanz‹ und Interpretation, etwa in dem Sinne, in dem Dahlhaus andernorts zwischen Kontrapunkt und Harmonie differenziert hat:
›Kontrapunkt‹ ist ein kompositionstechnischer, ›Harmonie‹ dagegen ein philosophischer Begriff und Terminus, der musikalische Sachverhalte weniger bezeichnet als interpretiert.[34]
Dem Problem lässt sich bis in sprachliche Unschärfen nachspüren. So lautet ein zentraler Satz in »Bach und der ›Lineare Kontrapunkt‹«:
In Bachs chromatischem Kontrapunkt aber gerät die Tradition des neutralen Intervallgefüges in Konflikt mit dem Anspruch der tonalen Harmonik, die Satztechnik zu ›fundieren‹ […].[35]
Der Zweck der anthropomorphen Rede von einem »Anspruch der tonalen Harmonik, die Satztechnik zu ›fundieren‹«, scheint darin zu bestehen, die Differenz zu verdecken zwischen dem Anspruch der Sache (der gegebenenfalls unabweisbar wäre) und dem des Interpreten (dessen Anspruch das Resultat falscher Voraussetzungen oder Erwartungen sein könnte).[36] Die Alternative, Intervallsatz und funktionale Harmonik im Sinne von Substanz und Interpretament aufeinander zu beziehen, hat Christfried Lenz 1970 in einer nach wie vor beachtenswerten Dissertation zur Satztechnik Bachs äußerst klar formuliert, interessanterweise ohne die Nähe seiner Argumentation zu schenkerianischem Denken zu bemerken:
Intervallprogression bedeutet nichts anderes als den klassischen, auf der Zweistimmigkeit beruhenden Kontrapunkt. In ihm ist die Wechselwirkung von Zusammenklang und Stimmführung explizit zu beachten […]. Zwischen dem klassischen polyphonen Satz und funktionaler Harmonik aber ist schlechterdings eine ›Wechselwirkung‹ nicht denkbar.[…] Denn sie stellen ja (anders als die abstrakten Kategorien Zusammenklang und Linie) keine Gegensätze dar, die sich erst wechselseitig begründen könnten, sondern funktional erklärbare Klangverbindungen sind doch zunächst nichts anderes als Konstellationen, die innerhalb der Vokalpolyphonie vorkommen […].[37]
Hält man demgegenüber an der von Dahlhaus behaupteten Dichotomie fest und betrachtet satztechnisches Modell und funktionale Harmonik als alternative, konkurrierende Konstituentien musikalischen Zusammenhangs, so erweist sich Dahlhaus’ Rekurs auf Ernst Cassirers »Unterscheidung zwischen Substanz- und Funktionsbegriffen«[38] als uneingelöstes Postulat.
4. Pointierungen
Einige grundsätzliche Probleme der Dahlhaus’schen Argumentations- und Erzählweise werden im Folgenden herausgearbeitet und zugespitzt.
1. Dahlhaus geht, an Riemann anknüpfend, davon aus, in Satzpartien, deren Zusammenhang primär durch Intervallsatzmodelle konstituiert würde, sei die Tonalität zeitweilig suspendiert: »Musik«, so Dahlhaus, »die tonal ist«, brauche »es nicht in jedem Detail zu sein«.[39] Der Umkehrschluss liegt nahe: Um von einem ›lückenlosen‹ tonalen Zusammenhang reden zu können, bedürfte es einer »ununterbrochenen Präsenz«[40] materialer Elemente, die harmonische Funktionen repräsentieren. Dass Dahlhaus eben dieses positivistische Zerrbild von Funktionalität Analytikern unterstellt, »die ein musikalisches Werk als [geschlossenen] Funktionszusammenhang beschreiben« wollen[41], entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Die Abgrenzung von einer Behauptung, die so niemand aufgestellt hat, lässt sich als paradoxe Selbstaussage verstehen.
2. Dahlhaus’ Behauptung, musikalischer Zusammenhang sei von der ›materialen Präsenz‹ funktional bestimmter Elemente abhängig, korreliert mit einem Mangel an Bestimmungen und Begriffen, die es ermöglichten, einem Phänomen in verschiedenen Bezügen, also etwa auf unterschiedlichen Schichten des hierarchischen Systems Tonalität, verschiedene ›Bedeutungen‹ zuzuweisen.
Vor diesem Hintergrund dürfte Dahlhaus’ Urteil über Henrich Schenker auf einer Projektion des eigenen Präsenzdenkens beruhen. Dies spiegelt sich etwa in der Aussage, Schenker würde der »musikalischen Wirklichkeit« nur dort gerecht, wo er das Verhältnis von ›Stufe‹ und ›Stimmführung‹ nicht antithetisch, sondern als »Skala von Graden der Stufenbedeutung« bestimme.[42] Schenkers ›Stufenbegriff‹ aber fußt auf einem anderen, relationalen Begriff ›musikalischer Wirklichkeit‹: Welches Moment ›musikalischer Wirklichkeit‹ aufgerufen wird, ist abhängig von der Auswahl der Beziehungen und Vergleichsgesichtspunkte. Was auf einer Schicht, also in einem bestimmten funktionalen Zusammenhang Stufe (also Akkord) ist, lässt sich auf einer tieferen Schicht als Teil eines Stimmführungsvorgangs (also eine Konfiguration des Intervallsatzes) verstehen.
3. Mit dem Mangel an relationalen Begriffen korreliert die Beanspruchung zweier Denkfiguren: ›Wechselwirkung‹ und ›dialektischer Widerspruch‹. So heißt es beispielsweise in der vorhin zitierten Passage aus »Bach und der ›Lineare Kontrapunkt‹«, der Konflikt zwischen der »Tradition des neutralen Intervallgefüges« und »dem Anspruch der tonalen Harmonik« müsse »nicht als toter, sondern als dialektischer Widerspruch begriffen werden«.[43] Worin das ›Dialektische‹ des Widerspruchs bestehen soll, bleibt vage, weil bereits der relationalen Bestimmung als ›Widerspruch‹ ein Kategorienfehler zugrunde liegt, der sich durch das Attribut ›dialektisch‹ nur verschleiern, aber nicht heilen lässt. ›Dialektik‹ wird, wie Christfried Lenz es zugespitzt formuliert hat, »zum bloß assoziativen Schlagwort«.[44]
4. Dialektische Figuren bilden das Agens der Dahlhaus’schen Erzählung; es bleibt immer spannend, pointiert und geistvoll. Eine Opposition treibt die andere hervor, ohne dass es zu einer letzten Synthese käme. Wie eingangs formuliert: Es gibt kein Happy End am Schluss, sondern nur die Schlüssigkeit des Erzählzusammenhangs als Ganzes. Möglicherweise folgt Dahlhaus’ Betonung von Oppositionen, Ambivalenzen und Heteronomien also nicht allein einem abwägenden Modus kategorialer Erkenntnis, sondern auch einer bestimmten narrativen Ästhetik: Die Stärken des Erzählers Dahlhaus aber markieren die Probleme seiner Musiktheorie.
Anmerkungen
Dahlhaus 2001a/GS3. | |
Lowinsky 1961. | |
Hamburger 1955. | |
Dahlhaus 2001a/GS3, 103. Die bisweilen fast tendenziöse Weise, in der Dahlhaus den teleologischen Charakter mancher Aussagen der von ihm referierten Autoren zuspitzt, scheint darauf abzuzielen, die Andersartigkeit seiner eigenen Konzeption umso deutlicher hervortreten zu lassen. | |
»The seeds of tonality began to sprout in the cadence.« (Lowinsky 1961, 15, zit. in Dahlhaus 2001a/GS3, 103) Lowinsky fährt fort: »the cadence grew to a phrase and evolved into an ostinato pattern, frottole and villancicos were at time composed over free variants of standard bass melodies.« (Lowinsky 1961, 15) | |
»Es scheint aber, als sei der Übergang vom sporadischen Gebrauch des Gebildes I-IV-V-I zum Bewußtsein der Modellfunktion eher als ›qualitativer Sprung‹ zu verstehen.« (Dahlhaus 2001a/GS3, 103) | |
Vgl. ebd., 103–108. | |
Dieses und das Folgezitat ebd., 86. | |
Ebd., 85. | |
Holtmeier 2009, 14. Vgl. dazu Froebe 2010, 225–229. | |
Renwick 1995, Kap. 3, »Invertible Counterpoint«, 79–108, insbes. 81. | |
Meeùs i.V. | |
Froebe 2010, 229. | |
Dahlhaus 2001a/GS3, 66. | |
Ebd., 270. | |
Ebd., 63. | |
Dieses und das Folgezitat bei Dahlhaus 2001b/GS2, 187. | |
Vgl. Dahlhaus 2001a/GS3, »Zur Dissonanzentechnik des frühen 17. Jahrhunderts«, 119–134, insbes. 131–134. | |
Ebd., 132. | |
Ebd., 131. | |
Ebd. | |
Ebd., 132. | |
Ebd., 131. | |
Dahlhaus 2001b/GS3, 435. | |
Dahlhaus 2001a/GS2, 181. Beide Beispiele nehmen Intervallsatzmodelle in Anspruch, wobei die (leittönig) diminuierte 3-6-Gegenbewegung bei Beethoven zur Artikulation traditioneller Tonalität beiträgt, die 7-6-Konsekutive bei Wagner hingegen nicht. Aus dem Umstand, dass das Intervallsatzmodell bei Wagner keinen tonalen Nahkontext konstituiert (und in dieser Hinsicht ›afunktional‹ gebraucht wird), zieht Dahlhaus den Umkehrschluss, für den musikalischen bzw. tonalen (und in diesem Sinne ›funktionalen‹) Zusammenhang bei Beethoven könnten das Intervallsatzmodell und der chromatische Bass nicht »essentiell« sein; dieser gründe vielmehr in den »Funktionen der einzelnen Akkorde« (ebd.). Offenkundig ist das Wagner’sche Beispiel als Kontrastfolie gewählt, um dieser Behauptung Plausibilität zu verleihen. Die Annahme aber, ›Intervallsatzprogression‹ (Technik) und ›Akkordfunktion‹ (Bedeutung) lägen auf einer kategorialen Ebene und könnten dementsprechend miteinander konkurrieren, erscheint fragwürdig. Bestenfalls stellt die funktionsharmonische Interpretation eine von mehreren Möglichkeiten dar, das lineare Intervallsatzmodell kadenziell zu segmentieren. Vgl. aus einer Perspektive historisch informierter Musiktheorie Diergarten 2010, insbes. 147, aus schenkerianischer Perspektive Federhofer 1981, 140–45. | |
Dahlhaus 2001b/GS3, 437. | |
Dahlhaus 2001a/GS3, 66. | |
Vgl. u.a. Dahlhaus 2001c/GS3. | |
Dahlhaus 2001b/GS3, 437. | |
Dahlhaus 2001c/GS3, 596. Der vollständige Kommentar lautet: »Das Schema, das den Takten 57–62 des Ricercars a 6 aus dem Musikalischen Opfer zugrunde liegt, ist eine aufsteigende Sequenz. Die Gegenbewegung der Oberstimmen ist kein ›primärer Bewegungszug‹, sondern erscheint satztechnisch als Resultat von Oktavversetzungen einzelner Töne des Schemas. Oder genauer: Das Sequenzschema und die ›Bewegungszüge‹ bilden einen Zusammenhang, der zwar auseinandergelegt werden kann, dessen Dialektik aber keine sinnvolle Unterscheidung zwischen ›primären‹ und ›sekundären‹ Momenten zuläßt.« | |
Dahlhaus 2001a/GS3, 139. | |
Dahlhaus 2001c/GS3, 596. | |
Dahlhaus 2001b/GS3, 436. | |
Dahlhaus 2001a/GS3, 23. | |
Dahlhaus 2001c/GS3, 599. | |
Ein weiteres Moment in Dahlhaus’ Satz lädt zu Deutungen ein: In der Entgegensetzung der »Tradition des neutralen Intervallgefüges« und des »Anspruch[es] der tonalen Harmonik« schwingt die Vorstellung eines historischen Ablösungsprozesses mit, in dem ein ›noch‹ und ein ›schon‹ einander (irgendwie) überlagern. Doch wird der Gedanke von Dahlhaus weder hier noch andernorts bis in seine Konsequenzen verfolgt, und es scheint, als solle vielmehr akzentuiert werden, dass Bachs Musik der historische Ort ist, an dem sich ein innerer Widerspruch zuspitzt und offenbart, der tonaler Musik notwendig innewohnt. | |
Lenz 1970, 13. | |
Dahlhaus 2001c/GS2, 281. | |
Dahlhaus 2001b/GS3, 436. | |
Dahlhaus 2001d/GS2, 288: »Mit dem Vorurteil der funktionalen Lückenlosigkeit hängt das der ununterbrochenen Präsenz eng zusammen.« | |
Ebd., 287: »Analytiker, die ein musikalisches Werk als Funktionszusammenhang beschreiben, tendieren unwillkürlich zu einem methodischen Axiom oder Vorurteil, das man als das Postulat lückenloser Funktionalität bezeichnen kann: […].« | |
»Die Differenzierung in ›Stufe‹ und ›Stimmführung‹ erscheint in manchen Analysen Schenkers als Antithese, in anderen als Skala von Graden der Stufenbedeutung. Und der musikalischen Wirklichkeit wird nur die zweite Auslegung gerecht, die es zuläßt, schwächere und prägnantere Stufencharaktere oder deutlichere und blassere Wirkungen der Stimmführung voneinander abzuheben.« (Dahlhaus 2001a/GS2, 181) | |
»In Bachs chromatischem Kontrapunkt aber gerät die Tradition des neutralen Intervallgefüges in Konflikt mit dem Anspruch der tonalen Harmonik, die Satztechnik zu ›fundieren‹ – in einen Konflikt allerdings, der nicht als toter, sondern als dialektischer Widerspruch begriffen werden muß.« (Dahlhaus 2001c/GS3, 599) | |
Lenz 1970, 13, Anm. 2. |
Literatur
Berardi, Angelo (1687) Documenti Armonici (= BMB II/40a), Bologna: Monti, Reprint Bologna: Forni 1970.
Dahlhaus, Carl (2001/GS2), Allgemeine Theorie der Musik II. Kritik – Musiktheorie / Opern- und Librettotheorie – Musikwissenschaft (= Gesammelte Schriften 2), hg. von Hermann Danuser in Verbindung mit Hans-Joachim Hinrichsen und Tobias Plebuch, Laaber: Laaber.
––– (2001a/GS2), »Harmonie und Harmonietypen«, in: ––– 2001/GS2, 173–186 [Erstdruck in: Studium Generale 19 (1966), 51–58].
––– (2001b/GS2), »Über den Begriff der tonalen Funktion«, in: ––– 2001/GS2, 187–196 [Erstdruck in: Beiträge zur Musiktheorie des 19. Jahrhunderts (= Studien zur Musik des 19. Jahrhunderts 4), hg. von Martin Vogel, Regensburg: Bosse 1966, 93–102].
––– (2001c/GS2), »Terminologisches zum Begriff der harmonischen Funktion«, in: ––– 2001/GS2, 276–283 [Erstdruck in: Die Musikforschung 28 (1975), 107–202].
––– (2001d/GS2), »Zur Theorie der musikalischen Form«, in: ––– 2001/GS2, 287–300 [Erstdruck in: Archiv für Musikwissenschaft 34 (1977), 20–37].
––– (2001/GS3), Alte Musik. Musiktheorie bis zum 17. Jahrhundert – 18. Jahrhundert (= Gesammelte Schriften 3), hg. von Hermann Danuser in Verbindung mit Hans-Joachim Hinrichsen und Tobias Plebuch, Laaber: Laaber.
––– (2001a/GS3), »Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität« (= Saarbrücker Studien zur Musikwissenschaft 2), in: Dahlhaus 2001/GS3, 11–307 [Erstdruck: Kassel u.a.: Bärenreiter 1967].
––– (2001b/GS3), »Relationes harmonicae«, in: ––– 2001/GS3, 426–444 [Erstdruck in: Archiv für Musikwissenschaft 32 (1975), 208–227].
––– (2001c/GS3), »Bach und der ›lineare Kontrapunkt‹«, in: ––– 2001/GS3, 582–604 [Erstdruck in: Bach-Jahrbuch 49 (1962), 58–79].
Diergarten, Felix (2010), »›Ancilla Secundae‹. Akkord und Stimmführung in der Generalbass-Kompositionslehre«, in: Musik und ihre Theorien. Clemens Kühn zum 65. Geburtstag, hg. von Felix Diergarten, Ludwig Holtmeier, John Leigh und Edith Metzner, Dresden: Sandstein, 132–148.
Federhofer, Hellmut (1981): Akkord und Stimmführung in den musiktheoretischen Systemen von Hugo Riemann, Ernst Kurth und Heinrich Schenker (= Veröffentlichungen der Kommission für Musikforschung der österreichischen Akademie der Wissenschaften 21), Wien: VÖAW.
Froebe, Folker (2010), »Vom Tonsatz zum Partimento«, Rezension von: Giovanni Paisiello, Regole per bene accompagnare il partimento […] (= Praxis und Theorie des Partimentospiels 1), hg. von Ludwig Holtmeier, Johannes Menke und Felix Diergarten, Wilhelmshaven: Noetzel 2008, ZGMTH 7, 215–231. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/512.aspx
Hamburger, Povl (1955), Subdominante und Wechseldominante. Eine entwicklungsgeschichtliche Untersuchung, Dissertation, dt. Ausgabe, Wiesbaden: A. Busck.
Holtmeier, Ludwig (2009), »Zum Tonalitätsbegriff der Oktavregel«, in: Systeme der Musiktheorie, hg. von Clemens Kühn und John Leigh, Dresden: Sandstein, 7–19.
Lenz, Christfried (1970), Studien zur Satztechnik Bachs. Untersuchung einiger vom Erscheinungsbild der Vokalpolyphonie geprägter Kompositionen, Dissertation, Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg.
Lowinsky, Edward E. (1961), Tonality and Atonality in Sixteenth-Century Music, Berkeley und Los Angeles: University of California Press.
Meeùs, Nicolas (i.V.), »Fundamental Line(s)«, in: Schenkerian Analysis – Analyse nach Heinrich Schenker. Bericht über den internationalen Schenker-Kongress in Berlin, Sauen und Mannheim, 4.–12. Juni 2004, hg. von Oliver Schwab-Felisch, Michael Polth und Hartmut Fladt, 2 Bde., Hildesheim u.a.: Olms. Vorabveröffentlichung: http://nicolas.meeus.free.fr/Theorie/FundamentalLines.pdf
Renwick, William (1995), Analyzing Fugue: A Schenkerian Approach, New York: Pendragon Press.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.