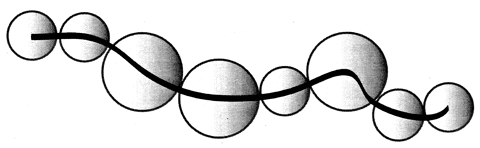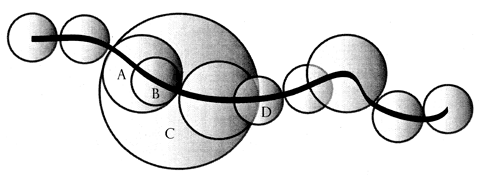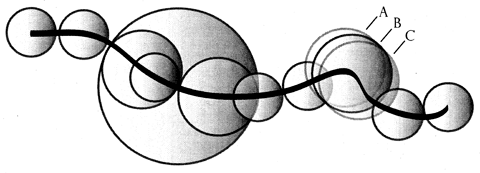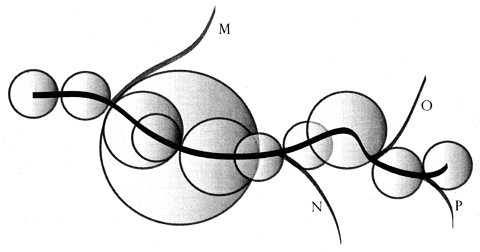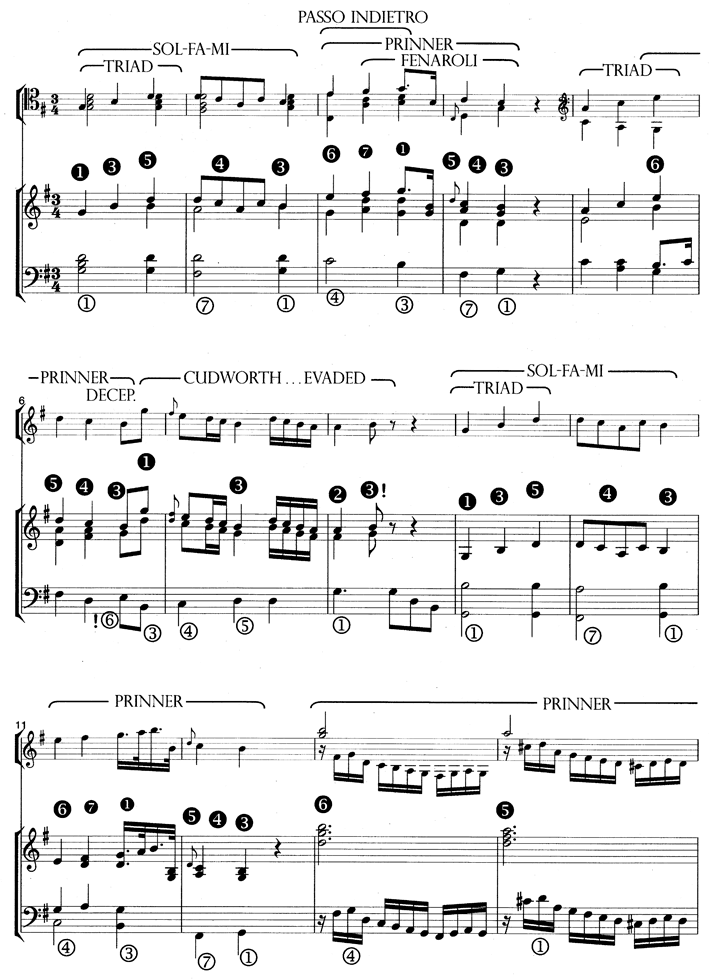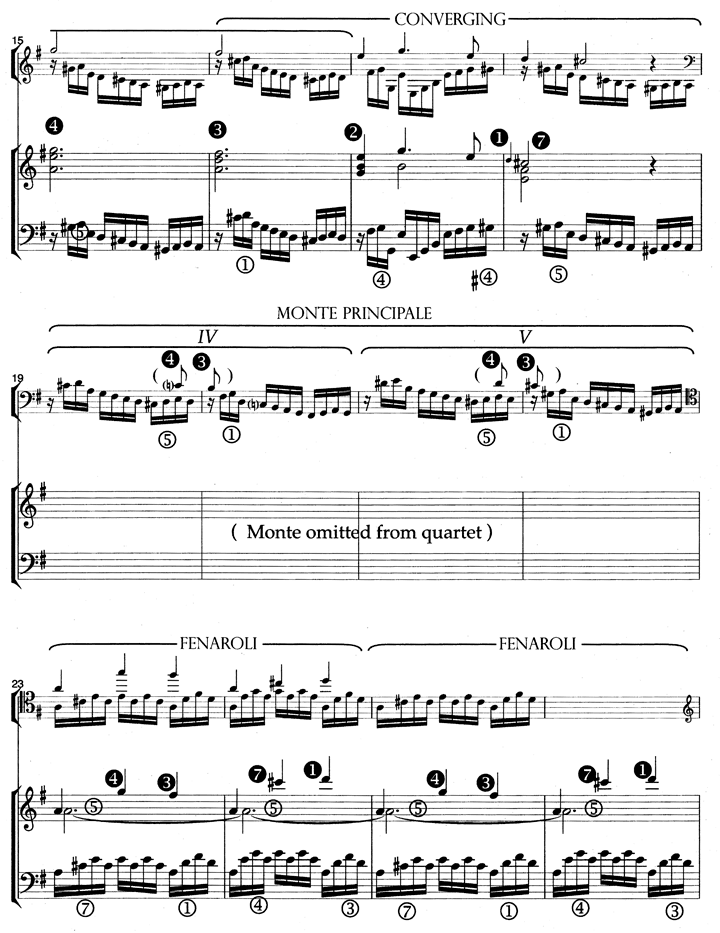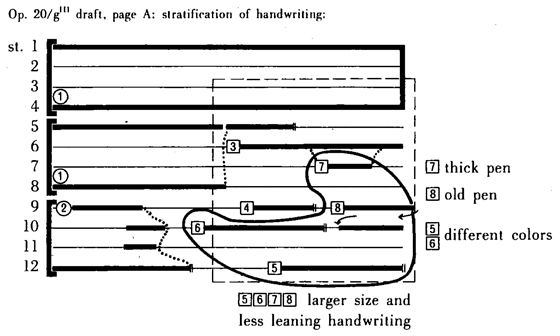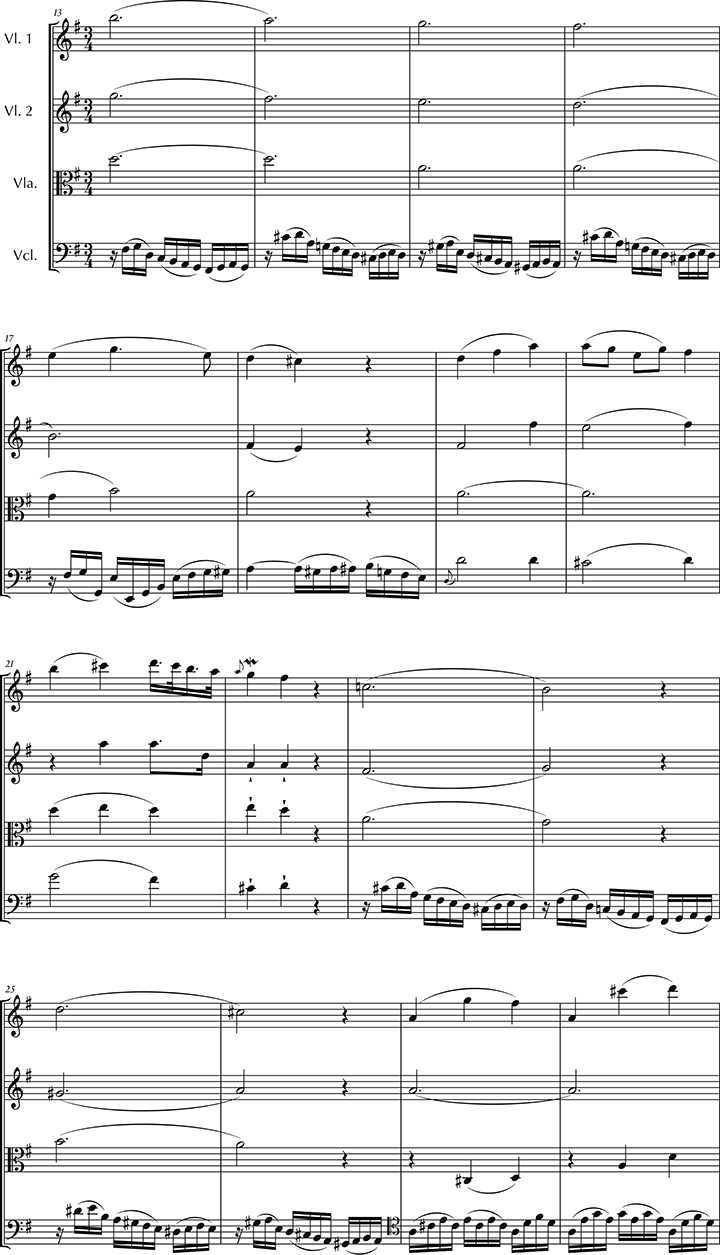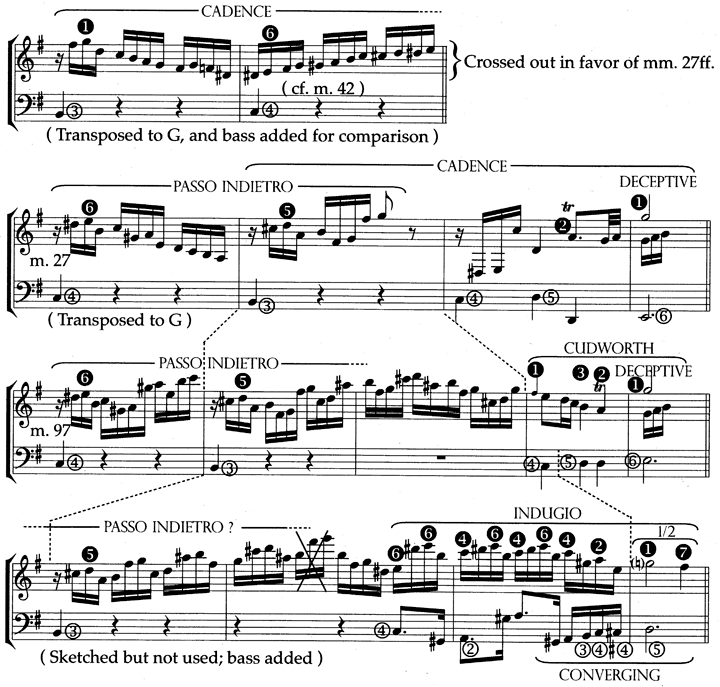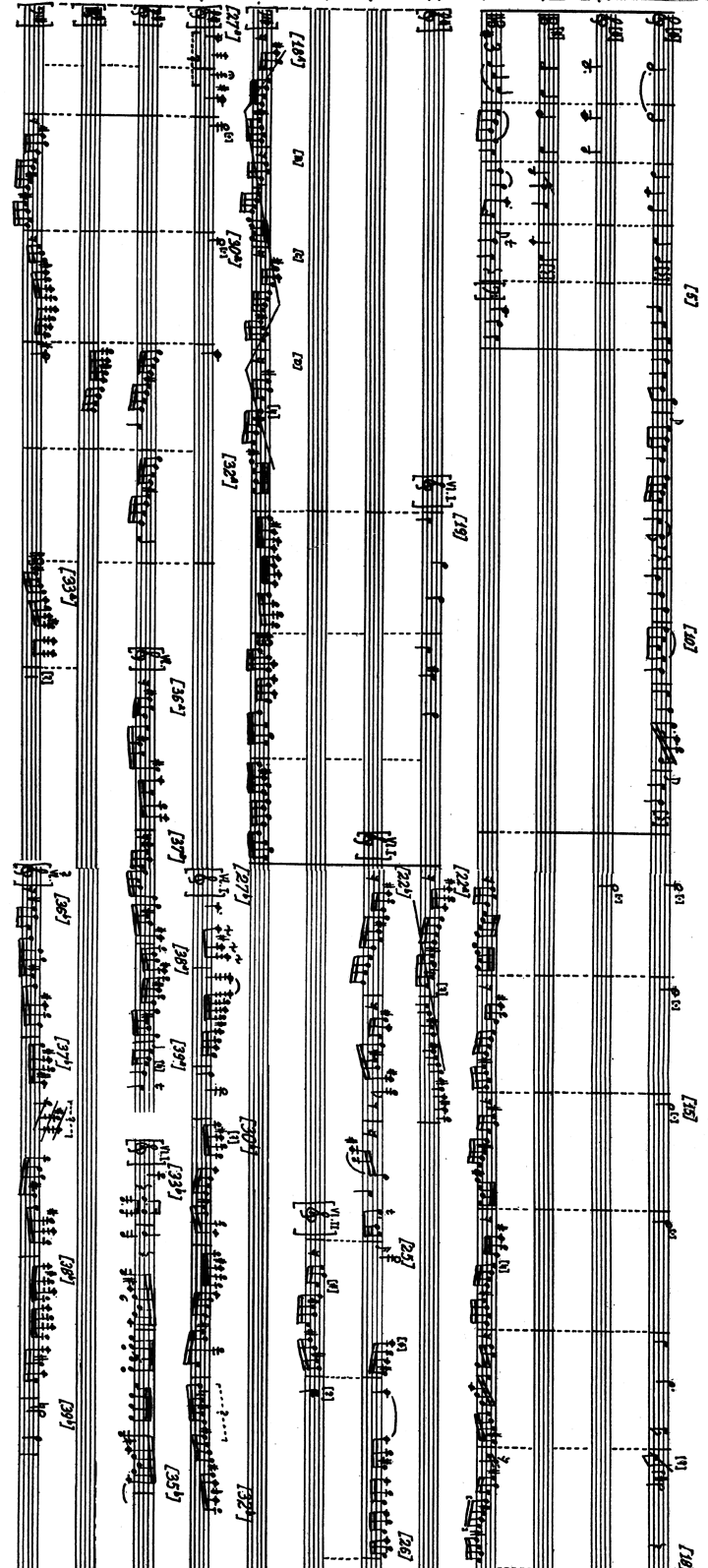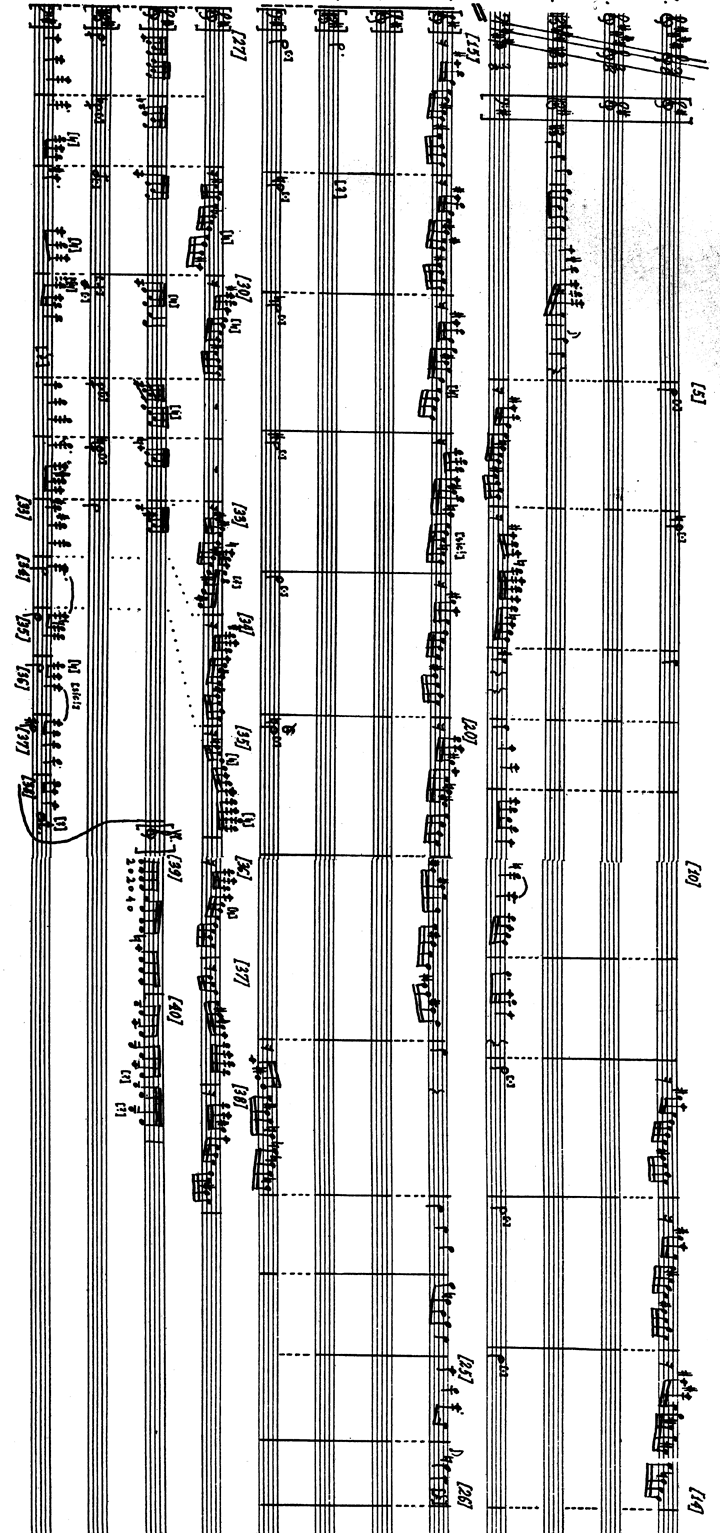Schemata und Systemcharakter
Stefan Rohringer
Anknüpfend an Überlegungen der Philosophen Michael Esfeld und Martin Seel wird zunächst dargestellt, inwiefern sich musikanalytische Diskurse und musikalische Werke als Systeme beschreiben lassen. Vor diesem Hintergrund wird im Anschluss der Status von Schemata in der Schema Theory diskutiert und mit dem der ›Figuren‹ in der Schenkeranalytik verglichen. Das Ende des Beitrags bildet die Kritik einer Analyse, die Robert O. Gjerdingen zu den Skizzen von Joseph Haydns Hob. III: 33, iii in Music in the Galant Style vorgelegt hat.
Following the arguments of the philosophers Michael Esfeld and Martin Seel it is first shown how music-analytical discourses and musical works can be described as systems. Against this background the status of schemata within Schema Theory is discussed and compared with the analytical ‘Figuren’ of Schenkerian Analysis. Finally, Robert O. Gjerdingen’s analysis of the sketches of Joseph Haydn’s Hob. III: 33, iii in Music in the Galant Style is critically evaluated.
Systemcharakter – Kommunikationszusammenhang und musikalisches Werk
Systeme bestehen aus Teilen. Von einem System kann gesprochen werden, wenn seine Teile nicht nur eine bloße Ansammlung sind, sondern ein »geeignetes Arrangement«[1] eingehen, in dem sie Konstituenten des Systems sind. Konstituenten teilen bestimmte qualitative Eigenschaften, durch die das System als Ganzes charakterisiert ist: Ein soziales System beispielsweise bedarf sozialer Wesen, d.h. denkender und handelnder Menschen, die aufeinander bezogen reagieren und agieren.[2] Im Teilsystem ›Rhythmik und Metrik‹ des Systems ›Tonalität‹ sind Dauer und Gewicht diejenigen qualitativen Eigenschaften, die es als Ganzes charakterisieren und nach denen seine Teile aufeinander bezogen sind.
Systeme können atomistisch und/oder holistisch verfasst sein. Atomistisch ist ein System, wenn die Eigenschaften seiner Teile intrinsisch, d.h. unabhängig von der Existenz der übrigen Teile des Systems sind. Holistisch ist ein System, wenn seine Teile Eigenschaften aufweisen, die ihnen erst durch die Relation zukommen, in der sie zu anderen Teilen des Systems stehen. Auch hier handelt es sich um Eigenschaften der Teile selbst. Es wäre ein Missverständnis zu glauben, holistische Eigenschaften stünden, weil sie relationale Eigenschaften sind, quasi ›zwischen den Zeilen‹. Alle Eigenschaften, die ein System aufweist, gleichgültig ob es atomistisch oder holistisch verfasst ist, sind Eigenschaften seiner Teile.
Nicht jede durch Relation gewonnene Eigenschaft kann als holistisch gelten. Um triviale Konzeptionen von Holismus auszuschließen, müssen die relationalen Eigenschaften bedeutsam sein: In einem Sandhaufen sind die Teile durch intrinsische Eigenschaften verbunden, die den Sandhaufen als Ganzes charakterisieren. Trivial wäre es, zu behaupten, dass der Umstand, dass es Sandkörner gibt, die weiter links, rechts, oben, unten, vorne und hinten im Haufen zu liegen kommen, diesen holistische Eigenschaften zuwachsen ließen. Die Sandkörner im Sandhaufen gehen allein ein geeignetes Arrangement zu einem atomistischen System ein. Ebenso ist der Umstand, dass Töne oder Tongruppen in einer Melodie anderen Tönen oder Tongruppen nachfolgen oder vorausgehen, zwar eine relationale, aber noch keine holistische Eigenschaft.
Elsfeld[3] spricht in diesem Zusammenhang von einer ›generisch-ontologischen Abhängigkeit‹, in der die Teile eines holistischen Systems im Unterschied zu einem atomistischen System stehen. Damit ist keine kausale Abhängigkeit der Teile untereinander gemeint. Vielmehr wird in Anschluss an Simons[4] behauptet, dass es – am Beispiel des sozialen Holismus – »kein Individuum geben kann, ohne dass es irgendein anderes Individuum einer bestimmten Art gibt.«[5] Dies besagt, dass es ein Individuum sein muss (›ontologisch‹), nicht aber, dass es ein bestimmtes Individuum zu sein hat (›generisch‹). Sandkörner hingegen fordern nicht die Existenz anderer Sandkörner oder setzen sie zu ihrer eigenen Existenz voraus.
Die Differenz atomistisch/holistisch erlaubt es, einige Gemeinplätze der Musikanalyse zu hinterfragen: Die weite Teile des ›langen 19. Jahrhunderts‹ beherrschende Organismus-Metapher beispielsweise ist kein untrügliches Indiz für einen holistischen Ansatz: In einem (menschlichen) Organismus sind zwar die Organe – anders als die Teile eines Verbrennungsmotors – sämtlich einem Wachstumsprozess entsprungen, der als geeignetes Arrangement zu einem System führt. Gleichwohl besitzt im (menschlichen) Organismus kein Organ, nicht anders als jegliches Teil des Verbrennungsmotors, aufgrund eines anderen eine holistische Eigenschaft.[6]
Gängige Formen der motivisch-thematischen Analyse bemühen die Organismus-Metapher ebenso wie die Lehre Heinrich Schenkers. Gleichwohl führen die Relationen zwischen Figuren der Schenkeranalytik zu holistischen Eigenschaften eben dieser Figuren (wie weiter unten noch genauer ausgeführt werden wird), während dies für die Relationen zwischen motivisch-thematisch Gestalten nur in dem oben beschriebenen trivialen Sinne geltend gemacht werden könnte. Motivisch-thematische Analyse verfährt im Wesentlichen atomistisch. Dieser Sachverhalt ist unabhängig davon, inwieweit Ähnlichkeitsbeziehungen in beiden Verfahren eine Rolle spielen oder nicht und inwiefern die jeweilig zur Anwendung gebrachte Begrifflichkeit den Analysegegenstand extensional vollständig zu erfassen vermag. Die Bedeutsamkeit der relationalen Beziehungen als holistische beruht einzig darauf, dass Teile für einander eine Aufgabe bzw. einen Zweck erfüllen, d.h eine Funktion besitzen. Nach Auffassung der Schenkeranalytik werden Funktionen durch das Verfahren der Diminution gewährleistet, das komplexere Tongruppen aus einfacheren hervorgehen lässt.
* * *
Im Bereich der Semantik wird zwischen dem radikalen, partiellen und moderaten Holismus unterschieden:[7]
Ein radikaler Holismus besagt, dass alle Teile eines Systems wechselseitig in Beziehung zueinander stehen und ausschließlich Eigenschaften aufweisen, die auf diesen Beziehungen beruhen. Im Bereich der Sprache gäbe es dann keine Teile, z.B. einzelne Wörter oder Sätze, die ohne Verständnis des Ganzen, d.h. der Sprache in der Gesamtheit ihrer Ausprägungen, verstanden werden könnten. Anders gesagt: In einem radikal holistisch gedachten System gibt es alles oder nichts zu verstehen.
Dagegen kann geltend gemacht werden, dass es unmöglich ist, die Grenze des Ganzen zu bestimmen. Sie liegt im Unendlichen und ist für die Praxis des einzelnen Sprachsubjektes unerreichbar. Vermag aber das Verständnis das Ganze niemals zu umfassen, so folglich auch nicht seine Teile.
Als eine mögliche Antwort auf diesen Einwand hat Martin Seel unter Rekurs auf Robert B. Brandom[8] einen partiellen Holismus ins Spiel gebracht, diesen aber ebenfalls kritisch hinterfragt. Seel zufolge könnte man geneigt sein, den Schwierigkeiten eines radikalen Holismus dadurch zu begegnen, das Ganze willkürlich zu begrenzen:
Anstatt zu sagen, daß alles verstanden werden muß, um etwas zu verstehen, könnte man vorsichtiger sagen, daß einiges verstanden werden muß, damit etwas verstanden wird. Etwas weniger vorsichtig könnte es heißen, daß vieles verstanden werden muß, damit überhaupt eines verstanden werden kann.[9]
Seel zufolge werden die Probleme des radikalen Holismus dadurch aber wird nicht gelöst. Denn ebenso wie die Grenzen des Ganzes lassen sich auch die Grenzen eines partiellen Ganzen nicht bestimmen:
Jede vermeintliche Grenze, jedes vermeintliche Ende ihrer Verknüpfungen kann jederzeit überschritten werden. Die Folgerungen, durch die Begriffe und Überzeugungen miteinander verbunden sind oder verbunden sein können, kennen weder ein Ende noch Grenzen.[10]
Daher ist als ›dritter Weg‹ zwischen einem radikalen und einem partiellen Holismus von Seel ein moderater Holismus, ein ›Holismus ohne Ganzes‹ vorgeschlagen worden. Für den semantischen Holismus heißt das: Nicht alle anderen, sondern unbestimmt viele andere Sätze ermöglichen es, einen Satz zu verstehen. Seel variiert einen Gedanken Esfelds[11], der auf Kant zurückgeht:[12]
Holistische Beziehungen – und mit ihnen das, was verstanden werden muß, wenn etwas verstanden werden soll – reichen nicht ad infinitum, sondern lediglich ad indefinitum. […] da es eine kommunikative Praxis ist, in der Ausdrücke und Überzeugungen ihren Inhalt erhalten, erweist sich auch die Reichweite ihrer Bestimmtheit als eine letztlich praktische Frage. […] Einen bestimmten Gehalt haben unsere Gedanken vor dem Hintergrund einer unbestimmt weiten Verbindung mit anderen Gedanken und mit den Gedanken anderer. Das genügt. Und wie schon Wilhelm von Humboldt bemerkte – allein das macht unser einsames wie gemeinsames Reden interessant.[13]
Ein ›Holismus ohne Ganzes‹ gibt keine Entscheidung darüber vor, welche Reichweite den Relationen zwischen den Teilen zugebilligt werden soll. Er überantwortet diese Frage an den Diskurs:
Der Stellenwert, den die jeweiligen Einheiten untereinander haben und gewinnen, ist gebunden an jenen, den die Verwender dieser Einheiten untereinander haben und gewinnen. Andere oder auch sich selbst zu verstehen, bedeutet, sich auf diese Verhältnisse zu verstehen.[14]
Versucht man die obige Diskussion aus der Semantik für die musikalische Analyse fruchtbar zu machen, so zeigt sich, dass, anders als in der Wortsprache, wo gemeinhin Konsens darüber besteht, welche Einheiten durch Signifikanten wie ›Wort‹ oder ›Satz‹ bezeichnet und welche Signifikate damit aufgerufen werden, in der Musik erst durch die Wahl des jeweiligen theoretischen Ansatzes überhaupt festgelegt wird, was ein konstitutiver Teil eines Werkes ist. Zumindest im Bereich der tonalen Musik begnügt sich kein Ansatz damit, bereits den Einzelton als konstitutiven Teil eines Werkes zu begreifen. Töne werden immer gruppiert, sei es rhythmisch-metrisch, motivisch-thematisch, harmonisch oder melodisch-diastematisch. Dabei wird extensional umfassend, aber notwendig intensional partikular verfahren.[15] Oder um es in Anlehnung an Markus Gabriel zu sagen: Das Werk gibt es nicht. Sind ›Sinnfelder‹ der Ort, an dem überhaupt etwas erscheint[16], dann ist es gerade deren notwendige ›Provinzialität‹, die es ermöglicht, im jeweils gewählten Sinnfeld einen Begriff vom Werk als Ganzes zu geben und seinen Systemcharakter zu erweisen. Bei der Frage, welche Menge an »Begriffe[n] und Überzeugungen« für das Verstehen der Eigenschaften der jeweils angenommenen Teile als hinreichend erachtet wird, tun alle musikanalytischen Konzeptionen gut daran, der Maxime eines moderaten Holismus zu folgen.
An zusätzlicher Komplexität gewinnt die musikanalytische Debatte aber nicht allein durch die Vervielfältigung möglicher systemischer Kommunikationszusammenhänge (einschließlich der ggf. zwischen ihnen erfolgenden Resonanzen), sondern auch durch die Reflexion des Systemcharakters der Werke selbst.
Systemcharakter und musikalisches Werk – Schema Theory und Schenkeranalytik im Vergleich
Hinsichtlich der Qualität der Systemeigenschaften könnte die These vertreten werden, Musik weise jenseits der quantifizierbaren Parameter des Einzeltons (Dauer, Tonhöhe, Dynamik und Klangfarbe) keine intrinsischen Eigenschaften auf. Dem scheint zu entsprechen, dass bereits ein Intervall als Verbindung zweier Töne eine Relation darstellt. Doch muss unterschieden werden zwischen der Eigenschaft, ein Ton in einem bestimmten intervallischen Verhältnis zu einem anderen Ton zu sein (dabei kann offen bleiben, ob diese relationale Eigenschaft bereits als eine holistische gelten darf), und der Eigenschaft ›Intervallklang‹. Obgleich letzterer eine emergente Eigenschaft ist, die aus der Relation zweier Töne hervorgeht, erschiene es absurd, einem der beiden Töne, die das Intervall konstituieren, die Eigenschaft ›Intervallklang‹ zuordnen zu wollen. Ein Intervall ist mit Blick auf seine Klangeigenschaft ein irreduzibler Teil. Folglich darf seine Klangeigenschaft als intrinsisch gelten. Gleiches gilt für alle musikalischen Sachverhalte, die in unserer Tonvorstellung als unmittelbare Einheiten gegeben sind.[17]
Von einem Schema im Sinne der Schema Theory oder einer schenkerianischen Figur zu behaupten, sie besäßen eine intrinsische Klangeigenschaft, die der eines Intervalls vergleichbar sei, erschiene prekär. In diesem Zusammenhang sei eine weitere Differenzierung Esfelds aufgegriffen, der entgegen der metaphysischen Tradition intrinsisch-essentielle und holistisch-essentielle Eigenschaften unterscheidet:
Die essentiellen Eigenschaften eines Elements sind diejenigen Eigenschaften, die dieses Element notwendigerweise hat. Diese Eigenschaften sind die Essenz des betreffenden Elements. Das Element kann nicht existieren, ohne diese Eigenschaften zu haben. Essentielle Eigenschaften werden normalerweise für intrinsisch gehalten: seine essentiellen Eigenschaften hat ein Element unabhängig davon, ob es andere Elemente gibt oder nicht gibt. Die Pointe des Holismus könnte sein, dass im Falle mancher Elemente einige essentielle Eigenschaften relational sind.[18]
Im Falle der Schemata der Schema Theory und der schenkerianischen Figuren handelt es sich bei den strukturell indizierten Teilen immer um solche, die zu ihren essentiellen Eigenschaften auch intrinische zählen. Diese können intrinsisch genannt werden, auch wenn sie aus ggf. mehrstelligen Positionen bestehen, die spezifische Relationen implizieren: Um von einem ›Meyer‹ sprechen zu können, braucht es (mit Blick auf den melodischen Verlauf) die Bewegung ›fallende kleine Sekunde - steigende verminderte Quinte - fallende Sekunde‹, um von einem Quintzug sprechen zu können, eine Reihe von fünf stufenweise aufeinander folgenden diatonischen Tönen. Sowohl für den ›Meyer‹ als auch den Quintzug ist es aber ebenso essentiell, holistische Eigenschaften zu besitzen. Diese Systemeigenschaften sind die holistischen Eigenschaften ihrer jeweiligen Teile: Im Falle des ›Meyer‹ ist dies (mit Blick auf den melodischen Verlauf) die Eigenschaft der vier diastematischen Strukturtöne, bezüglich der lokal tonartlich maßgeblichen Skala in einer 1-7-4-3-Folge bestimmte Positionen einzunehmen; im Falle des Quintzuges ist dies die Eigenschaft, erster, zweiter, dritter, vierter oder fünfter Ton eines Quintzuges zu sein.
Im Hören von Schemata und schenkerianischen Figuren durchdringen sich intrinsische und holistische Eigenschaften gegenseitig. Zwar hat Markus Neuwirth mit Blick auf Robert O. Gjerdingens Music in the Galant Style[19] den Anti-Essenzialismus der Schema Theory zu betonen versucht:
Unter einem musikalischen Schema versteht Gjerdingen eine netzwerkartige Struktur, die sich aus zentralen und peripheren Elementen zusammensetzt. Ein grundlegendes Kennzeichen der Schematheorie ist ihr Anti-Essenzialismus: Um ein Phänomen als Exemplar (›Instantiierung‹) eines spezifischen Schemas ausweisen zu können, müssen nicht zwingend bestimmte definitorische Kriterien (d.h. starre Merkmale oder Merkmalskombinationen) erfüllt sein. Vielmehr wird das besagte Phänomen als mehr oder weniger typische Instanz eines abstrakten Schemas beurteilt.[20]
Aber abgesehen davon, dass Neuwirth hier offenbar ›essentiell‹ mit ›intrinsisch‹ gleichsetzt, gibt er selbst bereits zu bedenken:
Im »Appendix A« ist er [Gjerdingen] aus theoriedidaktischen Gründen schließlich doch dazu gezwungen, die Schemata auf ihre prototypische Essenz (d.h. die Merkmale, die statistisch am häufigsten auftreten) zu fixieren.[21]
Grundsätzlich teile ich Neuwirths Einschätzung, denke aber, dass der von ihm bemerkte Widerspruch nicht »theoriedidaktische Gründe« hat, sondern in der Sache selbst liegt. Ein Schema mag essentiell auch durch holistische Eigenschaften als jeweiliges Schema bestimmt sein, doch kann die Bestimmung eines Teils nicht auf intrinsische Eigenschaften verzichten. Nur solchen Teilen nämlich, die als musikalische Entitäten durch intrinsische Eigenschaften konstituiert sind, können auch holistische Eigenschaften zuwachsen. Genau hierauf reagiert Gjerdingens Unterscheidung zwischen »zentralen und peripheren Elementen«. Insofern besteht auch kein prinzipieller Unterschied zum Figurenkatalog der Schenkeranalytik: Gjerdingens ›periphere‹ Schema-Eigenschaften betreffen zumeist Rhythmik und Metrik, mithin Kategorien, die in der Schenkeranalytik zu den harmonischen und/oder kontrapunktischen Figuren ggf. erst in einem weiteren Schritt hinzutreten.
Zunächst scheinen Schema Theory und Schenkeranalytik im Hinblick auf die Frage, welchen Systemcharakter musikalische Werke haben, einander zu ähneln. Jenseits basaler Schemata zeigen sich jedoch relevante Differenzen zwischen der Schema Theory und einem holistischem Theoriedesign:
Für alle musikanalytischen Ansätze gilt, dass die Teile, die sie im jeweiligen Werk vorzufinden vermuten, vorgängig sind, egal ob als Akkorde, spezifische Tonfelder, als Satzmodelle der Partimento-Tradition, als schenkerianische Figuren oder als Schemata der Schema Theory. Während Esfeld mit Recht postuliert, dass die Abhängigkeit zwischen den einzelnen Individuen sozialer Gemeinschaften keine kausale, sondern eine ontologisch-generische sei, kann zwischen den in musikanalytischen Ansätzen unterschiedenen Teilen durchaus auch eine kausale Abhängigkeit bestehen. Dies ist der Fall, wenn die Bestimmung der Teile im Stück nur mit Blick auf die Bestimmung anderer Teile zu erfolgen vermag. Entsprechendes gilt für die Schenkeranalytik: Die in einem Werk postulierten Figuren einer Schicht fordern nicht nur andere Figuren oder setzen diese voraus (›ontologisch-generisch‹), sondern fordern bestimmte Figuren oder setzen diese voraus (›kausal‹). Wer eine Folge von vier stufenweise fallenden Tönen auf einer Schicht segmentiert, hat damit zwar noch nicht entschieden, ob es sich um einen Quartzug oder die Ausfaltung zweier paralleler Terzen handelt. Doch ergeht die Entscheidung darüber in Zusammenhang mit der nächst ›früheren‹ Schicht, was wiederum bedeutet: in Zusammenhang mit den dort postulierten Figuren, wobei den spezifischen Regeln der Schenkeranalytik Folge zu leisten ist, durch welche Figuren aufeinander bezogen werden.
Die Schema Theory zeichnet sich demgegenüber gerade dadurch aus, dass Schemata einander nicht fordern, Kausalität zwischen ihnen nicht vorliegt. Gjerdingen unterscheidet, wie diverse Schaubilder in Music in the Galant Style deutlich machen, vier verschiedene Fällen von Schema-Folgen (Bsp. 1–4):
Beispiel 1–4, Gjerdingen 2007, 376, 378–379, Fig. 27.4: A string of schemata – il filo; Fig. 27.5: A string of nested and overlapping schemata; Fig. 27.6: A cluster of three associated schemata A, B, C; Fig. 27.7: Alternative paths M, N, O, P;
»A string of schemata – il filo«, eine ausschließlich aus disjunkten Verbindungen diverser Schemata bestehende Folge (Fig. 27.4)[22],
»A string of nested and overlapping schemata«, eine sowohl konjunkte Verbindungen benachbarter Schemata (›overlapping‹), als auch deren Subordination bis zu einer Tiefe von drei Schemata und eine Beiordnung von zwei Schemata unter einem übergeordneten Schema miteinschließende Folge (Fig. 27.5)[23],
»A cluster of three associated schemata, A, B, C«, ein Spezialfall von ›overlapping‹, bei dem sich die benachbarten Schemata nahezu vollständig überlagern[24], und
»Alternative paths M, N, O, P«, eine fakultative Möglichkeit, die zu allen Folgen von Schemata hinzutreten kann: bestimmte Schemata motivieren eine Expektanz, die der weitere Verlauf nicht einlöst.[25]
Der vermeintlich letzte Fall (›alternative paths‹) ist dieser Aufstellung systematisch nicht zugehörig, weil hier keine Form der Verknüpfung gezeigt wird. Der zweite Fall zerfällt in zwei prinzipiell verschiedene Fälle: Die Subordination von Schemata (›nested schemata‹) impliziert die Subordination diverser Ebenen, während das bloße Überlappen von Schemata (›overlapping schemata‹) in einer Ebene verbleibt. Der dritte Fall ist nicht eigenständig: Er unterscheidet sich von dem bereits rubrizierten Überlappen nur durch einen höheren Überlappungsgrad. Die disjunkte Verbindung diverser Schemata, also die erste Verknüpfungsform, kann als der Regelfall gelten.
Beispiel 5: Gjerdingen 2007, 386, Example 27.7 (Ausschnitt): Joseph Haydn, Streichquartett Hob. III: 33, iii, Skizze, Original und Schema-Analyse, T. 1–14
Gjerdingens Klassifikation scheint bewusst indifferent gehalten. In Ex. 27.7 aus Music in the Galant Style indiziert Gjerdingen im ersten Vierer des wiedergegebenen Beispiels, dem Poco adagio aus Joseph Haydns Streichquartett Hob. III: 33, sowohl das Überlappen von Schemata, als auch ein Schemata-Nest (Bsp. 5). Im ersten Takt suggeriert Gjerdingens Legende, das Schema ›Triad‹ sei dem Schema ›Sol-Fa-Mi‹ subordiniert, obgleich das zweite Schema erst dort beginnt, wo das erste Schema endet. Bemerkenswert ist, dass Gjerdingen – anders als bei der Legende des zweiten Zweiers – darauf verzichtet, durch eine Differenzierung der Größen, mit der die melodischen Stufen angezeigt werden, auf die nachgeordnete Bedeutung des Schemas ›Triad‹ hinzuweisen. Dass durchaus eine andere Form der Darstellung möglich wäre, zeigt die Legende in Takt 5: Dort wird der Beginn des ›Prinners‹ mit dem letzten Ton der vorangehenden Dreiklangsbrechung angesetzt, ohne dass letztere mit melodischen Stufenzeichen versehen wäre.
Ironischerweise wirkt das jeweils unterschiedlichen Vorgehen nur aus der Perspektive der Schema Theory unmotiviert, nicht jedoch aus derjenigen der Schenkeranalytik: Mit Blick auf den eröffnenden Vierer spricht Vieles dafür, die Quinte als Kopfton zu hören, von der aus jeweils am Ende der beiden Zweier durch einen Gang in die Mittelstimme zur tonikalen Terz gelangt wird. In diesem Zusammenhang wäre das Schema ›Triad‹ in Takt 1 Teil der Etablierung des Kopftons (Brechung). Die sechste Melodiestufe zu Beginn des zweiten Zweiers hätte demnach als obere Wechselnote zum Kopfton zu gelten (5-6-5) – ein Charakteristikum der Quintzugmusik.[26] Das Schema ›Sol-Fa-Mi‹ entspräche dem ersten Gang in die Mittelstimme (5-4-3). Der ›Prinner‹ als Schema höchster Ordnung des zweiten Zweiers (6-5-4-3) wäre aus dieser Sicht eine effizierte Figur, bestehend aus der Vollendung der Wechselnote (6-5) und dem sich anschließenden zweiten Gang in die Mittelstimme (5-4-3). Dass in der realen Oberstimme kein ›Sol‹ erscheint, hätte als Ergebnis eines Ränderspiels zu gelten, in dem fis2 und g2 als übergreifende Töne über d2 erscheinen. Anders als in Takt 1, wo ausschließlich die I. Stufe prolongiert wird, geht in Takt 5 mit dem abschließenden Dreiklangston auch ein Harmoniewechsel einher (II-VI). In Verbindung mit dem Folgenden zeigt sich, dass die vermeintliche Terz c2 strukturell führend ist – als Vier eines auf g1 zielenden Quintzuges (dessen Abschluss in Takt 8 durch Imperfizierung absichtsvoll verfehlt wird, wodurch der Quintzug nicht zustande kommt). Der ›Prinner‹ wäre demnach ein Übergreifzug, der auf die Drei des erwarteten Quintzuges führt. Gjerdingens Legende deutet an, dass nicht jede ›Dreiklangsfolge‹ als musikalische Entität wahrgenommen wird. Die Schenkeranalytik kann erklären, warum.
Schenkerianische Figuren zeichnen sich durch eine klare Umgrenzung aus. Eben deshalb vermögen sie zwischen zwei Punkten im melodischen oder harmonischen Raum zu vermitteln, von denen einer oder beide der nächst ›früheren‹ Schicht angehören. Schenkerianische Figuren verlieren sich nicht im Ungefähren oder lösen sich auf. Ist es nicht möglich, eine Figur aufgrund mangelnder Kontingenz abzuschließen, kann die Lösung nur durch eine andere Figur oder das Zusammenspiel mehrerer Figuren gewährt werden. Das wiederum bedeutet nicht, dass es im Rahmen der Schenkeranalytik nicht möglich wäre, das Expektanzverhalten potentieller Hörer zu reflektieren (vgl. die obigen Überlegungen zu dem in den Takten 1–8 erwarteten Ursatzparallelismus). Nur hätte dies dadurch zu geschehen, dass den putativen Figuren die tatsächlich eintretenden gegenüber zu stellen wären. Letzteren Fall gibt es freilich auch in der Schema Theory (vgl. Ex. 27.7, T. 7–8: ›Cudworth … Evaded‹). Häufiger in Gjerdingens Analysen ist hingegen die partielle Kongruenz von Schemata. Sie ist nicht zuletzt dadurch bedingt, dass Schemata gemessen an den schenkerianischen Figuren bereits vergleichsweise komplexe Anordnungen darstellen, die untereinander eine Riege gleicher melodischer oder harmonischer Fortschreitungen teilen. Dies zeigt sich auch in Gjerdingens Analyse der Takte 3 und 4: Das Schema ›Passo indietro‹ steht – historisch gesprochen – für eine Altizans. Die Kadenzwendung hat die Funktion, den Gang vom Grundakkord der IV in den Sextakkord der I zu vermitteln. In diesem Sinne ist der ›Passo indietro‹ tatsächlich eine dem ›Prinner‹ subordinierte Figur. Anders verhält es sich aber zwischen ›Passo indietro‹ und ›Fenaroli‹: Der ›Fenaroli‹ besteht aus einer gleichmäßig alternierenden Folge von I und V, wobei durch Stimmtausch sowohl in Melodie- als auch korrespondierender Mittel- oder Bassstimme die Leittonauflösung in den Grundton erfolgt. Insofern die melodische Bewegung 7-1 gerne mit 4-3 und die melodische Bewegung 4-3 wiederum gerne mit 7-1 kontrapunktiert wird – das typische Tenor- oder Bass-Diskant-Gerüst –, impliziert der Gebrauch des ›Fenaroli‹ auch den des ›Passo indietro‹. Die Melodiebewegung 4-3 wiederum kann ›Anschluss‹ finden an ›Sol-Fa-Mi‹ oder – wie im vorliegenden Fall – an den ›Prinner‹.
Die Betrachtung der analytischen Aufbereitung des zweiten Zweiers durch Gjerdingen verdeutlicht, dass die Schema Theory zwischen den sogenannten ›nested schemata‹, die aus der Perspektive der Schenkeranalytik als Auskomponierung einzelner Schemata durch eine begrenzte Anzahl anderer Schemata verstanden werden können[27], und einer vollständigen Kongruenz einzelner Schemata als Mehrfachbestimmungen in einer Schicht nicht kategorial unterscheidet. Nur im ersten Fall sind Schemata einander subordiniert, im zweiten hingegen partizipieren sie an denselben stetig aufeinander folgenden Klangereignissen. Sie sind ›zugleich‹, ohne eine Funktion im Sinne der Diminution für einander wahrzunehmen.
Der entscheidende Unterschied zur Schenkeranalytik besteht demnach nicht darin, dass der Schema Theory der Gedanke der Subordination prinzipiell fremd wäre. Im Gegenteil: Der Gedanke der Subordination scheint geradezu von dort übernommen. Jedoch adaptiert die Schema Theory nicht auch das Schichtenmodell der Schenkeranalytik. In der Schema Theory ist die Schichtung einzelner Schemata ein lokal begrenztes Verfahren, durch das der ›Strang‹ der Schema-Folge interimistisch eine ›Verdickung‹ erfährt. So erklärt sich auch die eigentümliche Subsumierung von Schemata-Nestern und sich überlappenden Schemata in der zweiten Verknüpfungsregel. In der Schenkeranalytik hingegen sind Schichten räumlich und zeitlich stetig und die in ihnen verorteten Klangereignisse durchgehend gekoppelt.
Ferner hat das Close Reading der Analyse Gjerdingens gezeigt, dass unter dem Begriff Schema in der Schema Theory Muster firmieren, die höchst unterschiedlicher Provenienz und Komplexität sind: Das Schema ›Triad‹ als richtungsunabhängige Dreiklangsbrechung steht neben melodisch-harmonischen Progressionen mit unidirektionaler Richtung wie dem ›Prinner‹, Sequenzmodelle wie die ›Monte Principale‹ oder die ›Galant Romanesca‹ stehen neben Kadenzwendungen, die nur zwei oder Stationen oder sogar nur eine Station umfassen wie ›Passo indietro‹ oder ›Augmented 6th‹. Zudem werden als Schemata auch Formfunktionen verhandelt wie ›Opening Gambit‹ oder ›Riposte‹[28], die kategorial auf einer völlig anderen Ebene als satztechnische Vorgänge liegen und gar nicht wechselseitig füreinander einstehen können. Da der Gebrauch formfunktionaler Schemata in Gjerdingens Analysen nicht durchgängig erfolgt, stellt sich der Verdacht ein, sie dienten der Kompensation an solchen Stellen im Stückverlauf, wo die Zuordnung zu einem satztechnischen Schema bzw. einer Kombination diverser Schemata nicht recht gelingen will.
Der Eklektizismus der Kategorien, denen die Schemata entstammen, hat für den von der Schema Theory präsupponierten Systemcharakter der analysierten Werke gravierende Konsequenzen. Weder ist das Verhältnis zwischen den Schemata als den Teilen des Systems durch Kausalität bestimmt, noch durch jene ontologisch-generische Abhängigkeit, die Voraussetzung eines holistischen Systems ist.
Mit diesem Theoriedesign konvergiert der von der Schema Theory vorausgesetzte ›galante Hörer‹. In Echtzeit identifiziert er die jeweilige Abfolge der Schemata und goutiert eine variative Praxis, durch welche die Schemata in individuellen Werkzusammenhängen unterschiedlich instantiiert werden – etwa hinsichtlich Setzweisen, diminutiven Verfahren und begrenzten Alterationen diatonischer Stammtöne – sowie die Gabelungen, an denen unterschiedliche Expektanzen aufgebaut, bestätigt oder auch verweigert werden.
Für diesen Hörertypus ruft Gjerdingen zwei Zeugen auf: Zum einen Friedrich Melchior Baron Grimm, der einen Bericht vom Klavierspiel des jungen Wolfgang Amadé Mozart gibt, zum anderen den Vater des klavierspielenden Jungen, Leopold Mozart.
Grimm berichtet, der junge Mozart habe
eine ganze Stunde aus dem Kopfe spielen und sich einer Inspiration seines Genies hinge[ge]ben […], der die entzückendsten Ideen entspringen, die er mit Geschmack und ohne Verwirrung in einander zu verweben weiß.[29]
Freilich ist die Gleichsetzung der »Ideen«, von denen Grimm spricht, mit Schemata problematisch. Dasselbe gilt für die Rede vom ›filo‹, dem Faden in der brieflichen Äußerung Leopold Mozarts an seinen Sohn vom 13. August 1778:
Nur Kurz – leicht – popular. Rede mit einem Graveur, was er am liebstς haben möchte, – vielleicht leichte Quatro à 2 Violini Viola e Basso. glaubst du dich vielleicht durch solche Sachς herunter zu setzς? – keinesweegs! hat dan Bach in London iemals etwas anders, als derleÿ Kleinigkeitς herausgegebς? das Kleine ist Groß, wen es natürlich – flüssend und leicht geschriebς und gründlich gesetzt ist. Es so zu machς ist schwerer als alle die den meistς unverständliche Künstliche Harmonische progressionen, und schwer auszuführende Melodÿς. hat sich Bach dadurch heruntergesetzt? – – keineswegs! der gute Satz und die Ordnung, il filo – dieses unterscheidet den Meister vom Stümper auch in Kleinig=keiten.[30]
Gjerdingen zitiert aus diesem Abschnitt nur Leopolds ›Formel‹ »der gute Satz und die Ordnung, il filo«, um sie einer Äußerung Baldassare Galuppis an die Seite stellen zu können, der Charles Burney gegenüber von »vaghezza, chiarezza, e buona modulatione« als den Voraussetzungen eines gelungenen musikalischen Dramas gesprochen hatte, was dieser mit »beauty, clarity, and fine modulation« übersetzte.[31]
Nun ist es in der Forschung keineswegs unumstritten, wie viele Kategorien kompositorischen Denkens Leopold Mozarts ›Formel‹ umfasst. Gjerdingen selbst weist darauf hin, dass Emily Anderson, die erste Übersetzerin des Briefwechsels ins Englische, von deren drei ausgeht. Sie übersetzte mit »good composition, sound construction, il filo«.[32] Gjerdingen hingegen bezeichnet bereits die Unterscheidung zwischen ›Satz‹ und ›Ordnung‹ als »insufficiently distinct«, versucht aber gleichwohl eine Abgrenzung:[33]
In my view, Leopold’s use of Satz refers to the craft of musical composition, with all its rules and preferred procedures, while Ordnung refers to the choices made in the serial disposition of musical material.[34]
Mit Blick auf ›il filo‹ zieht Gjerdingen einen Vergleich mit der Mythologie:
Placing things in a suitable order creates the cognitive thread (il filo) that, like Ariadne’s thread which led Theseus through the labyrinth, guides the listener through a musical work.[35]
Es braucht hier nicht vertieft zu werden, inwiefern Gjerdingens Bild des Ariadnefadens Leopold Mozarts Äußerungen entspricht oder konterkariert. Mit Blick auf die späterhin von Gjerdingen bemühte Analogie zwischen der musikalischen Form und einer Perlenkette (›pearl necklace‹) wird man gut daran tun, dem Bild nicht allzu viel Bedeutung beizumessen. Wichtiger scheint Gjerdingens Hinweis auf »the cognitive thread«, der ›il filo‹ im Sinne einer Abfolge und Überlappung diverser Schemata und ihrer Instantiierungen interpretiert.
Bereits Alfred Einstein hatte in seiner Mozartmonographie auf die ›Formel‹ Leopold Mozarts Bezug genommen und mit Blick auf den Kopfsatz von Mozarts KV 332 geäußert:
Einfall folgt auf Einfall; […] Niemand wird ergründen können, wie in diesem Satz eine melodische Blüte der anderen sich zugesellt, und jeder wird ihre Natürlichkeit, Notwendigkeit, Gewachsenheit fühlen.[36]
Man muss Einsteins romantisierendes Mozartbild nicht teilen, um festzuhalten, dass auch das 18. Jahrhundert bereits zwischen dem in der Kunst Erlernbaren (›Metier‹) und dem Nicht-Erlernbaren (›Genie‹) differenzierte. Dem entspricht auch Joseph Haydns Unterscheidung zwischen ›Geschmack‹ und ›Compositionswissenschaft‹.[37] Mit ›Satz‹ und ›Ordnung‹ scheint, wie Gjerdingen zu Recht anmerkt, die »grammatische Beschaffenheit« (Heinrich Christoph Koch) der Komposition angesprochen zu sein, also dasjenige, was auch Gegenstand der Kompositionslehren der Zeit war. Demgegenüber stünde ›il filo‹ für die Kontinuität und Qualität der musikalischen Gedankenführung, die zwar auf guten Satz und gute Ordnung angewiesen ist, sich aber sich erst jenseits der Beherrschung alles Handwerklichen manifestiert. In diesem Zusammenhang erscheint Gjerdingens Gleichsetzung von ›il filo‹ mit einer Abfolge und Überlappung diverser Schemata und ihrer Instanzen (›cognitive thread‹) als eine nicht unproblematische Reduktion dessen, was Inhalt der musikalischen Gedankenführung sein kann.
Selbst wenn man Gjerdingen darin folgt, Leopold Mozart habe bei seiner Mahnung, den Publikumsgeschmack nicht außer Acht zu lassen, an den so genannten ›galanten Hörer‹ gedacht, verbieten sich Generalisierungen. Denn offensichtlich zog es der Sohn vor, sich in seinen Kompositionen einem anderen ›impliziten Hörer‹ verpflichtet zu sehen – einem Hörer, der die, in Leopold Mozarts abfälligen Worten, »Künstliche[n] Harmonische[n] progressionen, und schwer auszuführende Melodÿς« durchaus zu schätzen wusste. Die Uneinigkeit zwischen Vater und Sohn Mozart in Fragen des maßgeblichen Hörers spricht dafür, auch für die galante Zeit von unterschiedlichen Hörertypen auszugehen.[38]
Mit Blick auf das Verhältnis von Schemata und Systemcharakter ist die bereits erwähnte Rede Gjerdingens von der galanten Komposition als ›Perlenkette‹ aufschlussreich. Sie ist offenkundig vom Bild des ›Fadens‹ abgeleitet – Metapher, Gjerdingen im 27. Kapitel »Il Filo. A Poco Adagio by Joseph Haydn. Opus 20 (Hob. III/33), no. 3, mvt. 3, 1772« von Music in the Galant Style einführt.[39] In diesem Kapitel von zentraler Bedeutung führt Gjerdingen seine Konzeption musikalischer Form für die Musik in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aus. Es mündet in eine Diskussion von Haydns Skizzen zum dritten Satz Poco Adagio aus seinem Streichquartett Hob. III: 33 (op. 20/3, iii). Gjerdingen erläutert:
If il filo could be likened to a necklace of pearls, then Haydn’s sketches would resemble that necklace laid in a small jewel box. To better view the necklace one would first need to remove it from the box and stretch it out. That is what I have done with his sketches. I have taken Haydn’s for staves of fragmentary parts and aligned them, on a single staff where possible, in Haydn’s ordering.[40]
Die gewählte Metapher belegt, dass Gjerdingen letztlich einen atomistischen Systementwurf verfolgt. Die einzelnen Perlen der Kette stehen für die einzelnen Schemata der Komposition. Zum Systemcharakter einer Perlenkette gehört es, dass sie aus mehr oder weniger vielen Perlen bestehen kann, ohne dass dies die Eigenschaften der zur Kette verbundenen Perlen verändert. Die Perlen sind parataktisch gereiht. Sie unterhalten nur eine unmittelbare nachbarschaftliche Beziehung untereinander. Die Schema-Theorie kennt jenseits der Instantiierung der basalen Schemata keine Meta-Ebene, d.h. keine weiteren Schemata, durch die den basalen Schemata holistische Eigenschaften zuwachsen könnten.
In der Schenkeranalytik hingegen sind alle relevanten Eigenschaften, die Teilen zukommen, holistisch. So wird etwa für das Schema der Dur-Sonate regelmäßig eine Terzzugmusik mit Unterbrechung behauptet. Der Bereich der Nebentonart in der Exposition wird durch einen Quintzug unter der Zwei der Urlinie strukturell indiziert. In der Reprise erscheint der Quintzug an analoger formaler Position als Übergreifzug zur Finalis. ›Gang in die Mittelstimme‹ in der Exposition und ›Übergreifzug‹ in der Reprise sind die beiden unterschiedlichen holistischen Eigenschaften, die dem Teil ›Quintzug‹ im Mittelgrund zukommen. Im Vordergrund sind es die den Quintzug formierenden Töne, denen die holistische Qualität zukommt, erster, zweiter, dritter, vierter oder fünfter Ton eines Quintzuges zu sein. Einzeltöne sind so durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen Schichten mehrfach bestimmt.
Gleichwohl wird auch in der Schenkeranalytik zumeist nicht radikal holistisch verfahren. Dass auch in zyklischen Zusammenhängen Einzelsätze gemeinhin nicht anders behandelt werden als ›frei stehende‹ Einzelsätze – z.B. im Sonatenzyklus –, verdeckt eine Schwierigkeit, die bei der Betrachtung größerer Werkzusammenhänge manifest wird – die Schwierigkeit zu bestimmen, wie weit die Kontexte gefasst sein müssen, in die musikalische Abschnitte eingebettet werden, um einer holistischen Perspektivierung noch zu genügen. Auch in der Schenkeranalytik finden sich Ausführungen über Teile von Werken, die aus Sicht eines radikalen Holismus als fragwürdig zu gelten hätten.[41] Dieser partielle Holismus erscheint durch ein Schichtenmodell gerechtfertigt, dass es mit Blick auf spezifische Standards der figürlichen Verhältnisse als viabel erscheinen lässt, Teile eines Ganzen wie ein Ganzes zu behandeln: Wer unterschiedliche Formen der Gestaltung von Quintzügen unter der Zwei der Urlinie in Dur-Expositionen erörtert, unterstellt, dass sich im Hinblick auf das gesamte Stück allenfalls ihre Zuordnung innerhalb des Schichtenmodells verschiebt (in ›spätere‹ Schichten), nicht, dass die Ereignisse der Reprise die Annahme eines Quintzuges unter der Zwei der Urlinie grundsätzlich in Frage stellen können. Insofern erscheint die Reichweite der kausalen Abhängigkeit der Teile durchaus diskutabel.
Nicht anders verhält es sich mit der Reichweite der behaupteten Relationen. Gleichgültig, ob die Abhängigkeit zwischen den Teilen nur ontologisch-generisch oder auch kausal ist: Die Veränderung eines Teils müsste gemäß dem radikalen Holismus eine Veränderung der holistischen Eigenschaften aller übrigen Teile nach sich ziehen. Allerdings erscheint auch hier das Schichtenmodell nicht ohne Einfluss auf die Relevanz der Veränderungen:
Gesetzt den Fall, der besagte Quintzug entpuppt sich bei Betrachtung des gesamten Satzes als ›Abzweigung‹, die nicht von der Urlinie, sondern von einer Mittelstimme genommen wird (weil nicht die Terz, sondern die Quinte Kopfton des Satzes ist), so wird man eine Veränderung seiner holistischer Eigenschaften konstatieren und ggf. ihren Stärkegrad diskutieren.
Gesetzt den Fall, der übergreifende Quintzug in der Reprise läge vor, in der Exposition aber würde die Confinalis der Nebentonart durch einen Terzzug aus der Mittelstimme erreicht, so stünden beide Figuren weder in einem kausalen Verhältnis, noch hätten sie für einander einen Zweck. Sie sind allein durch die vorausgehende ›frühere‹ Schicht vermittelt. Insofern keine unmittelbare funktionale Beziehung vorliegt, würde die Modifikation des Standards in der Exposition allenfalls eine Veränderung holistischer Eigenschaften des Übergreifzuges in einem trivialen Sinne motivieren können. Erst unter der Voraussetzung, dass die Analogie der Quintzüge in der Standardsituation selbst als eine Figur (auf einer bestimmten Schicht) beobachtet wird, wäre die Veränderung nicht mehr trivial.
Systemcharakter und Komposition – Gjerdingens Rekonstruktionsversuch des Haydn’schen Komponierens in der Diskussion
Der ungeheure Erfolg, den modellbasierte Analyseansätze wie die Schema-Theorie derzeit haben, beruht primär auf der Möglichkeit radikaler Reduktion: auf systematischer Ebene durch den Vorrang der Parataxe vor der Subordination, auf historischer Ebene durch die Möglichkeit, auch gemeinhin in vielerlei Hinsicht als weit voneinander entfernt angesehene Kompositionen, nunmehr im Wesentlichen für hochgradig verwandt zu erachten. Von beidem geht offenbar ein eigenartiger Reiz aus. Zahlreiche Kompositionen nicht allein des galanten Stils können nunmehr vermeintlich problemlos dekomponiert werden, führt man sie nur auf die verwendeten Schemata und ihre jeweiligen Instantiierungen zurück.[42]
Zumindest für diejenigen aber, die einen bedeutsamen Unterschied zwischen identischen Schemata bei Bach, Mozart und Schumann auch dann wahrnehmen, wenn selbst deren Instantiierungen große Ähnlichkeiten aufweisen, besagt diese Verwandtschaft nur, dass die gewichtigen stilistischen und epochalen Unterschiede durch holistische Eigenschaften markiert werden, die den jeweiligen Teilen von Schemata erst dadurch zuwachsen, dass die Schemata selbst in spezifische Relationen zueinander treten – ja, es steht zu vermuten, dass selbst in ein und derselben Stilistik unterschiedliche holistische Eigenschaften den entscheidenden Unterschied zwischen Formen und Gattungen ausmachen.
Dies widerspricht Joseph Riepels Behauptung, dass »[…] aber ein Menuet, der Ausführung nach, nichts anders ist als ein Concert, eine Arie oder Simpfonie«.[43] Zwar mag man einräumen, dass die Unterschiede zwischen manchen dieser Formen um 1750 noch nicht so deutlich ausgeprägt gewesen sein mögen wie bereits nur wenige Jahre später. Gleichwohl betont Riepel die kontextunabhängigen Eigenschaften der von ihm aufgelisteten Kompositionsbausteine, was als Vermarktungsstrategie für sein Buch (und vergleichbare Bücher bis in unsere Tage) durchaus legitim ist. Dass es im ersten Allegro einer Sinfonie gemeinhin Taktgruppen gibt, an denen Eigenschaften zu hören sind, die in einem Menuett nicht vorkommen, ist schlichtweg nicht Thema seines Lehrwerkes. Allerdings markieren eben diese Eigenschaften eine zentrale Differenz zwischen Sonaten-Allegro und Menuett: In einem Menuett, dessen beide ›Reprisen‹ jeweils acht Takte umfassen, folgt auf den im dritten ›Zweier‹ der ersten Reprise häufig vollzogenen Modulationsgang zumeist eine schlichte Kadenz in die Nebentonart. Demgegenüber weist die »Simpfonie« in der ersten Reprise in der Regel Taktgruppen auf, an denen die emphatische Setzung der Nebentonart gehört werden kann, bevor auf eine regelrechte Kadenz zugelaufen wird – und zwar unabhängig von dem Umstand, ob es sich um eine Exposition mit oder ohne Mittelzäsur(en) handelt.
Um die kontextuelle Einbettung einer solchen Taktgruppe geht es auch in Gjerdingens Aufbereitung der bereits erwähnten Skizzenarbeit Haydns zum 3. Satz des Streichquartetts Hob. III: 33 im Schlussteil des 27. Kapitels aus Music in the Galant Style. Vordergründig möchte Gjerdingen zeigen, dass Haydns Kompositionsweise in enger Verbindung mit der Partimento-Tradition steht, vermittelt durch seinen Lehrer Nicola Antonio Porpora, dessen Unterricht Haydn Mitte der 1750er Jahre als Porporas Kammerdiener und Korrepetitor genossen hatte. Letztlich aber handelt es sich um den Versuch, die Voraussetzungen der Schema Theory dadurch zu stützen, dass dem von Gjerdingen behaupteten Hörertyp ein korrespondierendes kompositorisches Subjekt an die Seite gestellt wird, dessen Entscheidungen sich im Wesentlichen darin erschöpfen, diverse Schemata auszuwählen, zu variieren und parataktisch zu reihen.
Zweimal legt Gjerdingen einen angeblich von Haydn zunächst projektierten musikalischen Ablauf nahe, dem aus philologischen und inhaltlichen Gründen widersprochen werden kann. Einmal geht es um eine Gjerdingen zufolge »ausgelassene« (»leaving out«) Taktgruppe im Rahmen der Überleitung der Exposition, ein anderes Mal um die Wahl zwischen vier verwandten Kadenzen (»related cadences«) in den Schlussphasen von Exposition und Reprise.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gjerdingens (2007) lagen bereits mehrere Untersuchungen zu Haydns Skizzenmaterial vor, die jedoch weder im Apparat noch Literaturverzeichnis Erwähnung finden[44]: Zunächst publizierte László Somfai 1972 einen Beitrag, dem auch eine erste Übertragung des gesamten Skizzenmaterials beigegeben war (vgl. Anhang, Bsp. 13–14), die im Wesentlichen der zwei Jahre später erschienenen Ausgabe des Haydn-Instituts entsprach.[45] Einen umfangreicheren Beitrag zu den Autographen der Streichquartette Haydns nutzte Somfai 1980, um seine Forschungsergebnisse zur Skizzenarbeit von Hob. III: 33, iii zu korrigieren und präzisieren. Somfais Untersuchungen bilden den Ausgangspunkt für die Forschung von Hollace Ann Schafer, deren Dissertation aus dem Jahre 1987[46] dem Kompositionsprozess der gesamten Instrumentalmusik Haydns gewidmet ist. Mit einem erneuten Fokus auf das Streichquartettschaffen hat zuletzt Keith Falconer im Jahre 2002 noch einmal die Skizzenarbeit Haydns untersucht.[47]
Schon die ersten von Gjerdingens gegebenen Erläuterungen zur Skizze Haydns erwecken den Eindruck, als ob es sich im Wesentlichen (»more or less«) um eine Verlaufsskizze handle, die einer fertiggestellten Partitur gleiche:
Haydn sketched the first half of the movement on one large sheet of paper ruled with staff lines, and did the second half on a second, similar sheet. These sketches exhibit a more or less consistent correspondence with the left-to-right and top-to-bottom progression of notation typical of a finished score, through some variants of passages are written near their models instead of where they will occur in the completed quartet.[48]
Dem entspricht im Kern, was auch Keith Falconer geäußert hatte:
Auf den ersten Blick sieht die Skizze für op. 20, Nr. 3, [sic] ganz anders aus als die Skizzen für Symphonien, weil sie als Partitur aufgesetzt ist. Am Anfang stehen Schlüssel und Tonartvorzeichnung für einen Quartettsatz in G-Dur, und manche Leerräume werden sogar mit Taktstrichen versehen, als ob sie umgehend hätten mit Nebenstimmen ausgefüllt werden sollen. Nur an wenigen Stellen wird die Unterteilung in vierzeilige Systeme unterbrochen, so etwa im zweiten, wo ein Teil der ersten Violinstimme durchgestrichen und statt dessen dorthin geschrieben wurde, wo eigentlich die zweite Violinstimme hätte stehen sollen. Anderswo, so etwa am Anfang des Satzes […] hat Haydn mehrere Stimmen ungefähr gleichzeitig komponiert. In dieser Hinsicht entspricht das Blatt weniger einer Skizze als dem gescheiterten Versuch, direkt in eine Partitur hinein zu komponieren. Dabei ist es unklar, ob es wirklich Haydns Absicht war, alle Stimmen des Quartetts auszufüllen. Oft werden in der letzten Fassung die Leerstellen lediglich mit Wiederholungen oder einfachen Varianten ausgefüllt, was Haydn vielleicht schon im Entwurf beabsichtigt hatte. […] Das Blatt wird vor allem deshalb Skizze genannt, weil es unvollständig ist, und nicht, weil es etwa Umgestaltungen der Form enthält. Erst später, als das Mißlingen der Partitur augenfällig war, wurde sie kurzerhand in eine Skizze verwandelt. Die ›skizzenhaften‹ Elemente des Blatts gehören keiner Partitur mehr an, sondern werden dort überall hinzugefügt, wo für sie Platz übrig ist.[49]
Allerdings ist Falconers Besprechung ungenau: Zunächst umfasst das Material nicht »das Blatt«, sondern besteht aus den Seiten A und B eines Bogens.[50] Auf Seite A gelten alle in Partitur ausgesetzten Abschnitte ausschließlich der Exposition des Satzes. Auf Seite B findet sich die Durchführung bis kurz vor Reprisenbeginn, wo Haydn mit einem ›etc.‹ im Vorfeld der Rückleitungsdominante den Partiturentwurf abbricht und im Anschluss nur noch eine die Rückleitungsdominante auskomponierende Figuration der 1. Violine für zwei Takte andeutet. Ferner findet sich nur auf Seite A für das eingangs melodieführende Violoncello eine Generalvorzeichnung, und auch die nur in dessen erstem System.[51]
Nur für Seite B gilt, dass sie im Vergleich zur Endfassung keinerlei »Umgestaltungen der Form« erkennen lässt (auch wenn diese nicht vollständig wiedergegeben ist). Die auf Seite A in Partitur gehaltenen Abschnitte können hingegen keineswegs als ein durchgehender Formverlauf gelesen werden. Die Frage ist nicht, ob, sondern nur, wo der Verlauf unterbrochen ist.
Demgegenüber erweckt Gjerdingen ebenso wie Falconer den Eindruck, als würden nur die später in die Leerstellen eingetragenen Einzelstimmen sich einem kontinuierlichen Formverlauf verweigern. Er unterscheidet nicht zwischen der Chronologie der Skizze in Partituranordnung und der chronologischen Anordnung innerhalb der Komposition. Denn nur unter dieser Voraussetzung macht es Sinn, zu behaupten, so wie die Perlenkette in einer Schmuckkassette befände sich auch die Kette der Schemata ›zusammengerollt‹ auf Haydns Skizzenblatt und müsse, um sie vollends zu verstehen, zunächst ›ausgestreckt‹ werden.[52] In der Konsequenz dieses Bildes liegt es, dass Veränderungen an der Kette nur dadurch vorgenommen werden können, dass einzelne Perlen ergänzt oder ausgeschieden werden. Nicht daran gedacht ist offenkundig, dass die Kassette eine Fülle vorwiegend loser Perlen enthält, die erst noch zur Kette verknüpft werden müssen. Entsprechend einseitig gestaltet Gjerdingen die Einrichtung der Skizze und ihre Gegenüberstellung mit der Endfassung in seiner Publikation:
After adapting the notational form of the sketches, I adapted the notational form of the quartet. I reduced its four original staves to two. Not every note of every part could be preserved without creating a notational tangle, but I hope the loss of a few insignificant doublings and filler parts is compensated by the increased legibility of the result. I then placed the adapted sketches directly above each measure of the quartet. Blank measures in the sketches generally indicate repetitive material that Haydn did not deign to sketch, and blank measures in the quartet indicate sketched material that he omitted from the final version.[53]
Beispiel 6: Gjerdingen 2007, 387, Example 27.7 (Ausschnitt, Fortsetzung): Joseph Haydn, Streichquartett Hob. III: 33, iii, Skizze, Original und Schema-Analyse, T. 15–26
Beispiel 6 zeigt denjenigen Ausschnitt aus Gjerdingens Übertragung der Skizzen und der Gegenüberstellung mit der Endfassung, der das gestrichene ›Monte Principale‹ enthält. Gjerdingen kommentiert:
The first of these begins in measure 19, where Haydn had sketched a Monte (I have added in parentheses a minimal second voice to make the Monte Principale more audible). It was mentioned in earlier chapters that as the century progressed the Monte became less and less fashionable in the first half of a movement. For whatever reason, Haydn chose to leave this Monte out of the final version and drew a large X across it in the sketches. What seems significant for this chapter is the inference that Haydn’s compositional choice involved deciding whether to add the entire schema to il filo––in other words, whether to add a whole pearl to his musical necklace. These four measures (mm. 19–22) were clearly treated as a conceptual unit.[54]
Gjerdingen findet sich durch den Strich Haydns darin bestätigt, Schemata als konzeptionelle Einheiten zu begreifen, die in der Regel als Ganzes eingefügt oder eliminiert werden. Bemerkenswert ist die fehlende Diskussion, was Haydns Strich motiviert haben könnte.[55]
Auch Somfai war 1972 zunächst davon ausgegangen, Haydn habe auf beiden Blättern einen Verlauf in Partitur gebracht. Er räumte aber ein, dass diese Annahme auf dem ersten Blatt zu erklärungsbedürftigen Merkwürdigkeiten führe.
Beispiel 13 (Anhang) zeigt den Übertrag Somfais von Haydns erstem Blatt.[56] Wie zu erkennen ist, hat Haydn die von Somfai als Takt 18A–D bezeichnete Gruppe ausgestrichen. Somfai kommentiert:
Die tonale Brücke zwischen G-Dur Tonika und D-Dur-Dominante in der Exposition ist am charakteristischsten. Gemäß der einfachen und zielbewußten Modulation und der Befestigung der neuen Tonart der Partitur-Reinschrift (T. 13–25) taucht in der Skizze die Möglichkeit des Zurückgleitens in G-Dur sogar zweimal auf; Haydn hat beides noch im Laufe der Skizzenarbeit gestrichen.[57]
Im Beitrag von 1980 differenziert Somfai seine Sicht und unterscheidet zwischen acht Schreibakten auf Seite A, wobei er die Schreibakte 1 und 2 sowie 3 und 4 als einem übergeordneten Arbeitsgang zugehörig begreift. Dabei wird das vermeintliche »zweite Zurückgleiten« in die Tonika nunmehr zutreffend als eine Ausweichung in die Subdominante der Nebentonart verstanden. Somfai gibt folgende Übersicht (Bsp. 7):
Beispiel 7: Somfai 1980, 39, Ex. 16, Joseph Haydn, Streichquartett Hob. III: 33, iii, Skizze Seite A, vermutete Chronologie der Schreibakte
Die Schreibakte erläutert Somfai wie folgt:[58]
Haydn beschreibt das erste vierzeilige System und die erste Hälfte des zweiten vierzeiligen Systems, einschließlich der Takte 22a–23a, eines gestrichenen Kadenzbeginns in der 1. Violine.
Haydn notiert die Takte 27a–33a im dritten vierzeiligen System. Ohne die Exposition abzuschließen, wendet Haydn das Blatt und skizziert die Durchführung des Satzes bis einschließlich Takt 83 (Zählung der Endfassung) auf Seite B (Anhang, Bsp. 14)[59]. Haydn notiert nahezu die gesamte Durchführung als Verlaufsskizze in Partitur; der Abschnitt mit der Rückleitungsdominante ist nicht mehr vollständig ausgeführt.[60]
Haydn kehrt zu Seite A zurück und versucht sich ein zweites Mal an der Kadenz für die Exposition ab Takt 22b, die er bis Takt 26 in der 1. Violine ausführt.
Haydn setzt bis zu Takt 29b fort.
Am rechten unteren Rand von Blatt A skizziert Haydn im letzten System eine Schlusskadenz für die Reprise (T. 36b–39b).
Haydn notiert eine Variante dieser Kadenz (T. 36a–39a) rechts neben die Taktgruppe 27a–33a in das drittletzte System (Akt 5 und Akt 6 erscheinen zeitlich getrennt, da für beide unterschiedliche Tinten verwendet wurde).
Haydn ergänzt in den Takten 25–26 die zweite Violine (Verwendung einer dickeren Feder »thick pen«[61]).
Haydn notiert die Takte 30b–35b, den Schluss der Kadenz für die Exposition (Verwendung einer alten Feder »old pen«[62]). Haydn überträgt das Bariolage-Motiv der Takte 34f. von Seite A auf die rückleitenden Takte 39–40 der Seite B.
Angesichts der hohen Anzahl an unterschiedenen Schreibakten ist es bedauerlich, dass sich Somfai weder dezidiert zum Strich der Taktgruppe 18A–D äußert noch zu den Korrekturen in Takt 18, die damit offenbar in Zusammenhang stehen.
Hier setzt die Kritik von Hollace Ann Schafer an. Mit Blick auf den Übergang zwischen dem ersten und zweiten vierzeiligen System des ersten Skizzenblattes heißt es:
It appeared to be a safe assumption that the composer at one point intended the passage to proceed from one system to the next because there looked to be continuity in both content and secondary characteristics. Reading it in this way, the figuration would remain consistent, the V/D would resolve at the beginning of the second system; in no case did radical alteration in ink color or handwriting signal an interruption. However, the passage merited closer inspection due to its differences from the final draft.
The phrase is troubling, though, because the continuous reading generates a text that fails short of making reasonable musical ›sense‹. The harmonic progression is redundant, the ›re-preparation‹ in the second system for the D as new tonic, while being more summary than the system above, is achieved by similar means; but more importantly, the arrival on the new tonic, D major, which is accomplished at the end of the end of the first system, is challenged straightaway by the appearance of the old tonic, G major, in the second measure of the second system. In any case, the resolution of the V/D at the system break does not accord with the harmonic progression in the final version, where the resolution occurs only after the secondary theme has begun (m. 19ff.), i.e., on the third beat of the measure. The questions remain, then, did Haydn ever intended this passage to sound as it stands in its full length of ten measures; did the composer recognize the problems and solve them by simply cancelling out the last four measures, the troublesome measures fortuitously grouped at the end of the phrase?
If the second system is seen as an independent entry, one Haydn wrote, moreover, as the first attempt at preparing the arrival of the secondary theme, the dissimilarities to the final version appear in quite a different light, and the appearance of the continuity draft at this place is explicated. In such a case, the second system contains a simple plan for the modulation, V-I-II/V-V/V, the figuration sequencing up a step after two measures; on the other hand, its replacement on the first system elaborates and paces the modulation, taking the figuration and harmonic plan, and molding them into a more coherent phrase under the simple scalar descent in the first violin; the importance of the final arrival on V/V (m. 18) is indicated by a more purposeful, directive contour in the measure on ii/V preceding it. Though not a model sketch […] this replaced entry has many of the characteristics of that type: it begins in an independent position on the page, carries through a limited harmonic and melodic shape rigorously, and starts ›blindly‹ in a planned harmonic area without precise reference to voice leading of the phrase that would eventually come before it. The crowding in the last measure of the first system (m. 18, especially the last group of sixteenth notes) could be seen as confirmation that notations already in place on the second system blocked a more commodious disposition of the phrase that became the end of the bridge.[63]
Haydns Arbeitsweise, in einer Art ›space-notation‹ Abschnitte, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Verlauf der Komposition Verwendung finden sollen, auch an verschiedenen Orten des Skizzenblattes zu notieren und durch entsprechende Leerstellen voneinander zu separieren, kann Schafer auch andernorts dokumentieren.[64] Eben deshalb aber droht Schafer ein Selbstwiderspruch. Wenn nämlich die zu Beginn des zweiten vierzeiligen Systems stehende Taktgruppe dort ›blind‹ gesetzt worden wäre und zugleich aber auch hätte Überleitung sein sollen, dann kann es nicht Haydns Vorhaben gewesen sein, sie unmittelbar an Takt 12 anzuschließen. Der im ersten vierzeiligen System verbleibende Freiraum hätte dazu dienen müssen, noch eine weitere Taktgruppe – einen vierten Vierer – einzufügen. Folgt man Schafer darin, dass es sich hierbei nicht um diejenige Taktgruppe handelt, die dort tatsächlich vorgefunden werden kann, weil – neben der sich ergebenden motivisch-thematischen Redundanz – eine erste starke harmonischen Progression in die Nebentonart durch eine nachgeschobene schwächere relativiert würde, dann bleibt als residuale Möglichkeit nur, dass Haydn an eine Fortsetzung des Hauptsatzes dachte, deren genaue Ausführung er aber zunächst unterließ.
Auch die harmonische Gestaltung des von Somfai mit Takt 18A–D bezeichneten Abschnitts spricht gegen einen unmittelbaren Anschluss an Takt 12. Wie Gjerdingen feststellt, handelt es sich um ein ›Monte Principale‹. Das ›Monte‹ – so die Bezeichnung bei Joseph Riepel – bildet innerhalb der Komposition kleinerer Tonstücke mit jeweils zwei Schlusswendungen in erstem und zweitem Wiederholungsteil, wie beispielsweise in einem 16-taktigen Menuett in Dur, die dritte Taktgruppe – als eine der Möglichkeiten neben Fonte und Ponte.[65] Dabei geht in den Beispielen Riepels am Ende der zweiten Taktgruppe, also des ersten Wiederholungsteils, entweder eine förmliche Ausweichung in die quinthöhere Tonart oder ein Halbschluss in der Grundtonart voraus. Das Charakteristikum des Monte ist, dass in seinem ersten Glied mit V/IV-IV in den Bereich der Unterquinte ausgewichen und in seinem zweiten über V/V zur V zurückgelangt wird. In seiner Skizze transponiert Haydn das Monte auf die Ebene der Nebentonart. Nicht anders als in der Menuettkomposition führt die anfängliche Ausweichung in den Bereich der Unterquinte nur dann zu keiner nachhaltigen Irritation über den Modulationsweg, wenn dessen Ziel, die Oberquinttontonart, zuvor schon in den Raum gestellt worden ist. Das angemessene Mittel hierzu, das dem erst am Ende der Reprise erfolgenden Ganzschluss in der Nebentonart nicht vorgreift, ist in Sätzen in Dur der Halbschluss in der Haupttonart. Damit kann präzisiert werden, welche Formfunktion einem vierten Vierer des Hauptsatzes zukommen hätte müssen: An seinem Ende hätte der Halbschluss in der Haupttonart als Mittelzäsur erreicht werden müssen.
Beispiel 8: Joseph Haydn, Streichquartett Hob. III: 33, iii, Skizze, alternative Formgebung in Verbindung mit einem Halbschluss in der Haupttonart als Mittelzäsur, T. 1–24
Beispiel 8 zeigt, wie dem Monte eine größere Überzeugungskraft als Überleitungsgruppe hätte gewährt werden können. Gleichwohl wird hier nicht behauptet, Haydns Überlegungen wären in diese Richtung gegangen. Dagegen spricht nämlich der tatsächliche, andersartige ›filo‹, den Ludwig Finscher wie folgt beschreibt:
Das G-Dur-Adagio des g-moll-Quartetts schaltet mit der Sonatensatzform ähnlich frei wie der erste Satz: die ›Durchführung‹ stellt erst den Kopf des Hauptthemas und die thematische Violoncello-Figur der Exposition kontrastierend gegeneinander (T. 44–54), verarbeitet dann diese Figur (T. 55–65) und kombiniert schließlich die variative Fortspinnung beider Elemente (T. 66 bis 84); die Reprise setzt erst mit dem neunzehnten Takt der Exposition ein, läßt also das Hauptthema und die erste Aufstellung der Violoncello-Figur, die die Durchführung beherrscht hatten, aus.[66]
Zwar misst Finscher Haydns Umgang der Sonate an einem historisch erst später aufkommenden Standard, nämlich der dreiteiligen Sonate (die allerdings niemals ihre zweiteilige Schwester vollends verdrängen konnte)[67]. Gleichwohl erkennt er in der kontrastierenden Gegenüberstellung von kantabler Melodik und figurierter Klangfläche das wesentliche Gestaltungsmerkmal eines alternierenden Formverlaufes in Hob. III: 33, iii.[68]
Eben dieses Merkmal ist offenbar bereits auch für die Exposition der Komposition prägend und nicht erst, wie Finscher nahelegt, für die Durchführung. Der Kontrast findet sich erstmals in direktem Anschluss an den kantablen Hauptsatz. Das alternierende Formkonzept kann aber nur dann gelingen, wenn die ›figurierte Klangfläche‹ mit derselben Deutlichkeit als ein Anfang gesetzt ist wie der Hauptsatz selbst. Diese Bedingung vermag das Monte auch dann nicht erfüllen, wenn die notwendige kadenzielle Einbindung erfolgt, weil es dazu eines stabilen tonikalen Beginns bedarf. Diese Funktion erfüllt hingegen der ›Prinner‹, dessen Qualität ›Anfang‹ Haydn gerade dadurch erhöht, dass er ihn unmittelbar an den unvollkommen ganzschlüssig endenden zweiten Halbsatz des Hauptsatzes anschließt auf die mögliche symmetrische Gestaltung von letzterem verzichtet.
In diesem Zusammenhang erscheint auch Schafers Hinweis auf das gedrängte Notenbild am Ende des ersten Systems in einem anderen Licht: Takt 18 wird leicht abweichend von Somfai 1972 in der Übertragung der Gesamtausgabe wie folgt wiedergegeben (Bsp. 9):
Beispiel 9: Joseph Haydn, Streichquartett Hob. III: 33, iii, Skizze, Übertragung in Haydn 1974, Seite A, T. 18
Wie zu erkennen ist, hatte Haydn im Violoncello zunächst auf dem ersten Sechzehntel ein a notiert. Auch in der ersten Violine war das d2 zunächst nach unten gehalst. Möglicherweise plante Haydn am Ende des ›Prinners‹ zunächst eine Mittelzäsur, ohne diese soweit auszuführen, dass über die Fortführung jenseits des implizierten Vorhaltsquartsextakkordes und seiner Auflösung bereits entschieden gewesen wäre – zumal im Bass. Nicht, weil Haydn sich gegen ein Sechzehntel a, sondern gegen eine Ruhenote a mit der Länge einer Viertel entschied, kam das Platzproblem in Takt 18 der Violoncellostimme auf.[69]
Die relevanteste Änderung, die Haydn im Hinblick auf die Formanlage der Exposition des Satzes vorgenommen hat, würde demnach darin bestehen, dass er sich gegen eine zwei- und für eine einteilige Exposition (›continuous exposition‹) entschied. DieTakte 18A–D wurden tatsächlich ›blind‹ an den Anfang des zweiten vierzeiligen Systems gesetzt. Allerdings handelt es sich, anders als von Schafer angenommen, nicht um die erste, später verworfene Version der Überleitung, sondern um eine Taktgruppe im Vorfeld der Kadenzbildung in der Nebentonart, die den überleitenden ›Prinner‹ der Setzweise nach – als ›figurierte Klangfläche‹ – wiederaufnimmt und damit das alternierende Formmodell fortführt. Im Anschluss an das Monte skizzierte Haydn noch drei Takte eines auf vier Takte angelegten ›Fenaroli‹[70], der durch die Fixierung der Terzlage des nebentonartlichen Dreiklangs die unmittelbare Kadenzvorbereitung leistet.
Warum aber findet sich in Haydns Skizze kein Hinweis auf eine Taktgruppe, die der potentiellen Mittelzäsur nachfolgen würde? Auch wenn es Haydns Plan gewesen sein sollte, »in eine Partitur hinein zu komponieren«, impliziert dies keineswegs, die Skizze gebe den Formverlauf lückenlos wieder. Vielmehr erscheint es mit Blick auf das alternierende Formmodell viabel, dass Haydn eine Variante des Hauptsatzes an die Mittelzäsur anschließen und zwischen ›Prinner‹ und ›Monte Principale‹ einschieben wollte. Im Rahmen der Skizzenarbeit konnte die Ausnotierung dieses Abschnitts entfallen, weil es sich im Kern nur um eine Transposition handelte. Beispiel 10 zeigt, wie eine derartige Lösung hätte aussehen können:
Beispiel 10: Joseph Haydn, Streichquartett Hob. III: 33, iii, Skizze, alternative Formgebung in Verbindung mit einem Halbschluss in der Nebentonart als Mittelzäsur, T. 13–28
Besondere Beachtung verdient die Melodieführung in der 1. Violine zu Beginn des dritten vierzeiligen Systems (T. 27a–28a). Hier verdeutlicht die im Rahmen der Gesamtausgabe an Somfais Skizzenübertragung vorgenommen Korrektur Haydns Absicht zusätzlich (Bsp. 11):
Beispiel 11: Joseph Haydn, Streichquartett Hob. III: 33, iii, Skizze, Übertragung in Haydn 1974, Seite A, Beginn des dritten vierzeiligen Systems
Nichts in den beiden vorausgehenden Systemen vermittelt diesen Eingang. Gleichwohl lässt seine Gestaltung vermuten, dass sich Haydn schon beim Wechsel von zweitem zu drittem vierzeiligen System darüber im Klaren war, was er späterhin auch ausführte: Die Schlussgestaltung der Exposition besteht aus zwei kadenziellen Anläufen, zwischen die – als retardierendes Moment – ein an das Solokonzert gemahnender Eingang in der 1. Violine eingeschoben ist.
Sollte Haydn tatsächlich zunächst eine zweiteilige Exposition mit einer Hauptsatzvariante in der Nebentonart nach der Mittelzäsur geplant haben, dann lässt sich präzisieren, was dazu führte, dass er die Taktgruppe 18A–D strich und durch die Tilgung der Mittelzäsur in Takt 18 einen unmittelbaren Anschluss des ›Fenaroli‹ ermöglichte: Mit der Entscheidung, die Durchführung mit einer Variante des Hauptsatzes in der Nebentonart zu eröffnen, wird deren Dopplung im Rahmen der Exposition redundant. [71] In unmittelbarem Zusammenhang hiermit scheint wiederum zu stehen, dass sich Haydn für eine Zweiteiligkeit auf der Ebene der Gesamtform entscheidet: Die Hauptsatzvariante in der Subdominante (T. 66ff.) ist keine Scheinreprise, sondern substituiert eine Reprise des Hauptsatzes in der Haupttonart, die im Falle einer dreiteiligen Gesamtanlage Takt 89ff. hätte erfolgen müssen. Diese Entscheidung erscheint aus einem motivisch-thematischen und einem harmonischen Grund folgerichtig.
Auf den motivisch-thematischen Grund hat bereits Finscher hingewiesen: In den Takten 79ff. werden die beiden bislang alternierend gesetzten Satzbilder ›cantabler Satz‹ und ›figurierte Klangfläche‹ erstmals miteinander kombiniert. Eine Reprise des Hauptsatzes in der Haupttonart fehlt, weil Haydn hinter das zentrale Ergebnis des Durchführungsprozesses nicht zurückgehen mochte. Eine Rückkehr zum Ausgangspunkt der Anordnung schied damit aus. Mit Blick auf die harmonische Disposition des gesamten Satzes markieren das Hauptthema und seine Varianten die ersten drei Positionen einer plagalen Kadenz (T-D-S-T).[72]
* * *
In Somfais Übertragung von Seite A sind vier Kadenzen bzw. Kadenzanfänge erkennbar. Sie sind mit den Takten 22a –[23a], 22b–35b, 36a–39a und 36b–39b bezeichnet. Die Takte 36a–39a und 36b–39b sind Kadenzabläufe in G-Dur und gehören folglich zum Schlussabschnitt der Reprise. Somfai mutmaßte, dass Haydn »wegen Platzmangel zur Seite A zurückkehrte«.[73] Das ist plausibel, wenn man davon ausgeht, dass Haydn alle noch fehlenden Kadenzabschnitte (nicht nur der Reprise) aufgrund der besseren Übersicht auf einem Blatt notieren wollte. Hier mag auch der Grund dafür liegen, weshalb Haydn die Exposition zunächst nicht vervollständigte, bevor er zur Skizzierung der Durchführung überging: Die Schlusskadenzen von Reprise und Exposition sollten aufeinander abgestimmt werden, ungeachtet dessen, dass nicht alle von ihnen für beide Formteile identisch sind.
Somfai weist darauf hin, dass Haydn im Zuge der Arbeit an der Durchführung eine weitere Variante der Sehzehntelfiguration entwickelte (T. 60)[74], die möglicherweise seine Probleme bei der Findung der Kadenzwendung Takt 22ff. auf Seite A lösen konnte. Bemerkenswert ist aber, dass sich nicht nur Takt 22af. und Takt 22bf. in dieser Hinsicht unterscheiden, sondern auch die Takte 36aff. und 36bff.
Zudem scheint es Haydn attraktiv gefunden zu haben, durch Rückgriff auf die beiden ersten Stufen des ›Prinners‹, der sich direkt darüber im ersten vierzeiligen System notiert findet, einen ›motivischen Parallelismus‹ zwischen Überleitungs- und Kadenzbeginn herbeizuführen. Auch dies verbindet die Takte 22bf. und 36af. miteinander und trennt sie von den Takten 22af. und 36bf. Der Rückgriff auf den ›Prinner‹ verändert zudem die Gewichtigkeit des Kadenzansatzes: Die in den Takten 22a und 36b implizierten tonikalen Sextakkorde sind charakteristisches Signal für relativ starke Kadenzen über dem Bassstufengang ➂-➃-➄-➀, die – meist in Verbindung mit einem kadenzierenden Quartsextakkord über der ➄ – ganze Formteile strukturell beenden. Die mit dem ›Prinner‹ anhebenden Kadenzen wirken hingegen auch im Hinblick auf ihre restliche Gestaltungsweise leichter. Sie eignen sich als erste Kadenzanläufe, auf die noch ein stärkerer Abschluss folgt.
Diese Überlegung untermauert die These, Haydn habe zunächst eine zweiteilige Exposition geplant. Unter dieser Voraussetzung hätte der Satz bis zum Beginn der strukturellen Schlusskadenz Takt 22a aus 12 Takten Hauptsatz, 6 Takten Überleitung, mindestens 4 Takten Hauptsatzvariante, 4 Takten Monte und 4 Takten ›Fenaroli‹ bestanden: 18 Takte vor und 16 + x Takte nach der Mittelzäsur (wobei x einschließlich eines denkbaren Anhangs 8 Takte wohl kaum überschritten hätte) – eine gängige Proportion. Die entscheidende konzeptionelle Veränderung wird am Strich der Takte 22a–23a ersichtlich. Dabei hat Haydn seine Planung offenbar im Moment der Niederschrift verändert, denn der Strich erfolgte, noch bevor der zweite Takt der Figur überhaupt vollständig ausgeführt war. Die Idee zur Taktgruppe 27a–33a impliziert ein neuerliches Kadenzvorfeld. Die Taktgruppe bildet zum ›Fenaroli‹ ein funktionales Äquivalent: Auch sie fixiert die Terzlage der nebentonartlichen Tonika durch eine Pendelbewegung; auch in ihr ist der Quintton der Nebentonart – jetzt nicht mehr als Mittelstimme, sondern als Deckton – stark gemacht. (Oben war von Taktgruppen in größeren Tonstücken die Rede, an denen wir die emphatische Setzung der Nebentonart gehört werden kann, bevor auf eine regelrechte Kadenz zugelaufen wird – und zwar unabhängig von dem Umstand, ob es sich um eine Exposition mit oder ohne Mittelzäsur(en) handelt. Bei den Takten 19–21[22] bzw. 31a–33a handelt es sich um eben solche Gruppen.)
Haydns Entscheidung verlagert die Erweiterung der Form von der Mitte auf die Schlussbildung. Mit Blick auf die ›verkürzte‹ Reprise wirft dies die Frage nach dem proportionalen Verhältnis der beiden Kadenzanläufe auf. Schwer einschätzbar ist in diesem Zusammenhang die Rolle, die Haydn den Takten 36b–39b zuordnen wollte. Der Beginn mit dem tonikalen Sextakkord und das relativ dichte harmonische Geschehen gegen Ende lassen vermuten, dass es sich hier um den Versuch handelt, einen strukturellen Abschluss herbeizuführen. Der Schlusston g2 in der Oberoktave zur obligaten Lage allerdings spricht dagegen. Denkbar erschiene, dass die Höherlegung mit Blick auf das Einfädeln in den ersten aus der Exposition teils übernommenen Kadenzanlaufes gewählt ist: In Takt 39b wird Takt 25 in transponierter Fassung antizipiert. Das unterstützt Somfais Annahme, dass die Takte 22b–29b bereits vorlagen, als sich Haydn der Schlussgestaltung der Reprise zuwendete. An dieser Interpretation irritiert allerdings, dass Haydn nicht auch den ›motivischen Parallelismus‹ aufgriff, den er bereits in den Takten 22b–23b ausgeführt hatte. Zudem könnte vermutet werden, dass, nachdem Haydn ohne Abschluss der Exposition mit der Durchführung fortsetzte, sein nächster Arbeitsschritt trotz Rückkehr zu Seite A nicht der Exposition, sondern der Reprise galt. Als sich Haydn der Arbeit an der Reprise zuwendete, stand wohl fest, dass sich als deren erster Teil der ›Fenaroli‹ unmittelbar an die Rückleitungsdominante anschließen sollte (davon unabhängig ist die Frage, ob das Bariolage-Motiv der Skizzierung des Endes der Exposition entsprang – wie Somfai vermutet – oder eine Übertragung vom Ende der Durchführung ist). Offen war aber womöglich, ob auch noch die Takte 31a–33a in der Reprise Verwendung finden sollten. Die starke Kadenzwirkung der Takte 36b–39b widerspricht dem. Sie orientiert sich an der bis dato nur für die Exposition verworfenen Variante einer starken und zügigen Schlussfindung, die die Takte 22a–23a in Aussicht stellten. Möglicherweise entschloss sich Haydn erst, nachdem er mit den Takten 22b–29b das Verbindungsstück zwischen erstem und zweitem Kadenzvorfeld in der Exposition gefunden hatte, eine daran orientierte Variante mit den Takten 36a–39a auch für die Reprise zu entwickeln. Mit Blick auf die Anordnung auf dem Blatt erfolgte danach die Vervollständigung des Expositionsschlusses. Wie schon Somfai feststellte, konnte Haydn die Takte 33b–35b nur in den Zeilenrest eintragen, der ihm nach der vorausgegangenen Notierung der Takte 36a–39a verblieben war.[75]
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen sei nun abschließend diskutiert, wie Gjerdingen die einzelnen Kadenzentwürfe Haydns aufarbeitet. Gjerdingens Nummerierung 1 bis 4 folgt der Anordnung auf Seite A von oben nach unten. Von Kadenz Nummer 2 sind (wahrscheinlich aus Platzgründen) nur die ersten vier Takte wiedergegeben. Zudem sind der besseren Vergleichsmöglichkeit wegen auch die für die Exposition skizzierten Kadenzen in der Haupttonart G-Dur wiedergegeben (Bsp. 12).
Beispiel 12: Gjerdingen 2007, 396, Example 27.8: Joseph Haydn, Streichquartett Hob. III: 33, iii, »four sketches for a cadence«, Skizze und Schema-Analyse
Gjerdingen kommentiert:
For Haydn, the alternative paths of il filo seem to have branches most luxuriantly in extended cadences. Example 27.8 shows Haydn’s sketches for the path of four related cadences. The first path, which was the most straightforward in simply launching into the cadence, was rejected and crossed out. Immediately below it was sketched the second path, which first detours through a Passo Indietro and then veers away from complete closure with both deception and evasion. This was the path chosen to end the first half of the quartet movement. For his third path, destined for the second half of the movement, Haydn expands the design of the second path by doubling the length of the fioritura over ➂ in the bass. The fourth and final path, which was not incorporated into the finished quartet, adds the further detour of Indugio. Note that in the second measure of this fourth path, Haydn overshot his mark with the rising fioritura. He crossed out his mistake and then resumed his course. In rejecting this fourth path, with its chromatic and rather hectic Indugio, he may have felt that he had also overshot his mark in terms of the Character of the whole movement.[76]
Anders als im Falle des ›Monte Principale‹ legt Gjerdingen nicht nahe, aus der räumlichen Folge auf dem Blatt eine Schaffens- und/oder Formchronologie abzuleiten. Vielmehr erwecken Darstellung und Kommentar den Eindruck, als habe Haydn zunächst eine ›Reihe von Kadenzen‹ vor sich ausgebreitet, um dann aus ihr zu wählen.[77] Die prinzipielle Gleichberechtigung der einzelnen ›Perlen‹ wird durch die Angleichung der tonartlichen Verhältnisse und durch die starke Kürzung von Nummer 2 unterstützt. Freilich ist dieses Vorgehen nicht minder fraglich.
Nur für Nummer 4 wird versucht zu erklären, warum sie ausschied. Der Hinweis auf den Gesamtcharakter des Satzes, der durch die erhöhte harmonische Aktivität verletzt würde, vermag keinen befriedigenden Ersatz dafür zu bieten, dass eine Diskussion mit Blick auf funktionale Gesichtspunkte unterbleibt. Dass im Schlusstakt das Kürzel ›1/2‹ auf Gjerdingens Lesart als Halbkadenz hinweist – die, solange man die Taktgruppe isoliert betrachtet, durchaus kontingent ist –, kann als unmittelbarer Ausdruck dieses Mangels an relationalem Denken interpretiert werden.
Schluss
Die vorangehende Diskussion um mögliche alternative Formkonzepte ist nicht primär philologisch motiviert. Zwar wurde vor dem Hintergrund des aktuellen Forschungsstandes der eine oder andere weiterführende Aspekt eingeführt. Ihre eigentliche Absicht aber besteht darin, die Essentialität holistischer Eigenschaften – auch von Schemata – in größeren Werkkontexten zu erweisen. Darüber lässt sich kein philologischer und auch kein anderer Beweis im Sinne eines Erkenntnisurteils führen. Demjenigen aber, der Töne oder Taktgruppen innerhalb einer Komposition umstellt, verändert oder auslässt und daraufhin bemerkt, dass sich die Wirkung dieser oder anderer Töne oder Taktgruppen geändert hat, erscheint die Existenz holistischer Eigenschaften evident.[78]
Postscriptum
Erst nach Abschluss der Arbeit an diesem Beitrag wurde ich eines Hinweises von Thomas Christensen gewahr. Christensen macht in seinem jüngsten Text die Entdeckung, dass sich Carl Dahlhaus’ Beschreibungen des musikalischen Zusammenhangs im Hinblick auf die Musik des 15. und 16. Jahrhunderts einerseits und die des späten Wagners andererseits ähneln.[79] Nach Auffassung von Dahlhaus sind beide Musiken der Tonalität (nach ›funktionstheoretischem‹ Verständnis) noch nicht bzw. nicht mehr verpflichtet. In Bezug auf die historisch ältere Musik stellt Dahlhaus dem ›Subordinationsprinzip‹ der tonalen Harmonik ein ›Prinzip der Nebenordnung‹ entgegen.[80] Hinsichtlich der historischen jüngeren Musik heißt es,
dass sich die rasch und nicht selten ›rhapsodisch‹ wechselnden Tonarten oder Tonartenfragmente nicht immer auf ein Zentrum beziehen […], sondern vielmehr wie Glieder einer Kette aneinandergefügt sein können, ohne dass das dritte anders als durch Vermittlung des zweiten mit dem ersten verbunden sein müsste.[81]
In unserem Zusammenhang ist das Bild der ›Kette‹ von Interesse. Es findet sich – wenn auch ohne Perlendekor – mitsamt seiner Implikationen bereits bei Dahlhaus vollständig ausgeführt.
Gjerdingen, der 1990 Dahlhaus’ Untersuchungen ins Englische übersetzte[82], ist ein Kenner von dessen Schriften. Gleichwohl ist die Frage, ob es sich um eine wissentliche Übernahme handelt, nachrangig. Entscheidend ist, welche Verschiebung sich durch den unterschiedlichen Gebrauch des Bildes mit Blick auf die ›Erzählung‹ von der ›Geschichte der Tonalität‹ abzeichnet. Unter Rekurs auf die oben diskutierten Systemeigenschaften ist Dahlhaus’ zufolge ›Tonalität‹ ein holistisches System. Gjerdingen hingegen reklamiert gerade für die Musik der ›Kernzeit‹ dieses Systems – die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts –, was Dahlhaus als den entscheidenden Unterschied zur Musik der zeitlich angrenzenden Zeitalter verstanden wissen wollte – nämlich, dass diese atomistisch organisiert sei.
Anhang
Beispiel 13: Joseph Haydn, Streichquartett Hob. III: 33, iii, Skizze, Seite A, Übertragung Somfai 1972
Beispiel 14: Joseph Haydn, Streichquartett Hob. III: 33, iii, Skizze, Seite B, Übertragung Somfai 1972
Anmerkungen
Esfeld 2003, 10. | |
Vgl. ebd. | |
Elsfeld 2002, 22ff. | |
Vgl. Simons 1987. | |
Ebd., 24. | |
Zum Begriff der ›organischen Form‹ vgl. den Beitrag von Ariane Jeßulat in dieser Ausgabe. | |
Vgl. Seel 2002. | |
Brandom 2000, 15f. | |
Seel 2002, 34 (Hervorhebungen original). | |
Ebd., 35. | |
Vgl. Esfeld 2000. | |
Kant 1974, B 540 und B 549. | |
Seel 2002, 37f. (Hervorhebungen original). | |
Ebd., 37. | |
Vgl. Schwab-Felisch 2009. Gleichwohl gibt es Versuche, die Beobachtungen in Bezug auf die Teilsysteme des Systems ›Tonalität‹ miteinander zu vereinigen: Vgl. z.B. Haas/Diederen 2008, wo eine um rhythmisch-metrische und motivisch-thematische Aspekte ergänzte schenkeriansche Analyse vorliegt. | |
Gabriel 2013, 267. | |
Welche Sachverhalte diese Bedingung erfüllen, ist diskutabel. Vgl. hierzu z.B. die Diskussion über das Phänomen sogenannter ›Scheinkonsonanzen‹ in der Harmonielehre ab Ausgang des 18. Jahrhunderts. | |
Esfeld 2003, 45. | |
Gjerdingen 2007. | |
Neuwirth 2008, 402. | |
Ebd., 403, Anm. 11; Neuwirth bezieht sich hier auf Gjerdingen 2007, 453–464. | |
Gjerdingen 2007, 376. | |
Ebd. | |
Ebd., 378. | |
Ebd., 379. | |
Eine alternative Lesart von der Terz bestünde darin, den ›Prinner‹ als Übergreifzug zu ›übersetzen‹, der in den Kopfton mündet, welcher ein erstes Mal durch Anstieg 1-2-3 im eröffnenden Zweier erreicht worden wäre. Dann wären Brechung und Terzzug im ersten Zweier Teil eines Ränderspiels. | |
Vgl. z.B. in Gjerdingen 2007, 115 Example 9.7, wo der ›Prinner‹ in den ›Meyer‹ und der ›Meyer‹ in das ›Fonte‹ ›eingehangen‹ erscheinen. Vgl. hierzu auch den Beitrag von Folker Froebe in dieser Ausgabe und Froebe 2014. | |
Vgl. Gjerdingen 2007, 364f. | |
Grimm 1869, 214. | |
Hervorhebungen original, zitiert nach: Mozart Briefe und Dokumente – Online-Edition http://dme.mozarteum.at/DME/briefe/letter.php?mid=1040&cat | |
Burney 1959, 134; Eintrag von Dienstag, dem 16. August 1770. Burneys Übersetzung von »vaghezza« als »beauty« darf zumindest als eigenwillig gelten. Möglicherweise war hier von Galuppi eher an eine Art »schöne Verwirrung«, wie es Friedrich Schlegel späterhin nennen sollte, gedacht, die er der Klarheit aus dramaturgischen Gründen gegenübergestellt wissen wollte. Immerhin geht es dem Zusammenhang nach um Aspekte der gelungenen Opernkomposition. | |
Anderson 1938, 2, 889, Letter L. 323. | |
Gjerdingen 2007, 369. | |
Ebd. | |
Ebd. | |
Einstein 1978, 148. | |
Vgl. die von Leopold Mozart an seine Tochter Maria Anna im Brief vom 14./16. Februar 1785 mitgeteilte Äußerung Haydns über seinen Sohn: »Haydn sagte mir: ich sage ihnς vor Gott, als ein ehrlicher Man, ihr Sohn ist dς grösste Com=ponist, den ich von Person und dem Nahmς nach kene: er hat Geschmack, und über das die grösste Compositionswissenschaft.« Hervorhebungen original, zitiert nach: Mozart Briefe und Dokumente – Online-Edition: http://dme.mozarteum.at/DME/briefe/letter.php?mid=1416&cat= | |
Man denke an die Unterscheidung zwischen ›Kenner‹ und ›Liebhaber‹ bei C.Ph.E. Bach. | |
Gjerdingen 2007, 369–397. | |
Ebd., 383. | |
Vgl. z.B. Polth 2013. Gleiches gilt für die Analytik nach Albert Simon (vgl. Haas 2011). | |
Sicherlich kein Zufall ist, dass sich ein vergleichbares Denken auch in der Neo-Riemannian Theory findet, die im anglo-amerikanischen Diskurs derzeit das ›systematische‹ Pendant zur ›historischen‹ Schema Theory bietet. Dort sind an die Stelle herkömmlicher tonartlicher Beziehungen ›Reisen‹ durch Tonnetze, Terzen-Alleen und andere tonräumliche Figuren getreten. Beide Theorien sind damit einer durch die New Musicology motivierten Gegenbewegung verpflichtet, die herkömmliche Konzepte musikalischen Zusammenhangs, insbesondere der Schenkerian Analysis, in Frage stellt. | |
Riepel 1752–1786, 1. | |
Der einzige explizite Verweis gilt der Notengrundlage von Gjerdingens Edition: die Wiedergabe der Skizzen und des originalen Satzverlaufs in der vom Haydn-Institut herausgeben Gesamtausgabe (Haydn 1974). | |
Somfai 1972. | |
Schafer 1987. | |
Falconer 2002. | |
Gjerdingen 2007, 383. | |
Falconer 2002, 46f. | |
Es handelt sich um das letzte Folio des Autographen von Haydns Divertimento Hob. II: 16 aus dem Jahre 1760. Offenbar aus Sparsamkeitsgründen nutzte Haydn die unbeschriebenen Seiten der älteren Partitur für seine Skizzenarbeit: »Haydn hat seine Skizzen 1772 in eine Partitur ›versteckt‹, welche er vermutlich nie in fremde Hände ausliefern wollte, da ja der Kopist das Stimmenmaterial vom Divertimento noch seinerzeit verfertigt hatte.« (Somfai 1972, 277) Haydns Versuch, »direkt in eine Partitur hinein zu komponieren«, galt also einer Skizze und keiner Reinschrift. Die Partitur befindet sich derzeit in der Musiksammlung der Nationalbibliothek Széchényi Budapest; Signatur: Ms. Mus. I. 47. | |
Auf Seite B findet sich die getilgte Generalvorzeichnung eines Satzes in E-Dur – möglicherweise ein Hinweis auf eine ursprünglich intendierte Verwendung für das Adagio aus dem vermutlich früher entstandenen Quartett Hob. III: 36 derselben Werkreihe. | |
Vgl. Anm. 40. | |
Gjerdingen 2007, 383f. | |
Ebd., 384. | |
Im ersten Abschnitt des 27. Kapitels aus Music in the Galant Style gibt Gjerdingen eine Übersicht zur Wahrscheinlichkeit, mit der auf Grundlage der im Buch verwendeten Beispiele davon ausgegangen werden könne, welche Schemata aufeinander folgen (2007, 372, Figure 27.1, »The probability of progressing from Schema A to Schema B«). Für die Verbindung von ›Prinner‹ und ›Monte‹ wird hier kein einziger Fall aufgeführt, was bedeutet, dass nur die Endfassung von Haydns Hob. III: 33, iii in die Auflistung aufgenommen wurde. | |
Die Abweichungen, die sich gegenüber Somfai 1972 in Haydn 1974 ergeben, werden weiter unten im Haupttext gesondert erörtert. | |
Somfai 1972, 282. | |
Somfai 1980, 23f. Als Kriterien führt Somfai auf: »the shape oft the lines, i.e. identity of quill; the color of ink; the size of notation; and the angle of non-perpendicular stems« (ebd., 23). | |
Beachte Anm. 45. | |
Am Ende von Seite B gibt Haydn die Notation in Partitur auf: Offenbar notierte er in der ›Kombinationspartie‹ (T. 27ff.) zunächst das melodieführende Violoncello, ohne dabei den für die Figuration notwendigen Platz in den restlichen Systemen zu bedenken. Anfangs kann er sich durch Abkürzungen behelfen. Ab Takt 33 divergiert die Notation in den Außenstimmen zunehmend. Die Takte 36–40 sind nur noch in der 1. Violine notiert. | |
Somfai 1980, 23f. | |
Ebd. | |
Schafer 1987, 243f. | |
Vgl. Schafers Ausführungen zu den Skizzen des Finales aus Hob. I: 99 (1987, 220ff.). | |
Vgl. Riepel 1755, 43ff. [1996, 149ff.] | |
Finscher 1974, 226. | |
Vgl. die Nachzügler dieser Formkonzeption in Chopins op. 35, i, op. 58, i, und op. 65, i, die alle zweiteilig angelegt sind. | |
Haydn ist auf diese Konzeption mit Regelmäßigkeit zurückgekommen. Das vielleicht eindrucksvollste Beispiel, der Kopfsatz aus Hob. III: 78, entstammt ebenfalls einem Quartett. | |
Diese Einschätzung ergibt sich nur für denjenigen, der das Autograph studiert, das in Somfai 1972 wiedergegeben ist. Weder die Übertragung in Somfai 1972, noch die in Haydn 1974 vermitteln den entsprechenden Eindruck. | |
Dies ist der Grund für die Differenz um einen Takt, die sich zwischen Somfais Taktzahlen und den Taktzahlen der Endfassung ergibt. Die unvollständige Ausführung des ›Fenaroli‹ scheint mit Blick auf die ansonsten vorherrschende Vollständigkeit der einzelnen Taktgruppen erklärungsbedürftig: Die rechte Hälfte von Seite A wird durch die näherungsweise gebildete Senkrechte der Takte 13, 22a und 22b, sowie 27b und 36b von der linken geschieden. Nur die Gruppe der Takte 36a–39a überschreitet diese virtuelle Grenze, die ›Anfänge‹ von ›Schlüssen‹ im Satzverlauf trennt. Es muss daher offen bleiben, ob Haydn die Takte 22a–22b unmittelbar im Anschluss an Takt 21 notierte – wie Somfai vermutet –, oder erst, nachdem die Takte 27a–33a im dritten vierzeiligen System notiert waren. | |
Damit ist nicht gesagt, Haydn habe die Entscheidung erst getroffen, als er begann, Seite B zu beschreiben. | |
Weitere Untersuchungen könnten der Frage nachzugehen, ob diese Stufenfolge Teil des harmonischen Hintergrundes der Komposition im Sinne eines ›post-schenkerianischen Ursatzes‹ ist (vgl. hierzu Rohringer 2013). Die Wahl besonders ›attraktiver‹ Formpositionen für die Präsentation der beteiligten Stufen, motivisch-thematisch durch die Prominenz des Hauptsatzes unterstützt, spricht für eine solche Einschätzung. | |
Somfai 1972, 280. | |
Somfai 1980, 23f. | |
Wann in diesem Zusammenhang die Gegenstimme der 2. Violine in den Takten 25–26 notiert wurde, erscheint nachrangig. | |
Gjerdingen 2007, 396f. | |
Wenig hilfreich erscheint in diesem Zusammenhang allerdings die Wiedergabe von Nummer 1: Takt 22b (nach Somfai) wird durch einen an anderer Stelle stehenden Vergleichstakt der Endfassung (irrtümlich mit Takt 42 statt 38 beziffert) ersetzt. | |
Holistische Eigenschaften von ›musikalischen Teilen‹ gehören dem Bereich der Ästhetik an. Sie sind nicht falsifizierbar. Die Grenzen einer Kunstwissenschaft, zu der auch die Musiktheorie gehört, anhand der Grenzen von Erkenntnisurteilen bestimmen zu wollen, hieße sie nicht nur arm zu machen, sondern ihren Gegenstand zu verfehlen. | |
Vgl. Christensen i.V. | |
Dahlhaus 2001, 140. | |
Dahlhaus 2003, 465. | |
Dahlhaus/Gjerdingen 1990. |
Literatur
Anderson, Emily (Hg.) (1938), The Letters of Mozart and His Family, 3 Bde., London: Macmillan.
Burney, Charles (1959), An Eighteenth-Century Musical Tour in France and Italy, Oxford: Oxford University Press.
Brandom, Robert B. (2000), Articulating Reasons, Cambridge, Mass.: Harvard University.
Christensen, Thomas (i.V.), »Die Entstehung der ›Entstehung‹«, in: Carl Dahlhaus und die Musiktheorie (= Sonderausgabe der ZGMTH), hg. von Stefan Rohringer, Hildesheim u.a.: Olms.
Cohn, Richard (2012), Audacious Euphony. Chromaticism and the Triad’s Second Nature, Oxford und New York: Oxford University Press.
Dahlhaus, Carl (2001), »Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität (= Saarbrücker Studien zur Musikwissenschaft 2), in: ders., Alte Musik. Musiktheorie bis zum 17. Jahrhundert – 18. Jahrhundert (= Gesammelte Schriften 3), hg. von Hermann Danuser in Verbindung mit Hans-Joachim Hinrichsen und Tobias Plebuch, Laaber: Laaber, 11–307 [Erstdruck: Kassel u.a.: Bärenreiter 1967].
––– (2003), »Zur Problemgeschichte des Komponierens«, in: ders., 19. Jahrhundert III. Ludwig van Beethoven – Aufsätze zur Ideen- und Kompositionsgeschichte – Texte zur Instrumentalmusik (= Gesammelte Schriften 6), hg. von Hermann Danuser in Verbindung mit Hans-Joachim Hinrichsen und Tobias Plebuch, Laaber: Laaber, 447–473 [Erstdruck in: ders. (1974), Zwischen Romantik und Moderne. Vier Studien zur Musikgeschichte des späteren 19. Jahrhunderts (= Berliner musikwissenschaftliche Arbeiten 7), München: Katzbichler 1974, 40–73].
––– / Robert O. Gjerdingen (1990), Studies on the Origin of Harmonic Tonality, Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Einstein, Alfred (1978), Mozart. Sein Charakter – Sein Werk, Frankfurt a.M.: Fischer.
Esfeld, Martin (2002a), Holismus in der Philosophie des Geistes und in der Philosophie der Physik, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
––– (2002b) »Was besagt semantischer Holismus? Zwei Möglichkeiten der Konzeptualisierung«, in: Holismus in der Philosophie. Ein zentrales Motiv der Gegenwartsphilosophie, hg. von Georg W. Bertram und Jasper Liptow, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 41–58.
––– (2003), »Holismus und Atomismus in den Geistes- und Naturwissenschaften. Eine Skizze«, in: Holismus und Individualismus in den Wissenschaften, hg. von Alexander Berg und Soelve I. Curdt, Frankfurt a.M.: Lang, 7–21.
Falconer, Keith, (2002), »Gut gemacht. Haydns Schaffensweise und die Skizzen zu Streichquartetten«, in: Haydns Streichquartette. Eine moderne Gattung (= musik-konzepte 116), hg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, München: edition text + kritik im Richard Boorberg Verlag, 40–61.
Finscher, Ludwig (1974), Studien zur Geschichte des Streichquartetts I: Die Entstehung des klassischen Streichquartetts. Von den Vorformen zur Grundlegung durch Joseph Haydn, Kassel u.a.: Bärenreiter.
Froebe, Folker (2014), »Schema and Function«, Music Theory & Analysis 1/1–2, 121–140.
––– (2015), »On Synergies of Schema Theory and Theory of Levels. A Perspective from Riepel’s Fonte and Monte«, ZGMTH 12/1, 9–25. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/802.aspx
Gabriel, Markus (2013), Warum es die Welt nicht gibt, Berlin: Ullstein.
Gjerdingen, Robert O. (2007), Music in the Galant Style, Oxford und New York: Oxford University Press.
Grimm, Friedrich Melchior (1869), »Aus einem Berichte in der Correspondance littéraire II, 367; Paris, am 1. Dezember 1763«, zitiert nach Wurzbach 1869, 214–215.
Haas, Bernhard (2011), »Analytische Fragmente zum ersten Satz von Bruckners Sechster Symphonie«, in: Johannes Brahms und Anton Bruckner im Spiegel der Musiktheorie. Bericht über das Internationale Symposium St. Florian 2008 (= Hainholz Musikwissenschaft 16), Göttingen: Hainholz, 121–145.
––– / Diederen, Veronica (2008), Die zweistimmigen Inventionen von Johann Sebastian Bach, Hildesheim u.a.: Olms.
Haydn, Joseph (1974), Streichquartette op. 20 und op. 33 (= Wissenschaftliche Gesamtausgabe, Reihe XII, Band 3), hg. von Sonja Gerlach und Georg Feder, München: Henle.
Kant, Immanuel (1974), Kritik der reinen Vernunft, Werkausgabe Bde. 3/4, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Mozart Briefe und Dokumente – Online-Edition http://dme.mozarteum.at/DME/briefe/letter.php?mid=1040&cat
Neuwirth, Markus (2008), »Robert O. Gjerdingen, Music in the Galant Style, Oxford University Press 2007«, ZGMTH 5/2–3, 401–409.
Polth, Michael (2013), »Funktionen der Medial Caesura. Beobachtungen zu Mozarts Klaviersonaten KV 279 – KV 284«, in: Kreativität. Struktur und Emotion, hg. von Andreas Lehmann, Ariane Jeßulat und Christoph Wünsch, Würzburg: Königshausen & Neumann, 379–387.
Riepel, Joseph (1752–86), Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst […], Reprint als: Joseph Riepel, Sämtliche Schriften zur Musiktheorie, Bd. 1, Wien u.a.: Böhlau 1996.
Rohringer, Stefan (2013), »Zu Johannes Brahms’ Intermezzo h-Moll op. 119/1«, ZGMTH 10/1, 79–145.
Schafer, Hollace Ann (1987), »A Wisely Ordered Phantasie«: Joseph Haydn’s Creative Process from the Sketches and Drafts for Instrumental Music, Diss. Brandeis University.
Schwab-Felisch, Oliver (2009), »Wie totalitär ist die Schichtenlehre Heinrich Schenkers?«, in: Systeme der Musiktheorie, hg. von Clemens Kühn und John Leigh, Dresden: Sandstein, 33–55.
Seel, Martin (2002), »Für einen Holismus ohne Ganzes«, in: Holismus in der Philosophie. Ein zentrales Motiv der Gegenwartsphilosophie, hg. von Georg W. Bertram und Jasper Liptow, Weilerswist: Velbrück, 30–40.
Simons, Peter (1987), Parts. A Study in Ontology, Oxford: Oxford University Press.
Somfai, László (1972), »›Ich war nie ein Geschwindschreiber…‹. Joseph Haydns Skizzen zum langsamen Satz des Streichquartetts Hoboken III: 33«, in: Festskrift Jens Peter Larsen. 14. VI. 1902-14. VI. 1972, hg. von Nils Schiørring, Henrik Glahn und Carsten E. Hatting, København: Wilhelm Hansen, 275–284.
––– (1980), »An Introduction to the Study of Haydn’s Quartet Autographs (with special attention to Opus 77/G)«, in: The String Quartets of Haydn, Mozart, and Beethoven. Studies of the Autograph Manuscripts. A Conference at Isham Memorial Library March 15–17, 1979 (= Isham Library Papers 3), hg. von Christoph Wolff und Robert Riggs, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980, 5–51.
Wurzbach, Constantin von (1869), Mozart-Buch, Wien: Wallishausser.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.