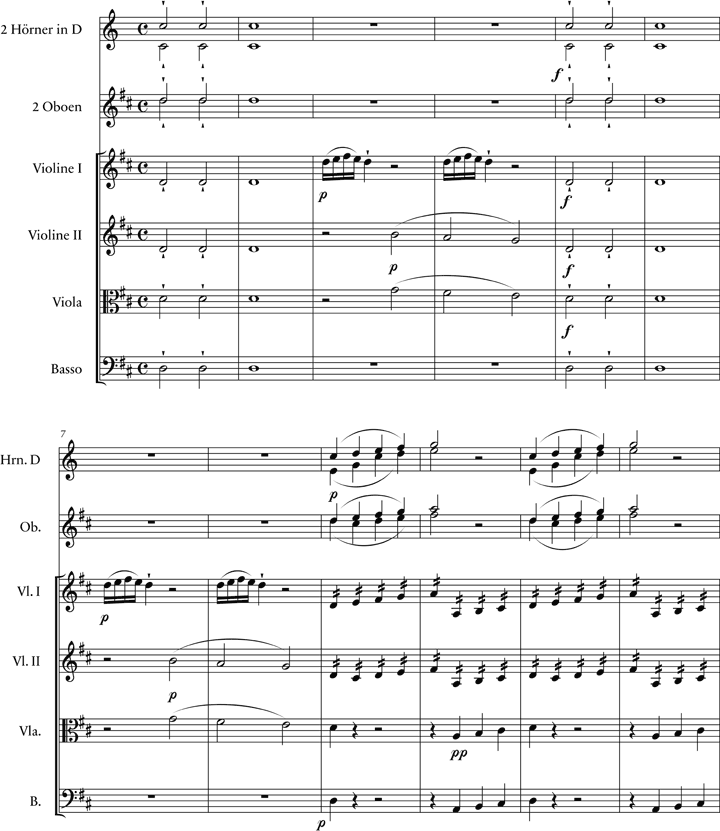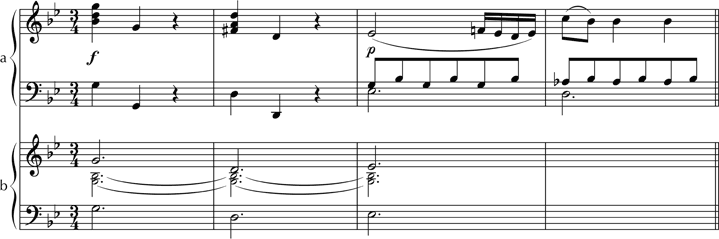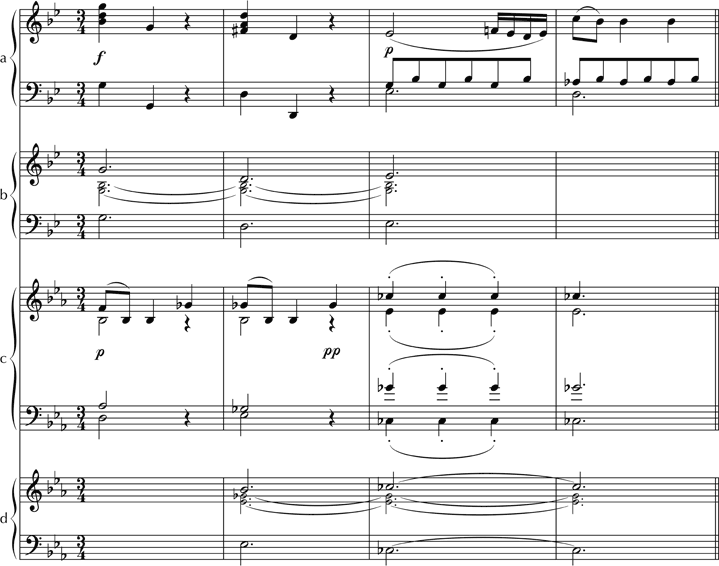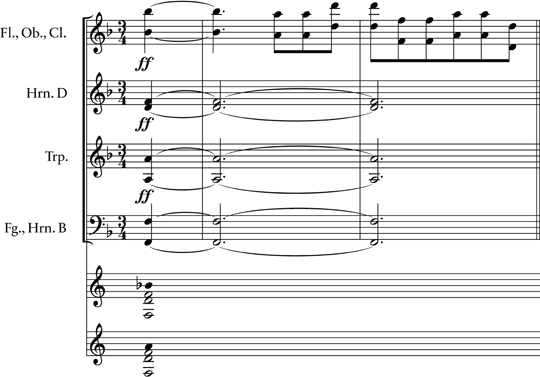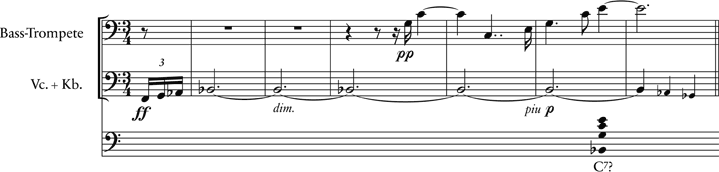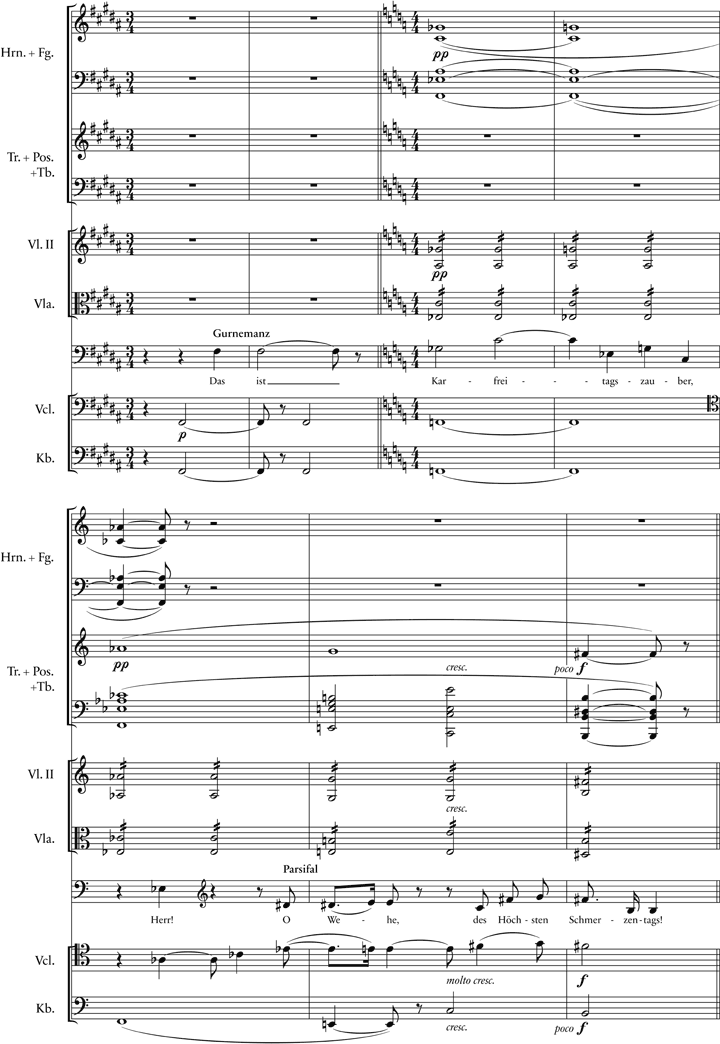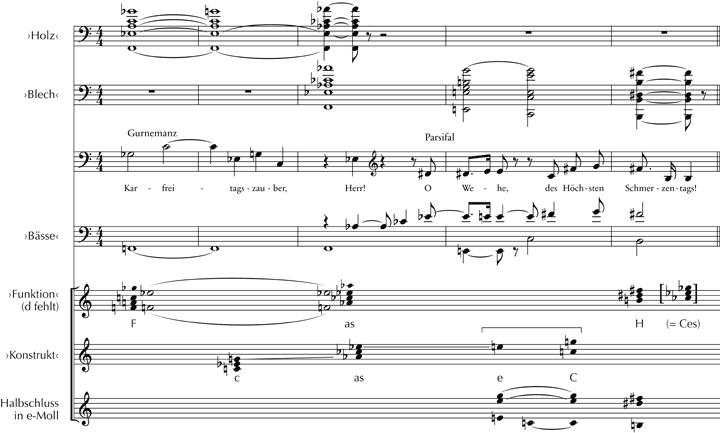Zum Verhältnis von Harmonik und Instrumentation ›vor Wagner‹
Michael Polth
Bereits in Kompositionen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts lassen sich Akkorde finden, deren harmonische Funktionen nicht allein durch Merkmale begründet werden, die in den Bereich tonaler Kategorien fallen (wie Akkordtyp, Stufenrelation, Beziehung auf ein tonales Zentrum), sondern auch durch solche, die von instrumentatorischen und dynamischen Entscheidungen des Komponisten herrühren. Erklären lassen sich diese harmonischen Funktionen, wenn man sie mit anderen Neuerungen nach 1750 in Verbindung bringt: mit den Funktionen der Formabschnitte in Sonatensätzen, mit ›mediantischen‹ Akkordverbindungen und mit Tonkonstellationen, die Dreiklängen und Septakkorden äußerlich gleichen, deren Töne sich aber nicht zu traditionellen harmonischen Einheiten verbinden. Herausgearbeitet wird, inwiefern die Instrumentation bei diesen Neuerungen eine konstitutive Rolle spielt.
Already in compositions from the mid-eighteenth-century, chords can be found whose harmonic function is not just founded by characteristics stemming from the area of tonal categories (type of chords, relation of scale degree, relatedness to a tonal center), but also by such which are based on composers’ decisions regarding instrumentation and dynamics. Such harmonic functions can be explained by associating them with other innovations after 1750: the functions of formal parts in sonata movements, mediant chord progressions, and constellations of pitches which are externally similar to triads and seventh chords, yet not fused to traditional harmonic units. It will be demonstrated how instrumentation plays a constitutive part for these innovations.
Dass Harmonik und Klangfarbe in den Musikdramen Richard Wagners (beispielsweise im Ring) in einem engen Verhältnis zueinander stehen, hat Wagner selbst angemerkt, und Theodor W. Adorno charakterisiert dieses Verhältnis näher, indem er in seiner Schrift Versuch über Wagner von der »harmonischen und koloristischen Dimension« des ›Klangs‹ spricht.[1] Im ›Klang‹ bilden harmonische und klangfarbliche Aspekte phänomenal eine untrennbare Einheit. Konsequenterweise geht Tobias Janz in seiner Untersuchung Klangdramaturgie von der »Kategorie ›Klang‹ – verstanden zunächst als allgemeiner Begriff für die sinnliche Präsenz der Musik –«[2] aus und analysiert nicht nur die instrumentatorischen, sondern auch die satztechnischen Gegebenheiten der Kompositionen als Mittel der Klanggestaltung (etwa unter dem Begriff ›Textur‹).
Angesichts der Einigkeit über die kompositorische und ästhetische Untrennbarkeit von Harmonik und Klangfarbe bzw. von Satztechnik und Instrumentation liegt die Frage nahe, ob es in der ›modernen Harmonik‹ Wagners ›moderne harmonische‹ Funktionen gibt, die auf der Einheit harmonischer und klangfarblicher Aspekte gründen. Oder anders: Gibt es Akkord-Funktionen, die zu ihrer Konstitution – neben traditionell ›systemischen‹ Aspekten wie Akkord-Typ, satztechnischer Verbindung und Tonartbezug – eine bestimmte Disposition der Klangfarben voraussetzen? Gibt es also Akkord-Funktionen, die ohne klangfarbliche Bestimmung gar nicht zustande kämen?
Gemessen an der Selbstverständlichkeit, mit der die »Instrumentationstechnik [als] ein integraler Bestandteil der Komposition«[3] angesehen wird, findet sich erstaunlich wenig über das Verhältnis speziell zwischen Harmonik und Instrumentation. Adorno liefert eine interessante Analyse zur Wechselwirkung zwischen Instrumentation und Syntax: Anhand einer Periode aus dem Lohengrin zeigt er, wie die Instrumentation dem syntaktischen Schema »eine neue kompositorische Dimension«[4] hinzufügt, weil sie das Verhältnis zwischen Vorder- und Nachsatz sowie den Übergang zwischen den Halbsätzen auf eine neue Weise beleuchtet, die nicht auf (traditionell) syntaktische Aspekte reduzierbar ist: Das Verhältnis erscheint als eines zwischen (angedeutetem) Tutti und Solo und der Übergang als »Flexion«. Während Adorno bei der Syntax funktionale Bestimmungen zeigt, die ohne Instrumentation nicht zustande kämen, spricht er im Zusammenhang mit der Harmonik lediglich von der gewandelten Bedeutung der Dissonanzen und der Chromatik.[5]
Zur spezifischen Frage nach Akkord-Funktionen, die durch Instrumentation fundiert sein könnten, findet sich auch bei Giselher Schubert und Carl Dahlhaus wenig.[6] Nur Tobias Janz berichtet im Kapitel »Harmonik als Klang« über Beobachtungen, die in die Richtung dieses Beitrags gehen. Allerdings werden harmonische Erscheinungen bei ihm unter dem Gesichtspunkt des Klangcharakters verhandelt. So heißt es etwa über die Quartsextakkorde, dass sie »sich in der Harmonik des Ring ebenso wie die einfachen Dreiklänge zu einer eigenständigen harmonischen Farbe« emanzipieren.[7] Dabei steht die Frage nach einer eigenen harmonischen Bedeutung bei Janz latent im Raum, wird aber nicht offen angesprochen, sondern nur gelegentlich gestreift:
Etwas von der Qualität eines in den Baß projizierten Quinttons haftet insgesamt den Quartsextakkorden Wagners an, auch wenn sich häufig die dominantische Bedeutung der Quartsextakkorde, bei der der Baßton als Grundton und die Oberstimmen als Dissonanzen erscheinen, als Qualität mit hereingemischt. Gerade die absolut gesetzten Quartsextakkorde entfalten jedoch an vielen Stellen der Partituren den ihnen eigentümlichen Klangcharakter.[8]
Dieser Beitrag wird die Überlegungen von Janz um den Aspekt der ›modernen harmonischen Funktionen‹ ergänzen.
Möchte man das, was Adorno zum Verhältnis zwischen Instrumentation und Syntax beigetragen hat, auf das Verhältnis zwischen Instrumentation und Harmonik übertragen, genügt es nicht, Harmonik und Klangfarbe als untrennbare ›Dimensionen‹ des Klangs zu begreifen oder eines kompositorischen Konzepts von Klang; denn mit der Vorstellung, dass der Komponist satztechnische und instrumentatorische Entscheidungen auf das Ziel eines einheitlichen ›Klangs‹ trifft, wird das enge Verhältnis lediglich als intendiert behauptet, aber nicht konkret bestimmt.[9] Bestimmt wäre es, wenn benannt würde, ›als was‹ die Einheit von Harmonik und Klangfarbe innerhalb eines kompositorischen Kontextes erscheint, oder: ›als was‹ Ereignisse gehört werden, wenn sie von satztechnischen und instrumentatorischen Entscheidungen zugleich abhängen.
* * *
Dieser Beitrag wird sich vor allem der harmonischen Seite des Problems widmen[10] und Beispiele für ›moderne harmonische Funktionen‹ anführen, die ohne klangfarbliche Bindung des jeweiligen Akkordes nicht zustande kämen. Diese Beispiele, die Stichproben bilden, beginnen chronologisch etwa in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Zwar hat erst Wagners Musik das beschriebene Verhältnis zwischen Harmonik und Klangfarbe im ›Klang‹ vor Augen geführt, aber die wechselseitige Abhängigkeit hat eine ›Vorgeschichte‹, die um etwa 1740 mit der Herausbildung einer Tonalität begann, in deren Funktionen Aspekte von Harmonik, Instrumentation und Form vermittelt sind.
Die Beispiele werden zeigen, dass die Bestimmung des Verhältnisses zwischen Harmonik und Instrumentation mehr ein Problem für das Verständnis der Harmonik als der Instrumentation darstellt; denn auf dem Gebiet der Harmonik hindern alte Traditionen bis heute daran, die Akkord-Funktion in etwas anderem als in der Stufenrelation oder in der Relation zur lokalen Tonart zu erblicken.[11] Darum hat dieser Textes auch zu klären, welche Funktionen das überhaupt sind, die unter anderem durch Instrumentation begründen werden können. Die ›modernen harmonischen Funktionen‹, die von der ›stofflichen‹ Dimension des Tons abhängig sind, zeigen sich ohnehin nur, wenn harmonische Funktionen feinkörnig unterschieden werden.
I. ›Teil-Sein‹ – ›Klang‹ – ›Stofflichkeit‹
Nach Bruno Haas[12] ist eine Funktion (beispielsweise die Funktion eines musikalischen Ereignisses) die Bestimmung des Teil-Seins. Eine ›harmonische Funktion‹ etwa wäre die Art und Weise, wie ein Akkord[13] Teil eines kompositorischen Gefüges ist.[14]
Ein Akkord ist nicht allein dadurch Teil des Gefüges, dass er zwischen anderen Akkorden einen Platz einnimmt, sondern dadurch, dass er das Gefüge mit konstituiert. Mit-Konstitution wiederum bedeutet, dass er mit den Akkorden, mit denen zusammen er das Gefüge bildet, zusammenhängt (ohne Zusammenhang bilden Akkorde kein Gefüge). Akkorde hängen zusammen, wenn sie für den Hörer einander nicht ›gleichgültig‹ folgen, sondern sich in ihrer Abfolge wechselseitig beeinflussen. In der Musik des 18. und 19. Jahrhundert aber können sich Akkorde nicht anders beeinflussen als dadurch, dass sie sich gegenseitig in ihrem Klang-Sein verändern. Als Teil eines Gefüges ›klingt‹ ein Akkord so, wie er ›klingt‹, weil es bestimmte andere Akkorde gibt (und Entsprechendes gilt für die anderen Akkorde). In Bezug auf den Verlauf einer Komposition könnte man auch sagen: Ereignisse, die mit einem späteren Akkord zusammenhängen, wirken in der Art und Weise, wie der Akkord ›klingt‹, weiter.
Das Teil-Sein wird als ›Klang-Sein‹ eines Akkordes erfahren. Bestimmte Momente am Klang lassen die Abhängigkeit eines Akkordes von bestimmten anderen Ereignissen der Komposition vernehmlich werden. Teil-Sein und Klang-Sein sind insofern der Sache dasselbe, als beide Begriffe dieselbe ›Verwiesenheit‹ des Akkordes auf Anderes meinen. Nur zielt der Ausdruck Teil-Sein vor allem auf die Strukturiertheit des Gefüges, zu dem der Akkord gehört, der Ausdruck Klang-Sein auch darauf, dass Strukturiertheit vom Hörer erlebt wird. Es ist möglich, von den Eigenschaften, die ein Akkord als ›Klang‹ im musikalischen Kontext ausprägt, auf die Ereignisse schließen, mit denen er zusammenhängt (ein solchermaßen ausgerichtetes analytisches Vorgehen wäre insofern nicht trivial, als ein Ereignis nicht mit allen anderen auf gleiche Weise zusammenhängt). Die konkreten Abhängigkeiten, die eine solche Analyse erbringt, lassen sich als Strukturen festhalten. Eine Struktur im hiesigen Sinne ist das, was man findet, wenn man die je spezifischen Beziehungen zwischen Akkorden anhand ihres ›Klanges‹ bestimmt.
* * *
Nach traditioneller Vorstellung können nicht alle Momente eines ›Klangs‹ ein Teil-Sein begründen, sondern nur ›systemische‹, also solche, die sich im Sinne ›vorgängiger Organisationsformen‹ auf funktionale Einheiten beziehen (beispielsweise die Tonhöhe). Solche Momente – sie haben mit den ›zentralen Toneigenschaften‹ nach Jaques Handschin[15] zu tun – rekurrieren in der Regel auf Kategorien der Tonalität, Harmonik, Syntax und Metrik. Auch Gunnar Hindrichs hat jüngst den Klang als ein »identifizierbares tonsystematisch Hörbares« bestimmt:[16]
Der musikalische Klang […] unterscheidet sich sowohl von den physikalisch beschreibbaren Schallereignissen als auch von den phänomenalen Hörereignissen durch seine diastematische, rhythmische, melodische und harmonische Organisation.[17]
Die von Hindrichs genannten Organisationsaspekte sind allesamt systemisch.[18] Sie ermöglichen, dass ein ›Klang‹ ein Objekt sein kann:
Der Ausgangspunkt der gesuchten kategorialen Bestimmung ist der Sachverhalt, daß musikalische Klänge Objekte des Hörens sind. Objekte sind nicht einfach Vorkommnisse des Hörens, sondern unterliegen Bedingungen einer Konstanz, die auch unabhängig von ihrem Gehörtwerden besteht.[19]
Die Konstanz aber gründet darauf, dass Klänge aufgrund ihrer tonsystematischen Dimensionen ein relationales Gefüge bilden können. Durch ihre Einbindung in dieses Gefüge erhalten sie eine wiedererkennbare Identität. Wenn man die Vorstellungen von Haas und Hindrichs zusammenbringt, dann ist es also das tonsystematisch fundierte Teil-Sein, das den Objektcharakter von Klängen begründen kann.[20]
Momente am Klang, die allein mit der ›stofflichen‹ oder ›materialen‹ Seite der Töne zu tun haben, sind in der Regel nicht-systemisch, an ihnen wird kein Bezug auf funktionale Einheiten beobachtet. Zu diesen Momenten gehören beispielsweise diejenigen, auf die der Komponist durch Instrumentation (im Sinne der Instrumentenauswahl), Instrumentenbehandlung (die Art, wie der Komponist die ausgewählten Instrumente konkret spielen lässt) oder dynamische Vorschriften Einfluss nimmt.[21] Dass an diesen stofflichen Momenten des Klanges ein Bezug auf funktionale Einheiten nicht beobachtet wird, bedeutet nicht, dass sie überhaupt kein Teil-Sein begründen könnten. Beispielsweise kann ein Ereignis mit seinem dynamischen Wert an einer Crescendo-Kurve teilnehmen. Allerdings wäre dieses Teil-Sein kein systemisches, weil eine Crescendo-Kurve alleine noch keine funktionale Einheit bildet.[22]
Wenn ›moderne harmonische Funktionen‹ auf der Einheit systemischer und nicht-systemischer Momente an den Zusammenklängen beruhen, stellt sich die Frage, wie nicht-systemische Momente überhaupt das Teil-Sein eines Zusammenklangs mitbegründen können (ohne dabei nur eine Hilfsfunktion zu den systemischen Momenten auszuüben). Umgekehrt könnte man auch sagen: Die Relativierung der systemischen Momente (dadurch, dass sie nicht mehr allein als hinreichend für die Konstitution von Funktionen gelten) erscheint kontraintuitiv: Auch wenn der Parsifal, im Klavierauszug gespielt, erheblich an Wirkung und Schönheit verliert, ist er mühelos als Parsifal zu identifizieren, und keineswegs werden seine Harmoniefolgen unverständlich, nur weil die Instrumentation wegfällt.
II. ›Moderne harmonische Funktionen‹
A. Form-Funktionen – Phasen – Sonatenform
Es ist hinlänglich bekannt, dass ›die‹ Sonatenform mehr gewesen ist als der Aufbau von Sätzen oder die Abfolge von Formteilen. Sie war zu allen Zeiten zwischen 1750 und (mindestens) 1850 eine jeweils bestimmte historische Art und Weise der Bildung von musikalischem Zusammenhang, der sich allgemein nur in der Formulierung von Prinzipien und konkret nur in der Analyse einzelner Sätzen greifen lässt. Nicht umsonst haben sich für die Bestimmung dessen, was Sonatenform in den ersten hundert Jahren ihres Daseins gewesen ist, so unterschiedliche Begriffe wie Sonaten-Prinzip (›sonata principle‹) und Sonaten-Stil (›sonata style‹) herausgebildet.[23]
Im Zusammenhang mit den hiesigen Überlegungen ist von Interesse, dass die Entstehung der Sonatenform im 18. Jahrhundert mit der Entstehung einer Tonalität einherging, in der Akkord-Funktionen durch (traditionell) systemische, aber auch stoffliche Momente am Klang konstituiert wurden.[24] Darüber hinaus begründen diese Akkord-Funktionen die ›neuen Form-Funktionen‹ der Abschnitte (sie machen die einschlägig bekannten Formteile der Sonatensätze möglich). Wie geschieht dies? Beispielsweise ist die Eröffnung in ausgedehnten Sinfoniesätzen nicht mit dem faktischen Beginn identisch, sondern bildet eine ›Phase‹, die sich gegebenenfalls aus mehreren Taktgruppen zusammensetzt.[25] Taktgruppen gehören zu einer ›Phase‹, wenn sie dieselbe Form-Funktion ausbilden. Man könnte sagen: Im Gegensatz zur Musik des frühen 18. Jahrhunderts ist ›Sonatenmusik‹ eine solche, deren Formverlauf aus ›Phasen‹ bestehen kann.
In der Sinfonie in D-Dur von Johann Stamitz, der ersten aus der Sammlung La melodia germanica, besteht die Eröffnungsphase aus 23 Takten. Mit dem Erreichen des Halbschluss-Klanges A-Dur (T. 24) betritt die Musik das ›Innere‹ des Sonatensatzes. Die Phase besteht aus drei Taktgruppen von je acht bzw. sieben Takten Länge: einem Stehen auf dem Grundton D (mit interpolierten kurzen Melodie-Phrasen), einer ›Walze‹ und einem Tutti.
Beispiel 1: J. Stamitz, Sinfonie D-Dur (La Melodia Germanica Nr. 1), 1. Satz Takt 1–24
Die Form-Funktion der Eröffnungsphase wird durch die Funktion der ›Anfangstonika‹ begründet. Die ›Anfangstonika‹ ist – vorläufig gesagt – so etwas wie ein Funktionstyp, unter den alle Tonika-Akkorde der Eröffnungsphase fallen, die als repräsentativer Beginn der Tonart erfahren werden.[26] In Beispiel 1 handelt es sich um die Töne oder Akkorde zu Beginn der drei Taktgruppen (T. 1, 9 und 17) (innerhalb jeder Taktgruppe werden die betreffenden Töne oder Akkorde wiederholt), ein satztechnisches Merkmal ist die ›Grundtönigkeit‹: In Ober- und Bassstimme erscheint der Grundton d.
Die unterschiedlichen Ereignisse mit der Funktion ›Anfangs-Tonika‹ sind satztechnisch und stofflich gegeneinander differenziert:
In der ersten Taktgruppe erklingt die ›Anfangs-Tonika‹ nur als Basston (zum Unisono erweitert und von Melodie-Phrasen in Terzparallelen unterbrochen) und in tiefer Lage (zumindest in den Violinen). Die vollständige Besetzung wechselt mit einer reduzierten ab. Die rhythmische und melodische Bewegung des Basses ist statisch, die Dynamik wechselt alle zwei Takte.
Geradezu das Gegenteil an Merkmalen bietet die dritte Taktgruppe: Die ›Anfangs-Tonika‹ wird hier durch einen vollständigen Tonsatz (mit Ober- und Bassstimme sowie Mittelstimmen) in weiter Lage dargestellt. Die Tonika wird durch einen Wechsel zwischen Tonika und Dominante auskomponiert. Die Besetzung ist immer vollständig. Der Bass befindet sich in einer kontinuierlichen Achtelbewegung, die Dynamik ist stets Fortissimo.
Zwischen den Extremen der ersten und dritten Taktgruppe vermittelt die ›Walze‹. Sie schafft Übergange oder Übergangsstationen zwischen Unisono und vollständigem Tonsatz, zwischen harmonischem Stillstand und Pendelharmonik, im Bass zwischen Stillstand in Halben und kontinuierlicher Achtelbewegung, zwischen einseitig tiefer und weiter Lage sowie zwischen Piano und Fortissimo.
Die wechselnden Kombinationen aus ›systemischen‹ und ›stofflichen‹ Momenten lassen den Eindruck entstehen, dass in den ersten 23 Takten der Sinfonie eine einzige ›Anfangstonika‹ auskomponiert wird und dass dieses Auskomponieren durch eine allmähliche Gewinnung aller Dimensionen des Klanges geschieht: Die ›Anfangstonika‹, im ersten Takt nur ein unbeweglicher Basston, wird in den folgenden Taktgruppen um Oberstimme und Mittelstimmen ergänzt. Die Darstellung der ›Anfangs-Tonika‹ ist ein Prozess: technisch der Vervollständigung und ästhetisch der Reifung.[27]
Das latent Paradoxe dieser ›Anfangstonika‹, die eine einzige ist, aber in mehreren unterschiedlichen Ereignissen ›steckt‹, ist für die Formbildung nach 1740 nicht untypisch: Kompositionen können dreimal beginnen und doch nur einen Anfang besitzen; wenn sie im ersten Takt starten, haben sie eigentlich noch nicht angefangen, aber wenn sie im Tutti ›wirklich‹ anfangen, sind sie längst im Gange.[28]
Welche sind nun die ›modernen harmonischen Funktionen‹, die sich ohne stoffliche Momente nicht konstituieren können? Aus einer Perspektive, die harmonische Funktionen feinkörnig zu unterscheiden sucht, lautet die Funktion der Töne oder Akkorde in Takt 1, 9 und 17 selbstverständlich nicht: I. Stufe oder Tonika. Auch ist die maßgebliche Einheit, auf die hin die Ereignisse als Teile bezogen sind, nicht die Tonart D-Dur im Sinne der Funktionstheorie. Den Bezugspunkt bildet vielmehr eine prozesshafte Tonart, in der unter anderem ›Anfangs-‹ und ›Schluss-Tonika‹ unterschiedliche Funktionen darstellen (und nicht dieselbe Funktion lediglich an unterschiedlichen Stellen der Komposition). Darüber hinaus richtet sich das Teil-Sein der I. Stufen im engeren Sinne auf die konkrete (in dieser Komposition auskomponierte) Anfangs-Tonika. Diese konkrete Anfangs-Tonika, die zugleich eine harmonische und eine formale Einheit (diejenige der ersten Phase) darstellt, ist eine Funktion, die mit keinem einzelnen der Tonika-Ereignisse identisch ist, sondern als deren Einheit erscheint.[29] Die Funktion der einzelnen Tonika-Ereignisse innerhalb der Phase besteht in diesem speziellen Teil-Sein: als unvollständiges, vermittelndes oder erfülltes Vorkommnis der Anfangs-Tonika, und der Unterschied zwischen diesen Bestimmungen könnte ohne stoffliche Differenzierung gar nicht deutlich werden, weil er die Möglichkeiten der systemisch geleisteten Differenzierungen übersteigt.
Phasen, die durch wiederholte, aber stofflich differenzierte Funktions-Akkorde gebildet werden, finden sich auch bei Wagner. Das ›Ritornell‹ des ›Karfreitagszaubers‹ im dritten Akt des Parsifal erscheint fünfmal, und fünf Mal wird sein Beginn auf eigene Weise auskomponiert, wodurch eine einzige ›Anfangs-Tonika‹ in fünf Ereignissen erscheint.
B. Primäre und sekundäre Verbindungen
Die Bedeutung der stofflichen Bestimmungen für die ›modernen harmonischen Funktionen‹ von Akkorden lässt sich von Beispielen ablesen, in denen Instrumentation und Dynamik die Art der Akkordverbindung wesentlich mit-definieren. Geeignet hierfür sind besondere harmonische Wendungen, die zunächst, als sie neu waren, Sondereffekte gewesen sein mögen, allmählich aber in das normale Repertoire einwanderten.
1. ›Rückung‹
Der zweite Expositionsabschnitt aus Mozarts Klaviersonate KV 570, 1. Satz Takt 23ff. (die Takte 21–22 vermitteln zwischen erstem und zweitem Formteil) beginnt mit einem Es-Dur-Akkord, der durch seinen ungewöhnlich verhaltenen Charakter auffällt.
Beispiel 2: W.A. Mozart, Klaviersonate B-Dur KV 570, 1. Satz, Takte 17–24
Aus Sicht der Funktionstheorie ist der Es-Dur-Akkord ein Dur-Dreiklang in Grundstellung. Er repräsentiert die Subdominante innerhalb der Tonart B-Dur oder – sofern man annimmt, die Tonart habe in Takt 22 kurzfristig zu g-Moll gewechselt – den Tonikagegenklang. In jedem Fall aber wird er mit seinem Erscheinen spontan zur Tonika umgedeutet. Die Folge g-D-Es (in B-Dur: VI-III#-IV , in g-Moll: I-V-VI) erinnert sowohl an einen ›Parallelismus‹ als auch an einen Trugschluss. Vereindeutigt man die Akkordfolge jeweils in Richtung eines dieser Modelle (Beispiele 3b und c), zeigt sich allerdings, dass der Es-Dur-Akkord seine Eigenschaften ändert. In den veränderten Kontexten klingt er auf jeweils eigene Weise, nur nicht mehr so wie bei Mozart.
Beispiel 3: a. W.A. Mozart, Klaviersonate B-Dur KV 570, 1. Satz Takt 21–24; b. Änderung von a in einen ›Parallelismus‹; c. Änderung von a in eine Trugschluss-Kadenz
Die Klang-Differenzen geben Aufschluss über zwei entscheidende Voraussetzungen, unter denen sich der verhaltene Charakter des Es-Dur-Akkordes bei Mozart ereignet: eine satztechnische und eine stoffliche.
1. Die satztechnische betrifft die Herbeiführung des Akkordes in den Takten 21–22. Im Gegensatz zu den Versionen in Beispiel 3b und c enthalten die Takte bei Mozart keinen Außenstimmensatz (mit Ober- und Bassstimme). Vielmehr lässt sich anhand der identischen Ecktöne in rechter und linker Hand ein ›strukturelles Unisono‹ erkennen: die typische Bewegung einer Bassstimme (g-d-es), die in den höheren Registern verdoppelt wird.[30] Reduziert man das Geschehen auf eine Bassbewegung (und deren Oktavierung), kommt man dem Effekt in Mozarts Musik um vieles näher als in Beispiel 3b und c.
Beispiel 4: a. W.A. Mozart, Klaviersonate B-Dur KV 570, 1. Satz Takt 21–24; b. Änderung von a in ein Unisono
Das Verständnis vom Zusammenhang, das das Unisono (in Beispiel 4b gegenüber Beispiel 3b und c) auslöst, lässt sich vielleicht als Verlust einer traditionellen Stufendifferenz beschreiben. In Beispiel 3b und c sind – ungeachtet der Unterschiede im Detail – die Takte 22 und 23 durch einen Wechsel der Stufen geprägt (in B-Dur: III-IV oder in g-Moll: V-VI): Der D-Dur-Akkord wird in den Es-Dur-Akkord weitergeführt oder sogar aufgelöst. Das Unisono lässt eine alternative Auffassung zu: dass nämlich der Ton d in den Ton es ›gerückt‹ wird. Die ›Rückung‹ ist technisch ein Stufenwechsel, der ästhetisch jedoch nicht als Wechsel zwischen verschiedenen Akkorden, sondern als ›Neu-Platzierung‹ oder ›Höherstimmung‹ desselben Akkordes aufgefasst wird. Man könnte auch sagen: Gegenüber der ›Auflösung‹ wird mit ›Rückung‹ ein eigenes ›Anders-Sein‹ des späteren Akkordes gegenüber dem früheren Akkord ausgedrückt oder auch: eine andere Art der Verbindung (obwohl die Stufenfolge für sich genommen in allen Beispielen dieselbe ist). Dieses als ›Rückung‹ bezeichnete ›Anders-Sein‹ entspricht durchaus dem ›Klang‹ des Es-Dur-Akkordes, wenn er dem D-Dur-Akkord folgt: Er ist der ›D-Dur-Akkord‹, der unverhofft an anderer, ›höherer‹ Stelle wiederauftaucht. (Dass der ›gerückte‹ D-Dur-Akkord – ›systemisch‹ betrachtet – eine VI. Stufe darstellt und deshalb durch die Folge Es-G-c-F-B mit B-Dur vermittelt werden kann, steht zu der beschriebenen funktionalen Auffassung nicht im Widerspruch.)
2. Von besonderem Interesse ist die stoffliche Voraussetzung für den ›Klang‹ des Es-Dur-Akkordes: Die dynamische Angabe Piano legt hinsichtlich der Wahl zwischen Fortführung und Rückung eine Entscheidung zugunsten der Rückung nahe. Mit anderen Worten: Das stoffliche Moment beeinflusst das Teil-Sein, weil es die Art der Verbindung zwischen den Klängen mit-definiert (eben als Rückung).
Die Rückung ist also eine Verbindung auf sekundärer Ebene, die durch Maßnahmen der Verbindung und Trennung auf primärer Ebene fundiert wird. Die primäre Verbindung besteht in der Stufenrelation V-VI (in g-Moll) oder III#-IV (in B-Dur). Zur Rückung wird diese Verbindung aber erst, wenn sie auf bestimmte Weise aufgefasst werden kann, wenn nämlich der zweite Akkord gegenüber dem ersten als verschoben erlebt wird. Dazu sollte der zweite Akkord unter anderem eine unerwartete (unvorbereitete) Tonika darstellen und charakterlich aus dem bisherigen Geschehen ausscheren. Um diese Bestimmungen zu ermöglichen, kommen die erwähnten Mittel (das Unisono und das plötzliche Piano) ins Spiel. Mit anderen Worten: Die Funktion des ›gerückten‹ Akkordes ist das Teil-Sein in einer Akkordverbindung, die nicht allein durch Stufenrelationen, sondern durch die Art des klanglichen Erscheinens der beteiligten Akkorde definiert ist.[31]
2. Die ›aufgedeckte Hintergrund-Tonika‹
Der Klang des Es-Dur-Akkordes in Beispiel 3b und c entspricht nicht demjenigen in Beispiel 3a, weil Parallelismus und Trugschluss keine funktionalen Äquivalente zum Geschehen der Takte 21 bis 23 bei Mozart darstellen. Obwohl satztechnisch eine hohe Ähnlichkeit zwischen den Beispielen 3a, b und c besteht, handelt es sich um unterschiedliche Arten der (sekundären) Akkordverbindung. Dem Original ebenfalls nahe steht eine vereinfachte Version, die den D-Dur-Akkord zugunsten eines liegenden g-Moll-Akkordes auslässt.
Beispiel 5: a. W.A. Mozart, Klaviersonate B-Dur KV 570, 1. Satz Takt 21–24, mit verändertem Takt 22; b. Änderung in eine unmittelbare Folge g-Moll – Es-Dur
Die weitgehende Bewahrung des Klangs von Es-Dur in Beispiel 5b zeigt, dass auch der Es-Dur-Akkord in Mozarts Komposition vom g-Moll-Dreiklang strukturell abhängt. Technisch entspricht die Relation zwischen g-Moll und Es-Dur einem 5-6-Austausch (der Quintton d von g-Moll wird gegen den Grundton von Es-Dur ausgetauscht). Die zuvor beschriebene Rückung erscheint als Mittel, um das Verhältnis zwischen g-Moll und Es-Dur in eine bestimmte Richtung zu modellieren (D-Dur wirkt wie ein Durchgangsklang[32]).
Im Hinblick auf die Beziehung g-Moll – Es-Dur könnte man die Funktion des Es-Dur-Akkordes als ›aufgedeckte Hintergrund-Tonika‹ bezeichnen. Metaphorisch gesprochen, erzeugt der 5-6-Austausch (verbunden mit der Rückung und der Piano-Anweisung) den Eindruck, dass weniger ein g-Moll-Akkord in einen Es-Dur-Akkord übergeht, als dass vielmehr ein vordergründiger g-Moll-Akkord beiseite tritt und den Blick auf einen hintergründigen Es-Dur-Akkord freigibt. Diese Beschreibung soll erhellen, dass der dynamische Wechsel zu den konstitutiven Momenten der harmonischen Verbindung gehört. Ähnlich wie im letzten Kapitel ist nämlich die Akkordfolge g-Moll – Es-Dur die Verbindung, die sie ist, weil der zweite Akkord vom ersten auch auf bestimmte stoffliche Art unterschieden wird.[33] Zwei weitere Beispiele legen die Vermutung nahe, dass die Funktion der ›aufgedeckten Hintergrund-Tonika‹ im späten 18. Jahrhundert und danach zum festen ›Funktionsrepertoire‹ der Komponisten gehört hat.
Beispiel 6: a. W.A. Mozart, Klaviersonate B-Dur KV 570, 1. Satz Takt 21–24, b. Interpretation als 5-6-Austausch, c. J. Haydn, Sinfonie Nr. 103 Es-Dur, 3. Satz Takt 21–24, d. Interpretation als 5-6-Austausch
Die Synopse in Beispiel 6 lässt erkennen, dass Joseph Haydn im Menuett seiner Sinfonie Nr. 103 (dort zu Beginn des Mittelteils) ähnlich verfährt wie Mozart im besprochenen Beispiel. Entscheidend ist auch hier, dass die Relation zwischen es-Moll und Ces-Dur nicht allein satztechnisch (als struktureller 5-6-Austausch), sondern auch stofflich (als dynamischer Wechsel und – in Beispiel 6 nicht erkennbar – durch Hinzutritt mehrerer Blasinstrumente) definiert ist.
Beispiel 7: R. Wagner, Götterdämmerung, 1. Akt, Takt 1–2
Die ›aufgedeckte Hintergrund-Tonika‹ begegnet zu Beginn der Götterdämmerung. Auch hier ist es neben dem satztechnischen 5-6-Austausch (der in den jeweils höchsten Tönen der Akkorde angedeutet wird) der Wechsel von Dynamik und Instrumentation, der die spezielle Funktion des Ces-Dur-Akkordes konstituiert.
Im instrumentalen Vorspiel des Musikdramas wiederholt sich bekanntlich der beschriebene Vorgang. Auch ein des-Moll-Akkord und ein ›Dominantseptnonakkord‹ über D werden im Hintergrund ›sichtbar‹, nachdem ein es-Moll-Akkord beiseite getreten ist. Bei Wagner lässt sich der Gegensatz zwischen den Vorkommnissen von es-Moll und den jeweiligen Folgeakkorden zudem durch die Wortpaare eng-weit und statisch-fließend charakterisieren, das Merkmal von Weite und Fließen gehört zur Funktion des jeweils zweiten Akkordes. Der erste Gegensatz (eng-weit) lässt sich bereits bei Haydn beobachten, der zweite (statisch-fließend) bei Mozart. In Anlehnung an ein Zitat von Adorno (»die latente Intention der Form ist ausinstrumentiert«[34]) könnte man sagen: Die bereits im 18. Jahrhundert erkennbare Intention der Akkordverbindung, die bereits bei Haydn und Mozart eine systemisch-stofflich fundierte gewesen ist, wird bei Wagner durch einen gesteigerten Einsatz instrumentatorischer (stofflicher) Mittel um Aspekte bereichert und dadurch vertieft.[35]
Einerseits erscheint die Folge es-Moll – Ces-Dur – es-Moll – des-Moll funktionstheoretisch als Aneinanderreihung von Tonika-Akkorden[36], andererseits besitzen die Akkorde signifikant unterschiedliche Klangeigenschaften, die durch die funktionstheoretische Rubrizierung nicht erfasst werden. Ernst Kurth nannte dieses Phänomen bekanntlich »absolute Klangwirkung«, den »Eigeneffekt des einzelnen Akkords«.[37] Anders als es der Ausdruck suggeriert, hat Kurth erkannt, dass die »absolute Klangwirkung« von der Einbindung des Akkordes in einen musikalischen Kontext herrührt. Sie ist ›ästhetischer Schein‹[38], der nach Kurth entsteht, wenn es zwar einen Kontext gibt, dieser aber nicht im traditionellen Sinne harmonisch-tonal ist:
Ein Klang mag noch so deutlich zur Eigenbedeutung erhoben sein und aus dem Zusammenhang herausragen, seine Wirkung ist immer zumindest durch sein Verhältnis zum vorangehenden mit beeinflußt, wenn schon seine Beziehung zur Tonart durch deren volle Auflösung aufgehoben ist.[39]
Die Prinzipien eines kompositorischen Kontextes (zumindest in Bezug auf die ›harmonische Dimension‹), dessen Teilmomente nicht durch eine lokale Tonart vermittelt sind, beschreiben die Neo-Riemannian Theory[40] und die Tonfeld-Theorie nach Albert Simon. Nach Simon erscheint die Akkordfolge es-Moll – Ces-Dur als authentischer, die Folge es-Moll – des-Moll als plagaler Schritt. Alle drei Akkorde zusammen ergänzen sich zu einem Heptaton von fes bis b (wobei – nach Haas zuerst das ›Viereck‹ es-b – ces-ges erklingt, hernach die vermittelnde Quinte des-as samt fes). Die Bestimmung eines Akkordes wird also nicht aus der ›lokalen Tonikalität‹, sondern aus der Relation zu den vorherigen Akkorden gewonnen. Das Ganze, auf die die Klänge bezogen werden, ist keine Tonart, sondern ein strukturierter Tonvorrat, der durch die Akkordfolge auf jeweils eigene Art artikuliert wird. (Solange allerdings die ›koloristische Dimension‹ der Akkordfolge nicht in die Analyse einfließt, bleibt die Bestimmung des Teils-Seins unvollständig.)
C. Sekundäre Klangeinheiten
In der ›modernen Tonalität‹ des mittleren und späten 19. Jahrhunderts ist die Einheit des Dreiklangs oder Septakkordes nicht mehr selbstverständlich gegeben, sondern bildet für den Komponisten eine Option. Ob sich drei oder vier zeitgleich erklingende Töne, deren Aufbau einem Dreiklang oder Septakkord entspricht, zur (traditionellen) Einheit eines Dreiklangs oder Septakkordes zusammenschließen, steht nicht von vornherein fest, sondern hängt von den Umständen des kompositorischen Kontextes ab. Genauso gut ist ein Zusammenschluss nach anderen Gesichtspunkten möglich.[41]
Bereits bei Stamitz ließ sich (bei feinkörniger Unterscheidung der harmonischen Funktionen) beobachten, dass die Einheit des Dreiklangs der ›erfüllten Anfangs-Tonika‹ nicht selbstverständlich vorausgesetzt wurde, sondern erst durch Vermittlung innerhalb eines Formprozesses entstand. Das ›Dreiklang-Sein‹ wird bereits hier nicht mehr als ›Material‹ ausgewiesen, sondern als Moment der Form thematisiert.
Die Quintfallsequenz im Finale von Mozarts Sinfonie KV 551 (dort in der Reprise Takt 243–252) ist von einer ›Schrägheit‹, die ihresgleichen sucht. Grund dafür ist die Reihung von ›Akkordpaaren‹, die an ›Konstrukte‹[42] erinnern: F-cis, B-fis, Es-h, As-e und Des-a.[43] Traditionell wird man die angeblichen ›Mollakkorde‹ als Durchgangserscheinungen interpretieren: Der vermeintliche Grundton cis im ersten ›Akkordpaar‹ ist in Wirklichkeit ›transitorisch‹ zum Zielton d, statt eines cis-Moll-Akkordes ist ein Dominantseptakkord auf E gemeint (diese Interpretation leugnet keineswegs das Ungewöhnliche dieser Sequenz, sondern zeigt an ihr eine traditionelle Form der Vermittlung auf, um von dieser wiederum die Besonderheit der Inszenierung abzuheben). Die Instrumentation der Sequenz trennt die ›Akkordsubstanz‹ von der Durchgangsbewegung: Die Dreiklangstöne von F-Dur und E-Dur liegen in den Streichern, die Bewegung, die den Durchgangston cis enthält, erklingt in den Holzbläsern (c-cis-d in drei Oktaven). Interessant sind die Auswirkungen dieser Disposition auf das Verständnis der Zusammenklänge: Die klangfarbliche Differenzierung zwischen harmonieeigenen und harmoniefremden Tönen lässt die angeblichen ›Mollakkorde‹ als zusammengesetzt und damit ›falsch‹ erscheinen. Sogar die vermeintlichen Auflösungstöne (die ›Septimen‹ des jeweiligen Zielakkordes) verbinden sich mit den jeweiligen Tönen der Streicher nicht zu einer Akkordeinheit. Mit anderen Worten: Es erklingen an jeweils zweiter Stelle keine Dominantseptakkorde, und die ›Durchgangstöne‹ werden nicht in Akkordseptimen aufgelöst.
* * *
Theodor W. Adorno hat das Dissonieren bei Wagner – sinngemäß – statt als satztechnisch-kontrapunktische als stoffliche Kategorie verstanden. An den Dissonanzen werden Differenzen thematisiert, die über die Fragen der Vorbereitung und Auflösung hinausgehen. Die Dissonanzschärfe, eine Differenz, die in traditioneller Musik immer mit-thematisiert gewesen ist, aber durch das weitmaschige Netz der kontrapunktischen Regeln gefallen ist, wird nun zum Gegenstand der Gestaltung. Das ›Dissonieren von Dissonanzen‹ kann in unterschiedlichen Graden erlebt werden, und die Instrumentation trägt zur Differenzierung dieser Grade wesentlich bei.[44]
Beispiel 8: L. van Beethoven, Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125, 4. Satz Takt 1–2, Partitur und Interpretation als zwei gleichzeitig erklingende Akkorde[45]
Der Beginn des Schlusssatzes in Beethovens 9. Sinfonie wäre ein Beispiel ›vor Wagner‹, in dem das Dissonieren der Töne a und b im Sinne Adornos thematisiert wird. Technisch tragen zur Auffälligkeit des ›Klanges‹ sowohl Satztechnik als auch Instrumentation bei: Die Quarte in den ›Außenstimmen‹, die unmittelbare Nachbarschaft zwischen a und b in der eingestrichenen Oktave (zwischen 2. Klarinette und 2. Trompete auch in der kleinen Oktave), die strikte Verteilung der dissonierenden Bestandteile auf die hohen Holzbläser einerseits und die Trompeten andererseits.
Man könnte in dieser Art der Dissonanz-Inszenierung aber auch ein Mittel erkennen, ein bestimmtes ›Teil-Sein‹ des Klanges zu konstituieren: Vielleicht handelt es sich nicht um einen einzigen (einheitlichen) Akkord (einem d-Moll-Dreiklang mit kleiner Sexte), sondern um eine Überblendung aus zwei Dreiklängen: Die Hörner, die lediglich die Töne d und f spielen, verbinden sich mit den hohen Holzbläsern zu einem B-Dur- und mit den Trompeten zu einem d-Moll-Dreiklang (der 5-6-Austausch, der bei Mozart, Haydn und Wagner ein Nacheinander war, findet sich hier zu einem einzigen Klang kontrahiert).
Selbstverständlich lässt sich der Vorgang in Takt 1 als Auflösung des Tons b in den harmonieeigenen Ton a auffassen (schließlich gibt es eine Bewegung b-a in den Holzbläsern). Doch wer vom ›Klang‹ ausgeht, muss zugeben, dass sowohl die Heftigkeit der Dissonanz zu Beginn als auch die Art ihrer ›Beseitigung‹ danach eher so wirken, als werde der B-Dur-Anteil des anfänglichen Doppelklanges ausgeblendet oder als werde der d-Moll-Dreiklang aus dem komplexen Gebilde zuvor ›herausgefiltert‹. Mit anderen Worten: Die primäre Klangeinheit (der Moll-Dreiklang mit kleiner Sexte) erscheint unter anderem durch stoffliche Mittel auf sekundärer Ebene als zusammengesetzt aus zwei Dreiklängen, und die primäre Verbindung (die ›Auflösung‹ der Sexte b in die Quinte a) sekundär als ›Übrigbleiben‹ des d-Moll-Bestandteils.
Beispiel 9: L. van Beethoven, Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125, 4. Satz Takt 14–18, Particell, Interpretation als zwei gleichzeitig erklingende Akkorde und fragliche Interpretation als ein einziger Dominantseptnonakkord
In ähnlicher Weise lässt sich im zweiten ›Tutti‹ eine kurzfristige Überblendung aus einem d-Moll-Dreiklang (der allein durch das d der Trompeten und Pauken vertreten wird) und einem vollverminderten Septakkord fis-a-c-es erkennen. Anlass dazu gibt auch hier die Wirkung des Akkordeinsatzes in Takt 17 (3. Viertel). Der dissonante Charakter des Septakkordes lässt ihn als einen neuen Akkord erscheinen, der auf den alten prallt und ihn verdrängt (tatsächlich wird der Trompetenton d nach Eintritt des Septakkordes in den harmonieeigenen Ton c ›korrigiert‹). Die naheliegende Interpretation, nach der sich das d mit dem Septakkord zu einem Dominantseptnonenakkord ergänzt, erscheint angesichts dieser Wirkung schlecht abstrakt. Im Ton d ist nicht im Mindesten etwas von der Harmonie angelegt, die ihm folgt.[46] Dass sich aber der Ton d und der Akkord fis-a-c-es nicht zu einer fünftönigem Einheit verbinden, bewirkt die Instrumentation.
Beispiel 10: R. Wagner, Siegfried, 1. Akt Takt 116–121, Partitur und Analyse[47]
Kurz bevor sich der Vorhang zum ersten Akt des Siegfried hebt, erklingt ein C-Dur-Dreiklang in der Basstrompete über einem Liegeton B in den tiefen Streichern. Instrumentation und Dynamik, aber auch die räumliche Verteilung der beteiligten Instrumente machen unmittelbar einsichtig, dass sich tiefer Ton und Dreiklang nicht zu einem Akkord ergänzen. Zwar lässt der traditionelle Intervallbau, der einem Dominantseptakkord als Sekundakkord entspricht, die Töne zueinander ›passen‹, aber nicht im Sinne eines Septakkordes. Eben darum fehlen dem viertönigen Zusammenklang alle Eigenschaften eines Sekundakkordes, etwa der Charakter einer Dominante oder der Drang zu einer Auflösung. Auch dem Ton B fehlt die Bestimmung eines traditionellen Basstons.
* * *
Ob sich gleichzeitig erklingende Töne, die auf primärer Ebene Septakkorden entsprechen, auch sekundär zu traditionellen Akkord-Einheiten zusammenschließen oder sich (wie in Beispiel 10) auf eine andere Art verbinden, für die es bislang keinen Namen gibt, muss in die harmonische Analyse von Klangfolgen einfließen. Als Beispiel sei der sogenannte ›halbverminderte Septakkord‹ gewählt.
Gerd Rienäcker und Tobias Janz gehen zu Recht davon aus, dass der ›halbverminderte Septakkord‹ in manchen Wagner’schen Kontexten nicht als Vierklang, sondern als Molldreiklang mit tiefem Zusatzton zu verstehen ist. In dualistischer Manier spricht Rienäcker etwa zu Beginn der Götterdämmerung von einer »Subdominant as-moll mit Untersept«[48] und Tobias Janz im Zusammenhang mit dem ›Tarnhelmmotiv‹ von der »Klangfolge as-Moll (+ Unterterzung f) – e-Moll«.[49] Zudem nennen beide Autoren den tiefen Zusatzton nicht ›Basston‹, weil er – so könnte man ergänzen – nicht die funktionale Bestimmung eines traditionellen Basstons besitzt. Was aber wäre die Konsequenz aus solchen Beobachtungen für die Analyse einer ›Akkordfolge‹, in der solche Klänge vorkommen?
Wer die Funktion ›zusammengesetzter Klänge‹ in ihrem jeweiligen Kontext angeben möchte, benötigt bereits für die rein ›harmonische Dimension‹ der Klänge eine Analyse-Methode, die feinkörnige Unterschiede zwischen Klängen zugänglich macht. Nach Überzeugung des Autors ist die Analyse nach Tonfeldern dazu in der Lage – unter anderem deshalb, weil sie von Schichten in der Komposition ausgeht.[50]
Beispiel 11: R. Wagner, Parsifal, 3. Akt Takt 663–669, Particell
Die erste ›Episode‹ des ›Karfreitagszaubers‹ beginnt nach einem zweitaktigen Unisono auf F – technisch gesprochen – mit einer Folge von sechs Zusammenklängen: einem ›Dominantseptnonakkord‹ über F mit kleiner None, einem ›Dominantseptnonakkord‹ über F mit großer None, einem halbverminderten Septakkord über F, einem e-Moll-, einem C-Dur- und einem H-Dur-Dreiklang. Jeder Zusammenklang nimmt den Raum von einem Takt ein, nur die Akkorde e-Moll und C-Dur teilen sich einen Takt. Eben darum wirkt C-Dur ein wenig wie ein zu H-Dur überleitender Anhang an e-Moll. Von den sechs Zusammenklängen haben der zweite und dritte das Potential zu einem ›zusammengesetzten Klang‹: Der zweite scheint einen c-Moll- und der dritte einen as-Moll-Dreiklang als Teilmoment zu enthalten. Welche Auswirkung hat dies für die harmonische Interpretation der Stelle?
›Zusammengesetzte Klänge‹ sind die Kehrseite einer harmonischen Mehrschichtigkeit, wie sie für Wagners Musik charakteristisch ist. Analytisch-technisch entspricht dieser Mehrschichtigkeit ein Nebeneinander oder Zugleich unterschiedlicher Tonfelder. Bemerkenswerter als die Ko-Existenz an sich ist das spezielle Verhältnis der Tonfelder zueinander: Die beiden Tonfelder an dieser Stelle, eine ›Funktion‹ mit den Grundtönen f-as-ces-d und ein ›Konstrukt‹ IIa (es enthält die Töne: ces-c-es-e-g-as), verbinden sich nicht zu einer übergeordneten Einheit. Ihre Teile wechseln einander ab oder erklingen gleichzeitig, ohne dass aus dem Abwechseln oder Zugleich-Erklingen eine neue Verbindung erwüchse. Im Gegenteil: Seltsamerweise bewahren die Komponenten der Funktion und diejenigen des Konstrukts trotz der Einbindung in einen umfassenden Tonsatz ihren charakteristischen ›Klang‹ (als Teilmomente ihrer Tonfelder). Deutlich zu bemerken ist dies bereits im Übergang vom ersten zum zweiten Klang: Der Austausch der kleinen durch die große None bewirkt klanglich zu viel Veränderung, um den zweiten ›Akkord‹ nur als Chromatisierung des ersten erscheinen zu lassen, aber auch zu wenig Unterschied, um als ein (traditionell) fixierbarer Akkordwechsel verständlich zu sein. Tatsächlich folgen beide Klänge einander, ohne dass vor traditionellem Hintergrund feststünde, ›als was‹ sie aufeinander bezogen sind. Vom Standpunkt der Tonfeld-Theorie aus wird beim geschilderten Übergang zum ersten Mal eine Konstrukt-Komponente in die bestehende Funktion eingeblendet.
Beispiel 12: R. Wagner, Parsifal, 3. Akt Takt 665–669, Zeilen 1–4: Particell, Zeilen 5–7: Tonfelder
Dass sich (klanglich identifizierbare) Teilmomente der Funktion und des Konstrukts einer kontextuellen Vereinnahmung partiell widersetzen können, liegt – technisch gesehen – daran, dass die Tonfelder auf je eigene Weise in den Tonsatz ›eingesenkt‹ sind.
Die Funktion bildet den Rahmen der Taktgruppe und findet sich im ersten und letzten Zusammenklang sowie in dem zentralen ›halbverminderten Septakkord‹ über F (dem dritten Zusammenklang). Von den möglichen acht Tönen erklingen sieben: f-a-c-es (=dis)-ges (=fis)-as-ces (=h), der Ton d fehlt. Die Komponenten der Funktion erscheinen als einheitliche Akkorde, vor allem als Dominantseptnonakkord zu Beginn und als H-Dur-Dreiklang am Ende. Die ›Teilstrecken‹ vom ersten Akkord zum ›halbverminderten Septakkord‹ sowie von diesem zum schließenden H-Dur-Dreiklang werden durch unterschiedliche Mittel als Unter-Einheiten artikuliert: durch den Holzbläsersatz einerseits und den Blechbläsersatz andererseits, durch den gemeinsamen tiefen Ton F (auf der ersten ›Teilstrecke‹) und durch eine retrograde ›Oberstimme‹ (die höchsten Töne des Holz- bzw. Blechchores): ges-g-as auf der ersten ›Teilstrecke‹ und as-g-fis (=ges) auf der zweiten. Der Gliederung der Funktion in zwei Teile (mit einem mittleren Klang, der zu beiden Teilen gehört) entsprechen in etwa die Gesangspartien von Gurnemanz und Parsifal. Auf den gemeinsamen ›halbverminderten Septakkord‹ fällt das überleitende Wort »Herr«.
In die rahmende Funktion ist das Konstrukt eingelassen. Zwischen beiden Tonfeldern besteht eine Schnittmenge: as-ces-c-es. Tatsächlich gehört der ›halbverminderte Septakkord‹ über F nicht nur zu beiden Teilen der Funktion, sondern mit dreien seiner Töne zum Konstrukt (mit as-ces-es). Insofern bildet der Zusammenklang die strukturelle Mitte der Taktgruppe. Die übrigen Töne des Konstrukts finden sich in den unmittelbar benachbarten Klängen. Im Gegensatz zur Funktion erscheint das Konstrukt nicht an Zusammenklängen, sondern an charakteristischen Stellen der Melodiebildung: im c-Moll-Dreiklang auf die Silben »-tags-zau-ber«, im as-Moll-Dreiklang des Violoncellos sowie dessen Fortführung in den Ton e (zu Parsifals Worten »O wehe«), schließlich in der rahmenden Quinte c-g zu Parsifals Worten »des Höch-sten« (man beachte auch die analoge Anordnung der Töne zu ›Dreiklängen in Quintlage‹).
Die Tonfelder der Taktgruppe bestehen jeweils aus drei ›Komponenten‹: die Funktion aus drei Akkorden, das Konstrukt aus drei melodischen Phrasen. Sie unterscheiden sich jedoch nicht nur hinsichtlich ihrer primär harmonischen oder melodischen Erscheinungsweise, sondern auch hinsichtlich ihrer inneren Dynamik.
Die Aufteilung der Funktion wirkt einigermaßen ausgeglichen: Alle drei Akkorde sind gleichwertige Bestandteile des Tonfeldes, die Funktion steckt in jedem von ihnen. Eine innere Dynamik entsteht lediglich dadurch, dass die sieben Töne mit dem Erklingen des zweiten Bestandteils bereits abgedeckt sind. Darum geht von den ersten beiden Teil-Akkorden, die durch den tiefen Ton F verbunden sind, die stärkere Funktions-Wirkung aus.
Im Gegensatz zur Funktion ist das Erscheinen des Konstrukts auf einen Ort konzentriert. Dieser Ort ist der gebrochene as-Moll-Dreiklang und seine Weiterführung ins e (nicht zufällig zu den Worten »O wehe«). Diese Tonfolge prägt – obwohl nur vier von sechs Tönen erklingen (bzw. fünf, wenn man die Akkordtöne von as-Moll und e-Moll berücksichtigt) – den stärksten Konstrukt-Charakter aus. Diese vier Töne – wiederum ein ›Viereck‹ (as-es – e-h[=ces]) – können nur deshalb die Mitte des Konstrukts darstellen, weil sie von zwei Quinten c-g umschlossen werden. Die Aufgabe dieser Quinten ist es, den Ort des Konstrukts zu ermöglichen. So enthält der c-Moll-Dreiklang selbst noch nichts vom Klang eines Konstrukts, aber ohne ihn könnte man beim Eintritt des as-Moll-Akkordes keinen Konstrukt-Charakter erleben. Mit dem C-Dur-Akkord nach dem e-Moll-Dreiklang ist der Ort des Konstrukts wieder verlassen. Die zweite Quinte c-g passt (im Sinne des Tonfeldes) zu den Melodiestücken zuvor, aber sie leitet bereits zum abschließenden H-Dur über.
III. Schluss
In Wagners Musikdramen werden den Harmonien dramaturgische Funktionen zugewiesen. Um eine Relation zwischen Musik und Bühnengeschehen herzustellen, wird vorausgesetzt, dass es sowohl an der Musik als auch am Bühnengeschehen identifizierbare Momente gibt, die sich herausgreifen und miteinander in Beziehung setzen lassen. Diese identifizierbaren Momente bilden in der Musik die Funktionen, die Bestimmungen des Teil-Seins von musikalischen Ereignissen. Dieser Beitrag hat – zumindest stichprobenhaft – gezeigt, dass die Komponisten schon rund hundert Jahre vor Wagners Musikdramen damit begonnen hatten, die Funktionen ihrer Klänge feinkörnig zu differenzieren. Die Instrumentation erlangte bei dieser Differenzierung eine konstitutive Bedeutung, weil die Komponisten von etwa 1740 an die Frage, was die Form-Funktion eines formalen Abschnitts, was eine ›harmonische Verbindung‹ und was die Einheit eines Zusammenklangs überhaupt sein soll, kompositorisch thematisiert haben. Und die Folge dieser Thematisierung ist ein gewandeltes Verständnis (von Formfunktion, Verbindung und Klangeinheit) gewesen, das sich nicht anders als durch Differenzierung auch der stofflichen Momente am Klang artikulieren ließ. Diese Differenzierungen ausführlicher darzustellen wäre die Aufgabe einer neuen Harmonielehre.
Anmerkungen
Adorno 1997, 60. | |
Janz 2006, 9. Bei Janz werden die unterschiedlichen Bedeutungen des Begriffs Klang ausführlich diskutiert. | |
Adorno 1997, 72. | |
Ebd., 73. | |
Man könnte einwenden, dass die Interpretation eines Übergangs als Flexion auch eine bestimmte harmonische Bedeutung des betreffenden Akkordes impliziert. Selbst wenn dies zutreffen sollte, wäre diese Bedeutung jedoch nicht bereits durch die genannte Interpretation bestimmt. | |
Vgl. beispielsweise Schubert 1975, 136f. (über die Veränderung der »Satzfunktionen« durch Instrumentation) oder Dahlhaus 1985, 162f. (am Beispiel des Finalbeginns der Symphonie fantastique zeigt Dahlhaus, dass der Tonsatz, der ausschließlich aus vagierenden Akkorden besteht, eine Funktion der Instrumentation darstellt). | |
Janz 2006, 264. | |
Ebd., 265. | |
Gegen diese Vorstellung ist im Allgemeinen – unabhängig von der hiesigen Frage – nichts einzuwenden. Vgl. Janz 2006, 12: »Für die Musiktheorie läßt sich in dieser Perspektive die Frage stellen, ob und auf welche Weise Notation, Performanz, instrumentale Besetzung, Spieltechnik oder Raum konstitutiv für die Gestaltung musikalischen Sinns sind. Besonders für eine Theorie der Instrumentation ist dies eine fruchtbare Perspektive, da sich so die in der gängigen Vorstellung vom Kompositionsprozeß fest verankerte genetische Folge von Komposition und Instrumentation umkehren läßt: es geht dann nicht mehr um die Frage, welches klangliche Erscheinungsbild einer vorgängigen komponierten Struktur verliehen wird oder angemessen ist, sondern darum, wie a priori mediale Entscheidungen im Bereich der Besetzung, der Gattung und des Aufführungskontextes die komponierte Struktur mit konstituieren. Für alle genannten Bereiche läßt sich zeigen, daß vermeintlich ›externe‹ Bedingungen die komponierte Faktur bis in die Satzdetails wie die Motiv- und Melodiebildung, die Stimmendifferenzierung, die Proportionierung von Formteilen etc. prägen.« | |
Die ganz eigenen und vielfältigen Probleme der musiktheoretischen Erörterung von Klangfarbe sind nicht Gegenstand dieses Beitrags. Vgl. hierzu Janz (2006) und den Beitrag von Johannes Kohlmann in dieser Ausgabe. | |
Auch die funktionale Bestimmung, die in Schenker’schen Analysen stattfindet, genügt alleine nicht, um die Abhängigkeit der harmonischen Funktionen von der Instrumentation zu zeigen. | |
Bruno Haas 2003, 215. Vgl. zum Folgenden auch Polth i.V. a und i.V. b, Hindrichs 2014, 99. | |
Der Begriff ›Akkord‹ dient als behelfsmäßiger Ausdruck. Er kann auch simultane Tonkonstellationen einschließen, die sich auf eigene Weise, aber nicht im traditionellen Sinne zu Einheiten verbinden (s. II.C). | |
Das Gesagte gilt nicht nur für Akkorde, sondern für alle Ereignisse einer Komposition. | |
Handschin 1948, 1f. | |
Hindrichs 2014, 99. | |
Ebd., 96. | |
Eine Ausnahme bilden möglicherweise die melodischen Aspekte, die zumindest teilweise keine primären, sondern ›komposite‹ sind. | |
Hindrichs 2014, 89. | |
Hindrichs (ebd., 77) schlägt eine Brücke von der Kategorie ›Klang‹ »als umfassendste Bestimmung der Ontologie des Kunstwerks« (»Es [das musikalische Kunstwerk] ist Seiendes, das erklingt.«) zu den konkreten musikalischen Ereignissen, die ›Klänge‹ sind, weil sie »Objekte des Hörens sind« (ebd., 56). | |
Die Festlegung dynamischer Grade schreibt dem Spieler primär eine Modellierung der stofflichen Qualitäten eines Klanges vor, auch wenn dynamische Vorschriften – wie man sehen wird – immer einem Zweck außerhalb der Kategorie ›Dynamik‹ unterliegen. | |
Selbstverständlich kann es sich bei einer Taktgruppe, die eine Crescendo-Kurve bildet, um eine funktionale Einheit handeln. Nur würde diese nicht durch das Crescendo begründet, sondern durch systemische Momente an den Tönen. | |
Der Autor hat als Vermittlung vorgeschlagen, Sonatenform als einen bestimmten historischen Typ von Funktionalität zu begreifen (Polth i.V. a). | |
Hierzu sei auf frühere Arbeiten des Autors hingewiesen: Polth 2000 und i.V. a. | |
Analoges gilt für den ›inneren Bereich‹ von Sonatensätzen oder für deren ›Schluss‹. | |
Um was es sich bei der ›Anfangs-Tonika‹ genau handelt, wird im folgenden Text erläutert. Jedenfalls ist die Ermittlung der Akkorde mit der Bestimmung ›Anfangs-Tonika‹ nicht identisch mit der Suche nach dem Akkord, der im Sinne Heinrich Schenkers den »Kopfton der Urlinie« trägt. | |
Zu diesem auskomponierten Weg auf einen Zustand der ›Erfülltheit‹ hin gibt es selbstverständlich Alternativen. | |
Nach Carl Dahlhaus (1985, 162) dient ein Tutti-Abschnitt allein der Exposition des Orchesters. »Das […] Tutti […] verdankt seine Existenz und ästhetische Rechtfertigung einzig der Prämisse, daß es zum Wesen des symphonischen Stils gehört, außer der Thematik auch das Orchester […] sinnfällig zu exponieren. […] Die dynamische und orchestrale Entfaltung ist in dem Tutti […] weniger eine Funktion des Tonsatzes als umgekehrt der Tonsatz eine Funktion der dynamischen und orchestralen Entfaltung.« In der Beschränkung der Tutti-Funktion auf rein instrumentale Aspekte liegt ein Problem: Da Dahlhaus im Tutti nicht auch die Darstellung einer eigenen harmonischen Funktion erkennt, bleibt seine funktionale Einordnung äußerlich. | |
Das gilt auch für das letzte ›erfüllte‹ Tonika-Ereignis, das nicht als eigentliches Erscheinen der Anfangs-Tonika missverstanden werden darf; denn der Charakter der ›Erfülltheit‹ kommt dem dritten Tonika-Ereignis nur innerhalb des Phasen-Prozesses zu, ist also Ausdruck eines Teil-Seins innerhalb der Anfangs-Tonika. Wohl aber nimmt das letzte Ereignis insofern eine besondere Stellung innerhalb der Phase ein, als es als Resultat des Prozesses (der Darstellung der ›Anfangs-Tonika‹) erscheint. Als Einheit der Phase sind in der ›Anfangs-Tonika‹ mithin Prozess und Resultat vermittelt. | |
Die mittleren Töne, die das Unisono an den Taktanfängen zu Akkorden erweitern, stellen keine Stimmführungsereignisse dar – was daran deutlich wird, dass die vermeintlichen ›Oktav- und Quint-Parallelen‹ nicht fehlerhaft wirken (vgl. Ähnlichkeit und Differenz mit Beispiel 3 im Artikel von Johannes Kohlmann). | |
Dass diese Funktion nicht anders als durch die Hinzuziehung stofflicher Momente konstituiert werden kann, sieht man daran, dass sie sich mit den einseitig-systemischen Kategorien der Funktionstheorie nicht erfassen lässt. Die Funktionstheorie bestimmt das Teil-Sein ihrer Elemente durch den Tonartenbezug, jedem Akkord muss eine Bestimmung über seine Rolle innerhalb der ›lokalen Tonikalität‹ zugewiesen werden. Doch die Frage, ob Es-Dur in Takt 23 Tonika, Dominante oder Subdominante ist, lässt das Entscheidende unbefragt, nämlich die spezifische Art der Verbindung zum vorangehenden Akkord. | |
Bernhard Haas (2010, 281) lässt den D-Dur-Dreiklang sogar noch im Diagramm der vierten (nicht näher bezeichneten) Schicht weg und notiert: B-Dur/g-Moll/Es-Dur. Es-Dur selbst erscheint zusammen mit g-Moll als Zwischenstation auf dem Weg von B-Dur in Takt 20 nach c-Moll in Takt 29. | |
Darum genügt es auch nicht, die (primäre) Terzverbindung als ›Mediante‹ zu bezeichnen. | |
Adorno 1997, 73. | |
Ariane Jeßulat würde vielleicht von »erinnerter Musik« sprechen. Sie und Janz analysieren den Beginn der Götterdämmerung vor allem unter leitmotivischen Gesichtspunkten (Jeßulat 2013, 131; Janz 2006, 137ff.). Vgl. auch Rienäcker 1996. | |
Der Bezug auf eine gemeinsame lokale Tonart, der notwendig wäre, um ein Verhältnis zwischen den Akkorden funktionstheoretisch bestimmen zu können, ist zwar möglich, aber wenig überzeugend. Gerd Rienäcker (1996, 79) spricht von der »Gegenparallele Ces-Dur, der Doppelsubdominant des-moll«. Die Funktionsbegriffe könnten jedoch ohne Sinnverlust in die Stufenzahlen VI und VII umgewandelt werden, weil die intendierte Bedeutung der Funktionsbegriffe nicht zu hören ist. | |
Kurth 1920, 264. | |
In ähnlicher Weise ist Nietzsches Rede von der »elementarisch gemachten Musik« eine Äußerung über den ästhetischen Schein, der den Klängen in Wagners musikalischen Kontexten zuwächst. | |
Kurth 1920, 264. | |
Cohn 2012, 108f. | |
Die Selbstverständlichkeit, mit der die Neo-Riemannian-Theory von Dreiklängen ausgeht (lediglich die Verbindung der Dreiklänge folgt nicht mehr traditionellen Vorstellungen), wird der Situation in der Musik des späten 19. Jahrhunderts nicht gerecht. | |
Vgl. Haas 2004, 27–31. | |
Die jeweils zweiten (Moll-)Akkorde enthalten Septimen. Da die jeweils ersten Akkorde übermäßige Sexten aufweisen, entsprechen die Akkordpaare dem, was der ungenaue Ausdruck ›phrygischer Halbschluss‹ bezeichnet. | |
»Alle Energie ist bei der Dissonanz; an ihr gemessen werden die einzelnen Lösungen immer dünner, unverbindliches Dekor oder restaurative Beteuerung.« (Adorno 1997, 62f.) »Die Akzente liegen in den harmonisch progressiven Partien durchweg auf den Dissonanzen und nicht den Lösungen.« (Adorno 1997, 64) | |
Die Holzbläserstimme entspricht – was die exakte Lage der Töne angeht – der Stimme der Oboen. | |
Im Übrigen dürfen der Grundton d und die None es nach kontrapunktischem Reglement nicht in derselben Oktavlage erscheinen | |
Violoncello und Kontrabass sind wie in der Partitur, die Basstrompete ist klingend notiert. | |
Rienäcker 1996, 79. | |
Janz 2006, 181. Ebenso Cohn 2012, 144, Fig. 7.3.e (zu einer ähnlichen Wendung im Parsifal, 2. Akt, Takt 1192–94, die derjenigen in Beispiel 11 entspricht). | |
Der Vorteil der Tonfeld-Theorie gegenüber der Neo-Riemannian Theory liegt nicht im Repertoire der Strukturen, das nicht viel anders ist als bei Cohn, sondern in der Vielfalt der Analysewege. |
Literatur
Adorno, Theodor W. (1997), »Versuch über Wagner«, in: Die musikalischen Monographien (= Gesammelte Schriften 13), Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 7–148.
Richard Cohn (2012), Audacious Euphony, New York: Oxford University Press.
Dahlhaus, Carl (1985), »Zur Theorie der Instrumentation«, in: Musikforschung 38, 161–169.
Haas, Bernhard (2004), Die neue Tonalität von Schubert bis Webern, Wilhelmshaven: Noetzel.
--- (2010), »Zur Sonatenform II mit analytischen Bemerkungen zum ersten Satz von Mozarts KV 570«, in: Funktionale Analyse. Musik – Malerei – Antike Literatur, hg. von Bernhard und Bruno Haas, Hildesheim u.a.: Olms, 261–294.
Haas, Bruno (2003), Die freie Kunst, Berlin: Duncker & Humblot.
Handschin, Jaques (1948), Der Toncharakter. Eine Einführung in die Tonpsychologie, Zürich: Atlantis.
Hindrichs, Gunnar (2014), Die Autonomie des Klangs, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Janz, Tobias (2006), Klangdramaturgie. Studien zur theatralen Orchesterkomposition in Wagners »Ring des Nibelungen«, Würzburg: Königshausen & Neumann.
Jeßulat, Ariane (2013), Erinnerte Musik. Der »Ring des Nibelungen« als musikalisches Gedächtnistheater, Würzburg: Könighausen & Neumann.
Kurth, Ernst (1920), Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners ›Tristan‹, Bern: Haupt.
Polth, Michael (2000), Sinfonieexpositionen des 18. Jahrhunderts. Form und Ästhetik, Kassel u.a.: Bärenreiter.
--- (i.V. a), »Sonatenform als Funktionalität«, in: Schenkerian Analysis – Analyse nach Heinrich Schenker, hg. von Oliver Schwab-Felisch, Hartmut Fladt und Michael Polth, 2 Bd. Hildesheim u.a.: Olms.
--- (i.V. b), »Motivisch-thematische Arbeit und musikalischer Zusammenhang«, in: Motivisch-thematische Arbeit, hg. von Stefan Keym.
Rienäcker, Gerd (1996), »Vorspiel zu einem Vorspiel – die ersten Takte der ›Götterdämmerung‹«, in: Zum Problem und zu Methoden von Musikanalyse, hg. von Nico Schüler, Hamburg: von Bockel, 77–87.
Schubert, Giselher (1975), Schönbergs frühe Instrumentation. Untersuchungen zu den Gurreliedern, zu op. 5 und op. 8, Baden-Baden: Koerner.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.