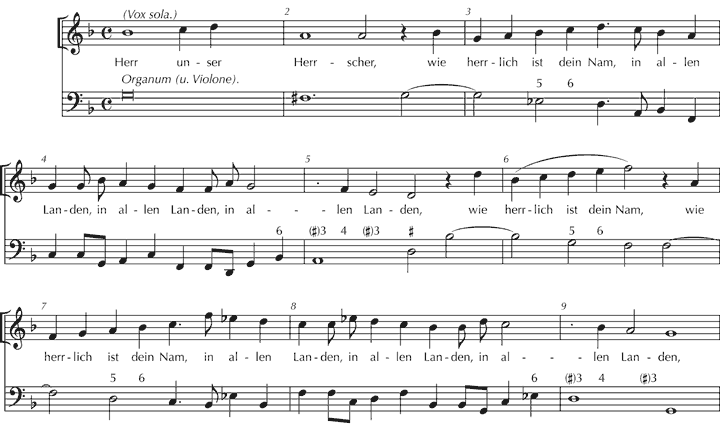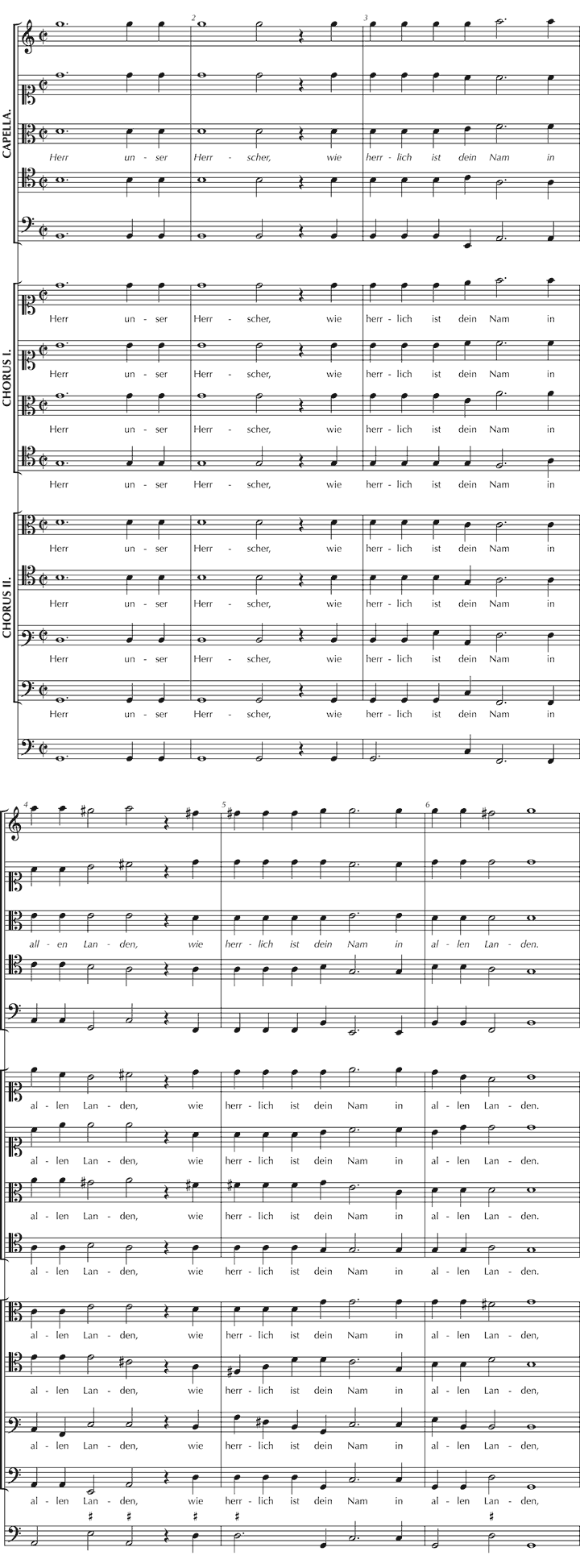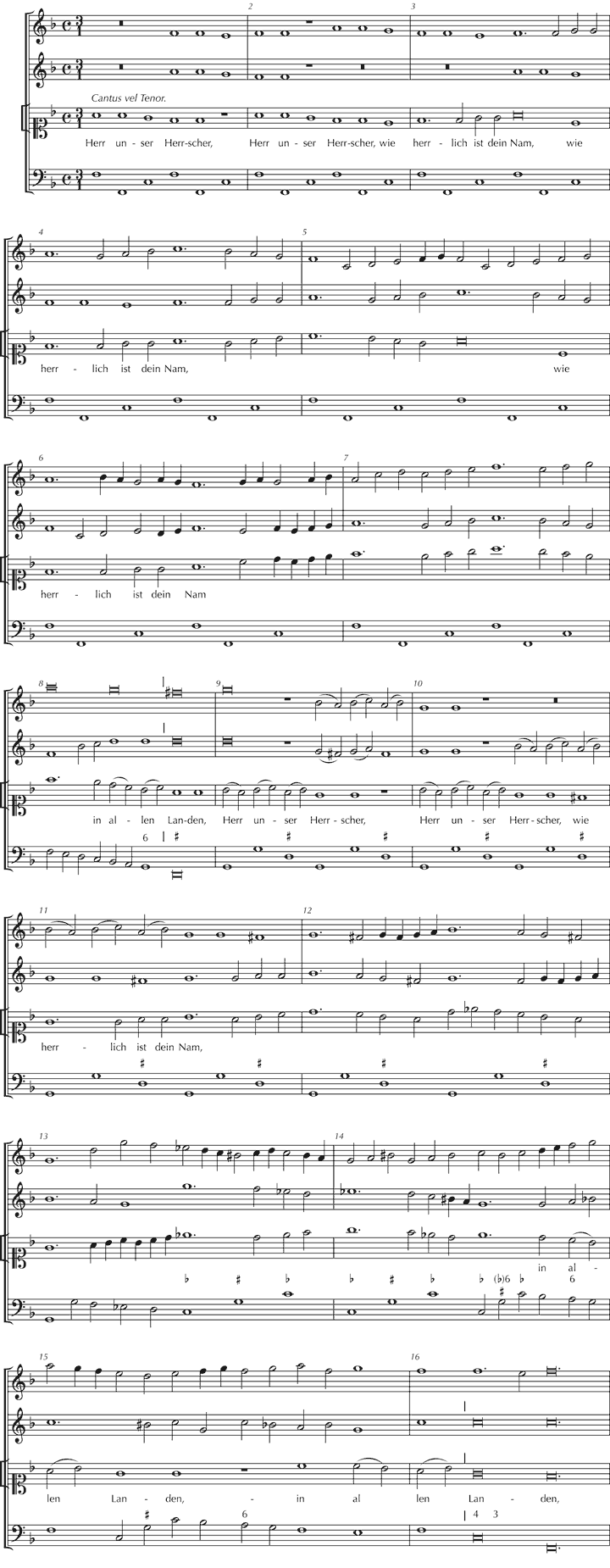›Variatio‹ und ›Amplificatio‹
Die rhetorischen Grundlagen der musikalischen Formbildung im 17. Jahrhundert
Bettina Varwig
Die Beziehungen zwischen Musik und Rhetorik im siebzehnten Jahrhundert sind in der Wissenschaft primär im Hinblick auf die sogenannte Figurenlehre diskutiert worden. Ausgehend von einem an Erasmus orientierten Rhetorikbegriff wird hier anstelle einer Semantik der Figuren die Frage der musikalischen Syntax oder Form in den Mittelpunkt gestellt. Eine enge Verbindung von musikalischen mit rhetorischen Formvorgängen findet sich zunächst in den Schriften der deutschen Theoretiker der musica-poetica-Tradition, die gezielt die syntaktischen Qualitäten der Musik in Analogie zur Rhetorik aufzeigen. Dieses Vorgehen schafft die Grundlage für eine Kompositionslehre, die das Zusammensetzen von musikalischen Phrasen lehr- und lernbar macht. Ebenso erweisen sich bestimmte Strategien der Formbildung in Heinrich Schützens Werken als eng verknüpft mit damaligen rhetorischen Denkmustern. Aus diesen Erkenntnissen kann die musikalische Rhetorik als analytische Methode neu formuliert und nutzbar gemacht werden.
I. Rhetorik und ›musica poetica‹
Die ›ars rhetorica‹ des 16. und 17. Jahrhunderts ist von der modernen Wissenschaft erst teilweise erschlossen: James Murphy sprach vor einiger Zeit von mehr als eintausend unzureichend behandelten Autoren der Renaissancezeit.[1] Die vielfältigen Schichten und verzweigten Traditionen dieses damals so zentralen Wissensgebietes sind uns daher auch nur in Ausschnitten bekannt, und es sind jene Ausschnitte, die die gängige Grundlage für heutige systematische Einführungen in die Rhetorik bilden.[2] Diese basieren meist auf einer Mischung von Ciceronischem und Quintilianischem Gedankengut und erklären zunächst die fünf Aufgaben des Redners (›inventio‹, ›dispositio‹, ›elocutio‹, ›memoria‹, ›pronuntiatio‹). Daran schließt sich die Darstellung der für die Ausführung dieser Aufgaben jeweils erforderlichen Techniken an. Zentrale Bedeutung kommt dabei der Lehre von den gedanklichen Orten oder ›topoi‹, den fünf (oder sechs) Redeteilen und nicht zuletzt den rhetorischen Figuren zu. Dieses Grundmuster lag tatsächlich vielen Schul- und Lehrbüchern der Renaissance zugrunde; einige Rhetoriker der Zeit erweiterten und ergänzten es allerdings erheblich.
Hier möchte ich ansetzen. Eine Erweiterung unseres Verständnisses der Rhetorik des 16. und 17. Jahrhunderts vermag neue Einsichten in die häufig aufgezeigten engen Verbindungen zwischen Redekunst und Musik zu eröffnen, sowohl im Hinblick auf die theoretischen Schriften der ›musica poetica‹ und ihre innovativen Methoden zur Beschreibung musikalischer Formbildung, als auch bezüglich der kompositorischen Praxis der Zeit. Eines der einflußreichsten Rhetoriktraktate der nordeuropäischen Renaissance war die erstmals 1512 veröffentlichte Schrift De duplici copia rerum et verborum des Erasmus von Rotterdam. Noch vor 1600 erschienen über 150 Ausgaben des Werkes, und es bewahrte seine Popularität bis weit ins 18. Jahrhundert hinein.[3] Erasmus, selbst ein standfester Ciceronier, verfolgte mit dieser Veröffentlichung hauptsächlich das Ziel, die Verbindlichkeit der Ausdrucksweisen des klassischen Lateins wiederherzustellen, die in den Schriften mittelalterlicher Autoren weitgehend verlorengegangen war. Er systematisierte dabei ein Verfahren, das ansatzweise schon bei den klassischen Autoren diskutiert worden war, nämlich die Variation und Amplifikation von verbalen Aussagen mittels klar definierter, leicht zu erlernender Methoden.[4] Diese sollten dem Redner ermöglichen, ›copia‹ (Fülle) und damit Eleganz und Überzeugungskraft zu erzielen. Ein solcher Ansatz beruht auf der Unterteilung einer Rede in einzelne bedeutungstragende Einheiten, wie Perioden, Kola und Kommata. Diese können durch verschiedene Prozesse der Variation und Amplifikation verändert werden, und zwar auf den beiden schon im Titel der Schrift angedeuteten Ebenen: auf jener der ›res‹ (Dinge, Inhalt) und auf jener der ›verba‹ (Wörter, verbaler Ausdruck). ›Verba‹ werden mit grammatischen Mitteln bearbeitet, ›res‹ mit Hilfe der Dialektik oder argumentativer Strategien.
Für beide Verfahren liefert Erasmus zahlreiche Beispiele. Bezüglich der Variation von ›verba‹ verblüfft er den Leser mit 147 Arten, den Satz »Dein Brief hat mir sehr gefallen« auszudrücken. Dem stellt er über 200 Variationen der Aussage »Immer, so lange ich lebe, werde ich mich an dich erinnern« an die Seite.[5] Im Bereich der ›res‹ zählt Erasmus zwölf Methoden auf, mit denen ein Argument durch Wiederholung, Zergliederung, Gegensatz, Vergleich, Allegorie etc. erweitert werden kann. So schlägt er vor: »Die erste Methode, einen Satz zu amplifizieren, besteht darin, etwas, das sich allgemein und knapp formulieren läßt, dann zu erweitern und in seine Bestandteile zu zerlegen. Dies ist so wie wenn eine Ware zuerst durch ein Gitter oder in einer Verpackung gezeigt wird, und dann ausgepackt und geöffnet wird und dem Auge gänzlich dargeboten wird.«[6]
Als Beispiel bearbeitet Erasmus den prägnanten Satz »Er ist ganz und gar ein Ungeheuer«, indem er die kompakte Hauptaussage in verschiedenste Bestandteile zerlegt, sie bald als Frage, bald in Adjektivform ausdrückt, und dadurch die kurze Periode zu einem abgerundeten Paragraphen erweitert: »In Geist und Körper ist er ein Ungeheuer. Egal, welchen Teil des Geistes oder Körpers man betrachtet, man sieht ein Ungeheuer. Der bebende Kopf, die tollwütigen Augen, das Antlitz eines Drachen, der Blick einer Furie, der aufgeblähte Bauch, die Hände wie Klauen zum Raub, die entstellten Füße, seine ganze körperliche Gestalt also, was stellt sie anderes dar als ein Ungeheuer? Betrachte die Zunge, die bestialische Stimme, und du wirst sie monströs nennen, erforsche den Geist, und du wirst ein Ungeheuer finden, bedenke seinen Charakter, untersuche sein Leben, und du wirst es alles monströs finden. Aber um nicht alles bis ins Detail zu verfolgen, er ist also nichts als ein Ungeheuer.«[7]
Diese ausgefeilte Kunst der verbalen Amplifizierung und Ausschmückung eines jeglichen Satzes oder Themas, in der die rhetorischen Prozesse von Erfindung, Disposition und Dekoration fruchtbar ineinandergreifen, spielt auch, wie ich im folgenden zeigen möchte, in der Musiktheorie und -praxis des frühen 17. Jahrhunderts eine entscheidende Rolle. Die engen Beziehungen zwischen Musik und Rhetorik zu dieser Zeit sind in der modernen Musikwissenschaft vielfach besprochen worden. Das Problem wurde allerdings meist von einem relativ begrenzten und nach meiner Kenntnis nicht an Erasmus orientierten Blickwinkel angegangen, der sich auf die Erörterung der musikalisch-rhetorischen Figuren konzentrierte. Seit Arnold Scherings einflußreichen Forschungen im frühen 20. Jahrhundert ist die Figurenlehre immer wieder als eine historisch fundierte Interpretationshilfe eingesetzt worden. Sie sollte den Zugang zu einer barocken Sprache der Affekte eröffnen, in der gewisse melodische Gesten oder harmonische Wendungen im damaligen Zuhörer angeblich greifbare semantische Assoziationen hervorriefen.[8]
Interpretationen barocker Musikstücke, die sich auf Figurenkataloge stützen, neigen allerdings dazu, sich auf lokale Ereignisse zu beschränken, deren Affektgehalt meist direkt aus dem Textinhalt der jeweiligen Passage abgeleitet wird. Wie Peter Williams zu Recht bemängelt, wird allein durch eine Übertragung rhetorischer Terminologie auf gewisse musikalische Formulierungen wenig darüber ausgesagt, wie ein solches Phänomen tatsächlich musikalisch wirksam und sinnstiftend werden kann – der Eindruck analytischer Einsicht und geschichtlich abgesicherter Sinnfindung, der aus einem solchen einseitigen Prozeß der Benennung gewonnen wird, bleibt dabei oft illusorisch.[9] Fragen der musikalischen Syntax oder Form hingegen werden bei einem solchen Vorgehen an den Rand gedrängt. Ausnahmen bilden nur einige Versuche, die fünf klassischen Redeteile auf ausgewählte Musikstücke zu übertragen, eine Aufgabe, an der schon Johann Mattheson letzten Endes scheiterte, da sich die kontinuierliche Form der Rede nur schwer mit der da-capo-Anlage seiner Arienvorlage verbinden ließ.[10]
Der semantische Ansatz der Figurenlehre wurde im allgemeinen dadurch gerechtfertigt, daß in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum die theoretische Tradition der ›musica poetica‹ begründet wurde, die angeblich (in einer romantisierenden Lesart des Begriffs) eine Art ›poetisches‹ Komponieren mit Hilfe bildlicher oder affektdarstellender Figuren propagierte. Dieses Mißverständnis kursiert in der heutigen Wissenschaft immer noch, obwohl es schon mehrfach dahingehend korrigiert worden ist, daß ›musica poetica‹ damals nicht mehr und nicht weniger als ›Kompositionslehre‹ bedeutete.[11] Das konkrete Problem, ein Musikstück zu schreiben oder zu ›formen‹, wurde bis dato von den beiden traditionellen Disziplinen ›musica theorica‹ und ›musica practica‹ bis auf allgemeine Hinweise zum korrekten Kontrapunkt- und Modusgebrauch so gut wie überhaupt nicht besprochen. Die Theoretiker der ›musica poetica‹ stellten sich dieser Herausforderung erstmals, angefangen mit Gallus Dressler, der unter diesem Titel 1563 den ersten (unveröffentlichten) Traktat schrieb. Dresslers Ausführungen gehen von der Vorstellung aus, ein Musikstück solle einen klar gestalteten Anfangs-, Mittel- und Endteil haben, welche jeweils ihre eigenen kompositorischen Strategien erfordern.[12] Eine solche Sichtweise mag dem heutigen Leser vielleicht allzu trivial erscheinen, aber die Erkenntnis der formalen Funktion einzelner Passagen innerhalb größerer musikalischer Zusammenhänge stellte tatsächlich eine grundlegende theoretische Neuerung dar.
Spätere Theoretiker wie Seth Calvisius, Joachim Burmeister und Johannes Nucius nahmen Dresslers rudimentäre Überlegungen auf und entwickelten sie weiter, indem sie die isolierbaren Bestandteile untersuchten, aus denen zeitgenössische Musikstücke aufgebaut waren. Diese Bestandteile nannten sie verschiedentlich Phrasen oder Perioden, oder sie verwendeten weniger geläufige Begriffe wie ›modulatio‹ oder ›affectio‹.[13] Unabhängig von der jeweiligen Begriffswahl wurden solche Abschnittsbildungen immer als eng verwandt mit den grammatikalischen Konzepten von Periode, Kolon und Komma beschrieben. Joachim Burmeister, Autor der bekannten Musica Poetica von 1606, definiert beispielsweise eine ›affectio‹ als »eine melodische oder harmonische Periode, die durch eine Kadenz beendet ist«, und führt unter der Überschrift ›clausulae‹ aus, daß jene nur dort gebraucht werden sollen, »wo im Text ein Abschnitt ersichtlich ist, entweder durch ein Komma, ein Kolon, oder eine Periode. Dadurch wird, in der Sprache der Logiker, der ›terminus ante quem‹ der vorhergehenden ›affectio‹ oder Periode markiert, und zugleich der ›terminus a quo‹ für die neue oder folgende Periode gegeben.«[14]
Ein Großteil des Burmeisterschen Traktats beschäftigt sich mit der Frage, wie solche ›affectiones‹ zu einem zusammenhängenden Musikstück verbunden werden können. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, daß die meisten seiner oft mit komplizierten griechischen Namen versehenen ›ornamenta‹ im Grunde kompositorische Strategien zur Verbindung, Variation und Erweiterung musikalischer Phrasen benennen. So beschreibt die Figur der ›auxesis‹ oder ›climax‹ beispielsweise die Amplifizierung einer Phrase durch stufenweise Transposition auf- oder abwärts.[15] Burmeisters Zeitgenosse Johannes Nucius stellt eine ähnliche Figur in seiner 1613 veröffentlichten Musices Poeticae vor und fügt seiner Beschreibung den Ratschlag hinzu, daß die ›climax‹ vor allem dort gebraucht werden solle, wo »der Hörer gespannt das Ende erwartet«.[16] Eindeutig spiegelt sich hier Dresslers Entdeckung der funktionalen Qualitäten von musikalischen Eröffnungs- oder Beschlußphrasen wider, ohne daß es einer der beiden Autoren für nötig befand, irgendeinen Bezug zum Textinhalt der gewählten Beispiele herzustellen. Das Verfahren wird daher unzweifelhaft nicht als semantisch oder inhaltsbezogen, sondern als vorwiegend syntaktisch charakterisiert. Tatsächlich deklariert Burmeister nur die ›hypotyposis‹ ausdrücklich als eine Figur, die den Textinhalt wiedergeben und verlebendigen soll. Wie Siegfried Oechsle bemerkt, bestätigt die separate Erwähnung dieses Ornaments eindeutig die »semantische Neutralität« der übrigen Figuren.[17]
Wie die ›climax‹, so bezieht sich ein Großteil der Figurbeschreibungen bei Burmeister, Nucius und etlichen weiteren Autoren auf Varianten einfacher Wiederholungsmuster, so zum Beispiel Burmeisters ›palillogia‹ (besser als ›ostinato‹ bekannt) oder seine verschiedenen Arten der Imitation und Fuge. Bei all diesen ›ornamenta‹ handelt es sich um formbildende kompositorische Techniken, die der sinnvollen syntaktischen Verbindung und Verlängerung musikalischer Phrasen und Abschnitte dienen; Nucius lobt aus diesem Grund die ›imitatio‹ ausdrücklich als einen Prozeß, der Ordnung in den Anfang einer Komposition bringe.[18] Ähnlich wie bei Erasmus überlagern auch hier Aspekte der ›inventio‹ und ›dispositio‹ das häufig als zentral angesehene Verfahren der ›decoratio‹, so daß Burmeisters musikalisch-rhetorische Figuren weniger als oberflächliche, textbezogene Ausschmückung einer unabhängigen musikalischen Struktur oder Form erscheinen, denn vielmehr als konkrete formale Strategien, die eine überzeugende zeitliche Disposition eines Stückes überhaupt erst ermöglichen.
Die Erkenntnis, daß Wiederholung zu den Grundprinzipien musikalischer Gestaltung zählt, stellte das herkömmliche Wiederholungsverbot als Folge des ›varietas‹-Postulats grundsätzlich in Abrede. Sie ist deshalb als eine der folgenreichsten Einsichten dieser Gruppe von Theoretikern zu werten. Wiederholung – ein Phänomen, das wegen seiner scheinbaren Einfachheit nur selten überhaupt erörtert wird – dient nicht nur der zeitlichen Expansion, sondern vor allem der Abgrenzung und Integration kleinerer und größerer Einheiten innerhalb eines Stückes, wodurch Erwartungen geweckt, erfüllt oder unterlaufen werden können. Noch in Gioseffo Zarlinos Istitutioni harmoniche aus der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde Wiederholung generell als zu vermeidendes Übel angesehen. Aus diesem Grund widmet Zarlino ein ganzes Kapitel der Frage, wann und wie eine Passage überhaupt wiederholt werden darf, und bespricht eine Reihe von Imitationstechniken, die eindeutig auf Wiederholungsschemata beruhen, nur kurz gegen Ende des Traktats.[19] Diese für die damalige musikalische Praxis so zentralen Verfahren wurden erst von den ›musica-poetica‹-Theoretikern in den Mittelpunkt der Betrachtungen gestellt und als analog zu rhetorischen Strategien der Variation und Amplifikation diskutiert.[20]
Natürlich ist Wiederholung ein Phänomen, bei dem sich Musik und Sprache grundlegend voneinander unterscheiden, da exakte Wiederholung in der Sprache nur in Einzelfällen auftritt; Erasmus tadelt sie sogar ausdrücklich als »häßlichen und anstößigen Fehler«.[21] Gleichwohl erweist sich in Burmeisters Verständnis von Komposition als der Verbindung, Variation, Erweiterung und Kontrastierung von Phrasen eine erstaunliche Nähe zur Erasmischen Vorstellung von rhetorischer ›compositio‹. Tatsächlich waren Erasmus’ Ideen im deutschen Bildungssystem der Zeit weit verbreitet, meist in Form von vereinfachten Lehrbüchern, die seine ausschweifenden Erklärungen auf ein paar leicht zu behaltende Regeln verkürzten, welche dann auch auf andere Disziplinen übertragen werden konnten. Der Musiktheoretiker Lukas Lossius, Burmeisters Lehrer in Lüneburg, publizierte 1552, nur wenige Jahre bevor seine eigene Musica practica im Druck erschien, eine solche reduzierte Fassung von De duplici copia rerum et verborum, zusammen mit einer Frage-und-Antwort-Version der Dialektik und Rhetorik des Melanchthon.[22] Es ist höchst wahrscheinlich, daß dieser Sammelband eine der Hauptquellen für Burmeisters rhetorisches Wissen, Denken und die von ihm verwendete Terminologie bildete.[23]
II. Musikalisch-rhetorische Formgestaltung bei Heinrich Schütz
Heinrich Schütz gilt seit langem als Musterbeispiel des barocken ›musicus poeticus‹, der angeblich mit Hilfe der Figurenlehre die Luthersche Bibelsprache in musikalische Formulierungen von ähnlicher Strahl- und Überzeugungskraft übersetzte.[24] Ein an Erasmus anschließendes Verständnis von Rhetorik eröffnet interessante analytische Perspektiven, die das restriktive Dogma der Figurenlehre – von Schütz in seinen zahlreichen schriftlichen Äußerungen nicht ein einziges Mal erwähnt – hinter sich lassen und statt dessen die Strategien formaler und expressiver Disposition erfassen. Wie oben zitiert, forderte Erasmus’ erste Amplifikationsmethode, daß eine kurze und allgemeine Aussage in ihre Bestandteile zerlegt und dadurch erweitert und entfaltet wird. Betrachtet (und hört) man Schützens Vertonung des 8. Psalms Herr, unser Herrscher (SWV 449), so zeigt sich in den ersten Takten des Stücks eine erstaunliche Ähnlichkeit beider Vorgehensweisen.
Beispiel 1: Heinrich Schütz, Herr, unser Herrscher (SWV 449), Takt 1–9
Schütz teilt die erste Textzeile, »Herr unser Herrscher, wie herrlich ist dein Nam in allen Landen«, in drei Phrasen auf, die er zunächst in unmittelbarer Folge präsentiert. Anstatt sofort zum nächsten Textvers überzugehen, entfaltet er dann die kompakte Aussage, ganz wie Erasmus es vorschlägt, indem er die drei Teile nochmals in verschiedenen Konfigurationen darstellt.
Die Anfangsphrase a (Takt 1–2), die das Kolon »Herr, unser Herrscher« deklamiert, wird als einleitendes Motto behandelt. Der zweite Teil b (Takt 3, »wie herrlich ist dein Nam«) erscheint zunächst ebenfalls nur einmal, während die Kadenzgeste (Takt 4–5, »in allen Landen«) zweimal in jeweils transponierter und augmentierter Form wiederholt wird. Dadurch wird, in Umkehrung der Burmeisterschen ›auxesis‹, der Schlußeffekt mit jedem Schritt gesteigert. Diese Dreifachteilung des Materials ist typisch für Schützens Arbeitsweise. Während des Entfaltungsprozesses wird klar, daß die drei Abschnitte die Funktion eines Anfangs-, Mittel- und Endteils übernehmen, wobei der erste durch eine Pause abgesetzt ist und der letzte durch die Wiederholung und Erweiterung als Schlußglied wirksam wird. Ein solches Vorgehen mag dem heutigen Hörer völlig selbstverständlich vorkommen und scheint auch Wilhelm Fischers bekanntes Ritornello-Modell von Vordersatz, Fortspinnung und Epilog vorwegzunehmen.[25] Zu Schützens Zeit allerdings war, wie auch aus den damaligen theoretischen Quellen ersichtlich, eine solche Strategie der funktionalen Differenzierung eine wichtige neue Errungenschaft. Der Komponist verwendet hier in kleinerem Rahmen die Dreiteilung, die Gallus Dressler für die formale Anlage eines ganzen Stückes gefordert hatte.
Der erste Abschnitt der Schützschen Komposition hätte problemlos in Takt 5 enden können. Schütz verlängert ihn aber statt dessen nochmals durch weitere variierte Wiederholungen: b wird jetzt von c abgetrennt und einmal wiederholt, gefolgt von einem erneuten dreifachen Erklingen des Kadenzteils in absteigender Sequenz. Dadurch wird der dramatische Anstieg zum f2 in Takt 6, der die intensivierte Wiederholung des Anfangsteils einleitete, umgekehrt. Die melodische und rhythmische Entspannung geht mit einer Rückkehr zur Ausgangstonalität g einher. Eine vergleichbare Strategie aber schlägt Erasmus dem Redner zur Verlängerung eines Einleitungsabschnittes vor: »Das ›exordium‹ wird auch durch eine wiederholte Darstellung erweitert, in der ein Fall, der kurz und einfach dargelegt wurde, in längerer und ausgeschmückterer Form wiederholt wird.«[26]
Obwohl der zweite Abschnitt des Anfangsteils in Schützens Komposition einen Takt kürzer ist als der erste, kann er beim Hören als eine Erweiterung erscheinen. Zusätzlich zur Wiederholung von b, die den gesamten Abschnitt ausgedehnter wirken läßt, wird dem Hörer durch die Wiederkehr von b in Takt 6 eine implizite Wiederholung auch von a als Auftakt zu b suggeriert; Phrase a dient daher gleichsam als Einleitungsphrase für beide Hälften, auch wenn sie tatsächlich nur einmal auftaucht. Dieser Vorgang der impliziten Verdoppelung wird erst durch den klar artikulierten Wiederholungsprozeß ermöglicht, der die Erwartung und Erinnerung des Hörers als gestaltbaren Bestandteil der Komposition begreift. Ein solches Spiel mit der Hörerfahrung, das später ein Hauptmerkmal des barocken und klassischen Stils ausmachen sollte, beruht auf der bewußten Einteilung des Materials in leicht faßbare und funktional differenzierte Einheiten, die dann wiederholt und variiert werden können.
Daß sich Erasmus’ erste Amplifikationsmethode als Gestaltungsprinzip in Schützens Komposition wiederfindet, soll hier nicht als Ausgangspunkt dafür dienen, die Werke von Schütz systematisch auf diese oder jene Erasmische Formulierung zu durchsuchen. Ein solches Vorgehen würde die mannigfaltigen musikalischen Prozesse letztlich wieder zu ›exempla‹ eines hartnäckig verteidigten externen Theoriesystems reduzieren (wie es auch die Figurenlehre oft mit sich bringt), ohne dabei die individuellen Gegebenheiten der musikalischen Disposition einzelner Stücke in Betracht zu ziehen. Entscheidend ist vielmehr, daß die gleiche grundlegende Vorstellung von kompositorischen Strategien der Wiederholung und Erweiterung vorliegt, wodurch die Beziehungen zwischen Musik und Rhetorik auf eine breitere Basis gestellt werden, die ein tieferes analytisches Verständnis individuell gestalteter musikalischer Formen ermöglicht.
In den beiden anderen überlieferten Schützschen Vertonungen dieses Psalmtextes lassen sich ähnliche Variations- und Amplifikationstechniken nachweisen. In der frühesten Fassung SWV 27 aus den Psalmen Davidsvon 1619 herrscht eine unkomplizierte Erweiterungsstrategie vor. Auf die im Tutti deklamierte und durch eine Pause klar artikulierte Eröffnungsphrase a (»Herr, unser Herrscher«) folgt Phrase b, durch die der gesamte zweite Teil des Satzes (»wie herrlich ist dein Nam in allen Landen«) ebenfalls im Tutti vorgetragen wird. Dieser zweite Abschnitt endet mit einer Kadenz auf a und wird dann vollständig in transponierter Form wiederholt, wodurch der harmonische Verlauf zur Ausgangstonalität g zurückgeführt wird. Die formfunktionale Differenzierung des musikalischen Materials ist hier auf eine Zweiteilung in Anfangs- und Schlußphrase beschränkt, von denen nur die letztere durch einfachste Mittel amplifiziert wird. Diese Schlichtheit in der formalen Anlage, die für den Ablauf des gesamten Stückes charakteristisch ist, mag ein Merkmal von Schützens frühem Stil sein und erklärt sich womöglich aus der liturgischen Funktion dieser ersten Psalmvertonungen, in denen der Komponist eine große Menge an Text möglichst zeitsparend verarbeiten mußte. Schütz erwähnt diesen Umstand selbst im Vorwort zu den Psalmen Davids: »[…] wie sich dann zu composition der Psalmen meines Erachtens fast keine bessere art schicket, dann daß man wegen menge der Wort ohne vielfältige repetitiones immer fort recitire […].«[27]
Beispiel 2: Heinrich Schütz, Herr, unser Herrscher (SWV 27), Takt 1–6
Ein komplexerer zeitlicher Verlauf mit einer dreifachen Zergliederung des Materials begegnet wiederum in Schützens letzter Fassung dieser Textvertonung (SWV 343), veröffentlicht in den Symphoniae SacraeII von 1647. Der gesamte Anfangsteil ist, wie auch in SWV 449, für eine Solostimme gesetzt, jedoch dienen hier zusätzlich zwei Violinen der Integration und Artikulation der verschiedenen Phrasen; ein Vorgang, der ferner durch den regulären Ostinato-Baß (Burmeisters ›palillogia‹) unterstützt wird, welcher die zunehmend verschnörkelte Vokalstimme an ein stabiles harmonisches und metrisches Gerüst bindet. Nach einer Wiederholung der Eröffnungsphrase a, die bruchlos zu Teil b überleitet, wird Amplifikation größtenteils durch die melismatische Erweiterung von b erreicht, wodurch die Mittel- oder Weiterführungsfunktion dieses Abschnittes besonders offensichtlich wird.
Eine traditionelle, an der Darstellung von Affekten orientierte Interpretation dieser Passage würde vielleicht die sich frei entfaltenden Melismen als eine figürliche Repräsentation des im Psalmtext benannten freudigen Ausdrucks des Lobes Gottes beschreiben. Die dadurch unterstellte Trennbarkeit von musikalischer Struktur und vom Text diktiertem dekorativen Affektausdruck wird der musikalischen Erfahrung aber nicht gerecht. Die Entfaltung der zunehmend amplifizierten Phrasen, die in ein Spannungsverhältnis zum monotonen Baß treten, gestaltet selbst ein überzeugendes und ausdrucksstarkes musikalisches Argument, in dem der sorgfältig gelenkte formale Prozeß die Direktheit der Expressivität überhaupt erst möglich macht. Ohne auf den begleitenden Textinhalt aufbauen zu müssen, entstehen hier Sinn und Intensität unmittelbar aus dem musikalisch-formalen Ablauf, wodurch eine strikte analytische Unterscheidung der Ebenen Struktur und Ausdruck fragwürdig wird – Form ist hier die Funktion eines Ausdrucks, welcher der formalen Disposition selbst innewohnt.[28]
Nachdem der höchste Ton des Melismas in Takt 7 erreicht ist, entspannt sich die Vokalmelodie in einer ersten ›clausula imperfecta‹ c (»in allen Landen«). Die Instrumente unterstützen die Prozesse von Abgrenzung und Weiterführung, indem sie zunächst die zwei Eröffnungsphrasen miteinander verbinden, später die Kadenzwirkung der Schlußphrase unterstreichen. Zugleich schaffen sie eine Verbindung zum nächsten Abschnitt, der schon beginnt, während die Violinen die Auflösung der Schlußformel erreichen (Takt 9). Eine variierte Wiederholung des gesamten Anfangsteils folgt, wiederum der Disposition von SWV 449 vergleichbar; jedoch entsteht hier ein noch überzeugenderer Eindruck von weitreichender tonaler Richtungsgebung: Die ›clausula imperfecta‹ in Takt 8 erfährt ihre Auflösung erst durch die ›clausula perfecta‹ in Takt 16, durch die auch die in den melismatischen Höhenflügen akkumulierte Spannung weitgehend neutralisiert wird. Das Melisma ist bei dieser Wiederholung des Anfangsteils noch weiter amplifiziert: Der Text zu Phrase b erscheint hier nur einmal und wird vom zunehmenden musikalischen Überschwang gänzlich überrollt, während die Violinen mit einer gleichzeitigen Variante von a die Komplexität zusätzlich erhöhen. Durch den geschickten Gebrauch dieser vielschichtigen Amplifikationsverfahren liefert Schütz hier meines Erachtens die musikalisch überzeugendste Version dieses Psalmtextes.
Beispiel 3: Heinrich Schütz, Herr, unser Herrscher (SWV 343), Takt 1–16
Sowohl in SWV 343 als auch in SWV 449 geht Schützens Formgestaltung weit über eine einfache Technik rein parataktischer Phrasengliederung hinaus. Das negativ belegte Konzept der ›Reihung‹, das mit der Musik des frühen 17. Jahrhunderts oft in Verbindung gebracht wird, ist hier nur in solchen Abschnitten ersichtlich, in denen eine lockerere formale Anlage selbst eine klare Funktion innerhalb der Gesamtkonzeption eines Stückes übernimmt. So zeigt sich in allen drei Versionen des 8. Psalms, daß im jeweiligen Mittelteil, der den oben diskutierten Anfangsabschnitten folgt, der Gebrauch von Wiederholungs- und Variationsmustern drastisch reduziert ist, während zum Beschluß jedes Werkes der Anfangsteil mit den von dort bekannten formalen Strategien und jeweils erhöhter Schlußwirkung wiederkehrt. Der kontinuierliche mittlere Abschnitt wird daher durch den Kontrast mit den zwei klar disponierten Rahmenteilen sofort als solcher kenntlich.[29]
Die weit verbreitete negative Einschätzung des Verständnisses von Form in der Musik des 17. Jahrhunderts – so argumentiert Clemens Kühn etwa, daß Form damals überhaupt kein substantielles Problem darstellte – geht auf den Formbegriff des 19. Jahrhunderts zurück, der, obwohl schon vielfach kritisiert, in der heutigen Musiktheorie und -pädagogik noch immer eine zentrale Rolle spielt.[30] Diese Art ›Formenlehre‹ bezieht sich zumeist auf eine Ansammlung statischer Strukturmodelle, die angeblich als Idealvorstellung den Werken des 18. und 19. Jahrhunderts zugrunde liegen, denen des 17. Jahrhunderts und früherer Zeiten aber fehlen. Ein rhetorischer, auf Erasmus fußender Zugang zu Fragen der musikalischen Syntax und Form im 17. Jahrhundert erlaubt eine gründliche Revision dieses althergebrachten Formbegriffs. Er begreift Form nicht als abstrakte, vor der Komposition selbst existierende Struktur, sondern als das Ergebnis flexibler und differenzierter kompositorischer Strategien. Durch die Betonung der temporellen und individuellen gegenüber den statischen und allgemeinen Qualitäten von Form kann dieser revidierte Formbegriff einen neuen Zugang zu den Werken von Schütz und seinen Zeitgenossen eröffnen. Die formalen und expressiven Qualitäten dieser Musik erweisen sich so als integrierte Aspekte eines sinnvollen und überzeugenden musikalischen Arguments.
Anmerkungen
Murphy 1983. | |
Zum Beispiel Lausberg 1960. | |
Vgl. Rix 1946. | |
Vgl. Kennedy 1980, 206. | |
Erasmus 1988, 76ff., 82ff. | |
Ebd. 197. | |
Ebd. 199f. | |
Schering 1908, vgl. auch Unger 1941. | |
Williams 1983, 238; vgl. auch Vickers 1984. | |
Mattheson 1737, 128; vgl. auch Butler 1977 und Budde 1997. | |
Bartel 1997 beispielsweise interpretiert die ›musica poetica‹ ganz im Sinne des Affektausdrucks durch Figuren; kritisiert wird dieser Ansatz u.a. in Forchert 1993, 9. | |
Dressler 1914/15, 245ff. | |
Gioseffo Zarlino und Christoph Bernhard benutzen den Begriff ›modulatio‹; bei Joachim Burmeister erscheint ›affectio‹ oder Periode, bei Nucius auch Phrase. | |
Burmeister 1606, 38. | |
Ebd. 61, 63. ›Auxesis‹ ist die harmonische (vielstimmige) Form des Ornaments, ›climax‹ die melodische. | |
Nucius 1613, Kap. 7. Er stellt unter dem Begriff ›climax‹ eine etwas andere musikalische Technik vor, bei der zwei Stimmen in parallelen Terzen oder Sexten fortschreiten. | |
Oechsle 1998, 20. | |
Nucius 1613, Kap. 1. | |
Zarlino 1968, 153. | |
Vgl. Oechsle 1998, 21. | |
Erasmus 1988, 32. | |
Lossius 1552. | |
Vgl. Ruhnke 1955,14 ff.; sowie Benito Riveras Einleitung zu Burmeister 1993, xlvi. | |
Vgl. beispielsweise Eggebrecht 1959. | |
Fischer 1915. | |
Erasmus 1988, 275. | |
Zitiert in Schütz 1931, 64. | |
›Sinn‹ hier in Anlehnung an Margaret Bents Formulierung »non-semantic sense« (2002, 50). | |
Vgl. dazu auch Volckmar-Waschk 2001, 79. | |
Kühn 1995, 608. |
Literatur
Bartel, Dietrich (1997), Musica Poetica: Musical-Rhetorical Figures in German Baroque Music, Lincoln: University of Nebraska Press.
Bent, Margaret (2002), »Sense and Rhetoric in Late-Medieval Polyphony«, in: Music in the Mirror: Reflections on the History of Music Theory and Literature for the 21st Century, hg. von Andreas Giger und Thomas Mathiesen, Lincoln: University of Nebraska Press, 45–59.
Budde, Elmar (1997), »Musikalische Form und rhetorische dispositio: Zum ersten Satz des dritten Brandenburgischen Konzerts«, in: Alte Musik und Musikpädagogik, hg. von Hartmut Krones, Wien: Böhlau, 69–83.
Burmeister, Joachim (1606), Musica Poetica, Rostock: Stephan Myliander, Reprint Kassel: Bärenreiter, 1955.
Burmeister, Joachim (1993), Musical Poetics, hg. und übers. von Benito Rivera, New Haven: Yale University Press.
Butler, Gregory (1977), »Fugue and Rhetoric«, Journal of Music Theory 21/1, 49–109.
Dressler, Gallus (1914/15), »Praecepta musicae poeticae«, hg. von Bernhard Engelke, Geschichts-Blätter für Stadt und Land Magdeburg 49/50 (1914/15), 213–250.
Eggebrecht, Hans Heinrich (1959), Heinrich Schütz: Musicus Poeticus, Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht.
Erasmus, Desiderius (1988), De copia verborum ac rerum, hg. von Betty I. Knott, in: Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami, Bd. 1.6, Amsterdam: Elsevier.
Forchert, Arno (1993), »Heinrich Schütz und die Musica Poetica«, Schütz-Jahrbuch 15, 7–23.
Fischer, Wilhelm (1915), »Zur Entwicklungsgeschichte des Wiener klassischen Stils«, Studien zur Musikwissenschaft 3, 24–84.
Kennedy, George (1980), Classical Rhetoric and Its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times, Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Kühn, Clemens (1995), »Form«, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. Ausg., hg. von Ludwig Finscher, Kassel und New York: Bärenreiter, Bd. 3, 607–643.
Lausberg, Heinrich (1960), Handbuch der literarischen Rhetorik, München: Hüber.
Lossius, Lucas (1552), Erotemata dialecticae et rhetoricae Philippi Melanchthonis, et praeceptionum Erasmi Roterdami, de utraque copia verborum et rerum, Frankfurt: Petrus Brub.
Mattheson, Johann (1737), Kern melodischer Wissenschaft, Hamburg: Christian Herold, Reprint Hildesheim: Olms, 1990.
Murphy, James (1983), »One Thousand Neglected Authors: The Scope and Importance of Renaissance Rhetoric«, in: Renaissance Eloquence: Studies in the Theory and Practice of Renaissance Rhetoric, hg. von James Murphy, Berkeley: University of California Press, 20–36.
Nucius, Johannes (1613), Musices Poeticae, sive de compositione cantus, Neisse: Crispinus Scharffenberg, Reprint Leipzig: Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, 1976.
Oechsle, Siegfried (1998), »Musica poetica und Kontrapunkt: Zu den musiktheoretischen Funktionen der Figurenlehre bei Burmeister und Bernhard«, Schütz-Jahrbuch 20, 7–24.
Rix, Herbert David (1946), »The Editions of Erasmus’ De Copia«, Studies in Philology 43, 595–618.
Ruhnke, Martin (1955), Joachim Burmeister: Ein Beitrag zur Musiklehre um 1600, Kassel: Bärenreiter.
Schering, Arnold (1908), »Die Lehre von den musikalischen Figuren im 17. und 18. Jahrhundert«, Kirchenmusikalisches Jahrbuch 21, 106–114.
Schütz, Heinrich (1931), Gesammelte Briefe und Schriften, hg. von Erich Müller, Regensburg: Gustav Bosse..
Unger, Hans Heinrich (1941), Die Beziehungen zwischen Musik und Rhetorik im 16.–18. Jahrhundert, Hildesheim: Olms.
Vickers, Brian (1984), »Figures of Rhetoric/Figures of Music?«, Rhetorica 2/1, 1–44.
Volckmar-Waschk, Heide (2001), Die Cantiones sacrae von Heinrich Schütz: Entstehung, Texte, Analysen, Kassel: Bärenreiter.
Williams, Peter (1983), »The Snares and Delusions of Musical Rhetoric: Some Examples from Recent Writings on J.S. Bach«, in: Basler Jahrbuch für Historische Musikpraxis, Sonderband, Winterthur: Amadeus, 1983, 230–240.
Zarlino, Gioseffo (1968), The Art of Counterpoint: Part Three of Le istitutioni harmoniche, 1558, übers. von Guy A. Marco and Claude Palisca, New Haven: Yale University Press.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.